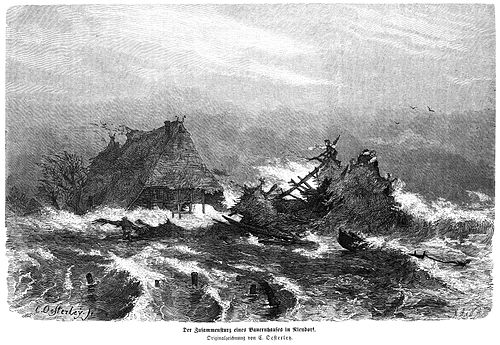Die Gartenlaube (1872)/Heft 52
[847]
| No. 52. | 1872. | |
Illustrirtes Familienblatt. – Herausgeber Ernst Keil.
Wöchentlich 1½ bis 2 Bogen. Vierteljährlich 15 Ngr. – In Heften à 5 Ngr.
Plötzlich tiefe Stille, als wäre ein Blitz vor Aller Augen in die Erde geschlagen. Brandow hatte die Stelle erreicht, von der ein paar Secunden vorher Graf Grieben, sicher gemacht durch seines Gegners Zurückbleiben, abgebogen; und mit einem mächtigen Satze war der Brownlock auf dem Moor, ohne nur eines Haares Breite von der geraden Bahn abzuweichen, mitten über den tiefsten, aber auch schmalsten Theil fliegend, mit einer Schnelligkeit, die mit jedem Moment zuzunehmen schien, während der Reiter nicht Peitsche, nicht Sporn brauchte, als ritte er über glattesten Wiesengrund, und jetzt mit der Hand seinem Nebenbuhler winkte, als er an ihm vorbeijagte, daß das Wasser in hellem Strahl hoch aufspritzte.
Und da hatte er auch schon den diesseitigen Rand erreicht und kam die breite gerade Bahn hinauf, welche auf das Ziel vor der Tribüne zuführte, – nicht mehr in der rasenden Carrière, sondern in langgestrecktem Galopp, als wolle er seinen Gegner verhöhnen, der jetzt, nachdem er den festen Grund erreicht, am Siege verzweifelnd, aus der Bahn gebrochen war; schien es doch, als wolle er der Menge Gelegenheit geben, ihm ihre Huldigung darzubringen.
Und „Hurrah Brownlock! Hurrah Brandow!“ riefen sie, und schwenkten die Hüte und Mützen, und der brausende Ruf pflanzte sich fort und schwoll an zu einem donnernden betäubenden Schall, als jetzt der Sieger an den Tribünen vorüber in demselben langgestreckten Galopp durch das Ziel ritt. Alle Welt stand auf den Fußspitzen, die Herren Hurrah rufend, die Damen mit den Tüchern wehend, – und nun drängte Alles die breite Treppe hinunter auf den Plan, um den Sieger und das herrliche Pferd noch näher zu sehen, wenn er jetzt, wie es der Brauch war, zurückkommen und noch einmal, aber im Schritt, an den Tribünen vorüber auf den Sattelplatz reiten würde.
„Hier gilt kein Recht und nur die Stärke siegt,“ sagte der Fürst, der, ebenso wie Gotthold, von der nachdrängenden Menschenwoge die Treppe hinabgeschoben wurde; „die Stärke des Enthusiasmus, der selbst in dem Schwachen mächtig ist. Sehen Sie doch nur, wie heldenmüthig sich jene zarte Dame durch’s Gedränge kämpft. – Ist es Frau Brandow? ich würde ihr dann den Arm anbieten.“
Der blaue Schleier der Dame wehte Gotthold in’s Gesicht und dann sah er Alma Sellien. Sie sah ihn nicht, trotzdem sie unmittelbar neben ihm stand. Das feine blasirte Gesichtchen seltsam verschönert durch ein stolzes Lächeln, die sonst so matten, lässigen blauen Augen strahlend in Freudenfeuer, blickte sie, harrte sie, auf nichts um sie her achtend, dem Geliebten entgegen, dessen unbedeckter Kopf eben über der wogenden Menge sichtbar wurde. Und jetzt tauchten ein paar rothe Schultern auf und verschwanden wieder, um wieder zu erscheinen, und jetzt der herrliche nickende Kopf eines Pferdes, und jetzt der ganze rothbefrackte Reiter. Die, welche in der ersten Reihe des Spaliers standen, waren, den Fürsten erkennend, auf die Seite gewichen, und er und ein paar andere Herren und Damen, unter ihnen Alma Sellien, in den Vordergrund gedrängt worden, während sich vor Gotthold, der gern zurückstand, die Reihen wieder schlossen. Und schon war Brandow, der, den Hut in der Hand, sich nach rechts und links verbeugend, mit einem paar neben ihm hergehenden Freunden plauderte, in ihre unmittelbare Nähe gekommen, als er den Fürsten sah und an dem Arm des Fürsten Alma Sellien. Ein Lächeln der Verwunderung zuckte über sein Gesicht; er warf, Front machend, den Brownlock in kürzester Wendung herum, und neigte sich tief auf den schlanken Hals des Renners. Schnaubend, in den Zügel knirschend, mit den Hufen ungeduldig scharrend und mit den großen feurigen Augen in die Menge blickend, stand das edle Thier. Plötzlich prallte es, wild erschrocken, auf die Seite und stieg dann, als sein Reiter es wieder auf die Stelle zwingen wollte, jäh in die Höhe. „Zurück!“ schrie der Fürst der Menge zu, die, von allen Seiten herandrängend, sich zu einem Knäuel zusammengeballt hatte. Aber, die weiter wegstanden, und denen keine unmittelbare Gefahr drohte, blieben unbeweglich. „Zurück, zurück!“ schrie der Fürst noch einmal; die Damen kreischten; „springen Sie herunter, Brandow!“ riefen die Herren. Aber Brandow schien seine allbewunderte Reitkunst vergessen zu haben. Einige sagten später, er sei vom ersten Moment betäubt gewesen durch einen schweren Schlag, mit welchem der zurückschnellende Kopf des Pferdes seine Stirn getroffen. Während er erfolglos, in unbegreiflich verkehrter Weise mit dem Pferde kämpfte, hatte er die Augen starr auf einen Mann aus dem Volk gerichtet, der irgend wie – es drängte Alles wild durcheinander – auch in die vorderste Reihe gekommen war, und jetzt unmittelbar vor, ja unter das sich bäumende Pferd sprang, die Arme hoch erhoben; man glaubte, er werde das rasende Thier an dem Zügel herunterreißen.
„Lassen Sie mich durch, um Gotteswillen!“ schrie Gotthold.
Er hatte in dem Manne Hinrich Scheel erkannt, trotzdem er nur den viereckigen, mit krausen grauschwarzen Haaren bedeckten Schädel, von dem die Mütze im Gedränge heruntergestoßen war, gesehen; nicht das brutale Gesicht mit den grünlichen Schielaugen, vor deren dämonischer Macht das geängstete [848] Thier sich hoch und höher bäumte, mit den stahlbedeckten Hufen wüthend in die Luft hauend, als möchte es seinen Quäler vernichten. Und jetzt traf einer der stählernen Hufe den Kopf des unheimlichen Mannes; und der Mann, als hätte er eine Kugel durch die Stirn bekommen, brach jäh zusammen; in demselben Moment aber überschlug sich das wieder emporschnellende Pferd, in fürchterlichem Fall den Reiter unter seiner Last begrabend. Angstheulend stob die Menge auseinander.
„Ein Arzt, ein Arzt, ist kein Arzt hier?“
Es war kein Arzt da; es hätte auch kein Arzt helfen können. Der Mann, der dem Pferde hatte in die Zügel fallen wollen, und in welchem jetzt auch Andere Brandow’s früheren Traineur, den steckbrieflich verfolgten Hinrich Scheel erkannten, lag mit zertrümmertem Schädel und fürchterlich verzerrtem Gesicht, aus dem die gebrochenen Augen gräßlich starrten, todt auf dem Rücken; sein Herr lebte noch, aber Gotthold, der ihn in seinen Armen hielt, sah, daß es schnell zu Ende ging. Todesblässe bedeckte die feinen scharfen Züge, seltsam schauerlich glänzten die weißen Zähne aus den blauen Lippen. Und nun flog ein Zucken durch den ganzen Körper; das Haupt sank an Gotthold’s Brust.
„Hier kommt ein Arzt!“ riefen ein paar Stimmen.
„Er findet nichts mehr zu thun,“ murmelte Gotthold, „helfen Sie mir, ihn forttragen.“
Als man ihn aufhob, kreischte eine Dame in blauem Schleier, die mit krampfhaft gefalteten Händen dabei gestanden, laut auf und fiel in Ohnmacht.
Man achtete nicht eben darauf; es waren schon verschiedene Damen in Ohnmacht gefallen.
Ein wunderschöner Herbst mit goldigen, mildwarmen Tagen und sternenklaren Nächten war in’s Land gekommen. Ueberall blühten noch in den Gärten neben den Astern sommerliche Rosen, und nur ganz allmählich färbten sich die Wälder. Es war so still in den Lüften, daß die Sommerfäden kaum von der Stelle rückten, und wenn ein Blatt herab sank, blieb es liegen, wo es den Boden berührt. Die Zugvögel hatten ihre Wanderschaft unterbrochen und in den Hecken, auf den Feldern zirpte und lockte es mit kleinen munteren Stimmchen, während des Abends vom Strande her noch die wilden Schwäne riefen, die sonst um diese Zeit längst auf den mächtigen weißen Schwingen in ihre nordische Heimath entschwebt waren.
Es war ein wunderschöner Herbst, der dem Sommer täuschend ähnlich sah; „aber es ist eben eine Täuschung,“ sagte sich Cäcilie, „der Sommer ist zu Ende; der Winter steht vor der Thür; ich muß mich auf den Winter einrichten.“
Sie war schon seit sechs Wochen in Dollan, das sie nie wieder zu betreten gedacht, nie wieder zu sehen gehofft hatte. Aber die Aerzte hatten dringend gewünscht, daß Gretchen zu ihrer Wiederherstellung von der schweren Krankheit, wenn ein winterlicher Aufenthalt im Süden unthunlich sei, wenigstens die schönen Herbsttage an der See verlebe an einem sonnigen, vor rauheren Winden geschützten Ort; und welcher Ort hätte diesen Anforderungen mehr entsprochen, als das stille, sonnige Dollan? Und wenn es trotzdem ein Opfer für sie war, hierher zurückzukehren, so brachte sie es ohne Zögern gern ihrem Kinde und ihrem alten Vater.
Er hatte so dringend nach Dollan zurückverlangt, als er aus einer tiefen Ohnmacht, welche ihn ein paar Tage nach der Katastrophe auf der Rennbahn mitten im Kreise der Freunde jäh befallen, gegen das Erwarten des Arztes, noch einmal zum Leben erwacht war. „Erfüllen Sie dem alten Manne seinen Wunsch,“ sagte der Arzt, „und thun Sie es schnell; er wird nicht viele Wünsche mehr zu stellen haben. Seine Tage sind gezählt, und da ist es wohl unsere Pflicht, ihm für diese Tage all’ den Sonnenschein zu schaffen, dessen er hier in der Straßen quetschender Enge so schmerzlich entbehrt.“
Und mit tiefer Dankbarkeit begrüßte der alte Mann den Sonnenschein auf seiner Heimathflur. Nicht, als ob er seinen Dank in Worten geäußert hätte! Er sprach auch sonst nur wenig mehr; aber auf seinem blassen stillen Gesicht lag ein so unverkennbarer Ausdruck tiefsten Friedens, und aus seinen milden Augen leuchtete es oft wie frohes Erinnern und um seine Lippen spielte oft ein glückliches Lächeln, während er an Cäciliens Seite, an Cäciliens Arm langsam durch die sonnigen Felder schritt. Oft war er auch – manchmal schon am frühen Morgen – allein ausgegangen, und Cäcilie war um ihn besorgt gewesen und hatte endlich zu bitten gewagt, daß er sie mitnehmen möge, es sei ihr keine Stunde zu früh. Aber der alte Mann hatte ihr die Wangen gestreichelt und gesagt: „Laß mich nur; Du kennst sie ja doch nicht.“
Cäcilie hatte über das sonderbare Wort nachgesonnen und es erst begriffen, als sie einmal von ihrem Fenster aus in der Morgendämmerung den Alten im Garten lange an einem der ältesten Bäume stehen sah – einer Linde, von der die Sage ging, daß Karl der Zwölfte von Schweden schon in ihrem Schatten gesessen –, und dann hatte er mit dem schneeweißen Haupte genickt und mit der Hand gewinkt, wie die Menschen pflegen, wenn sie von Jemand Abschied nehmen. Ja, der alte Mann nahm Abschied, wenn er so allein durch Garten und Feld und Wald und Wiesen streifte – Abschied von den Freunden, Bekannten seiner Jugend: von einem Baume hier, unter dessen Zweigen er von der Geliebten geträumt; von dem Felsen dort, an dessen harte Brust er einst das jammergequälte, jugendstarke Herz gepreßt; von der Wiese, auf der er das wilde Roß getummelt, mit dem er sich die schöne Ulrike von Dahlitz erreiten wollte; von dem Walde, dessen Echo so oft der Knall seiner guten Büchse wachgerufen. Er trug sie jetzt nimmer, die gute Büchse, die ihn sonst auf allen Wegen begleitet; sie lehnte ruhig in der Ecke; er hatte von der treuen Gefährtin für immer Abschied genommen.
Auch nach dem Strandhause lenkte er nie mehr seine Schritte; und als er einst an Cäciliens Seite durch den Wald gewandert war und sie unversehens aus den Bäumen heraus auf die Uferhöhe traten, schien er fast erschrocken, und dann schüttelte er das ehrwürdige Haupt und murmelte: „Das hat mich viele Jahre gekostet, viele, viele Jahre!“ Darauf hatte er mit der Hand eine Bewegung gemacht, als wollte er sagen, daß diese Jahre weggewischt seien von der Tafel seiner Erinnerung.
Vielleicht waren sie es; er erwähnte nie mit einem Worte der unendlichen Zeit, welche er im Strandhause verlebt; aber manchmal fing er an zu erzählen von seinen Jugendjahren – uralte Geschichten, von denen kein Lebender wußte, außer ihm, und dabei konnte er behaglich lachen, und ein andermal rannen ihm die Thränen über die welken, blassen Wangen.
Uralte Geschichten, in denen er Alles wußte, jeden Namen und Vornamen und den Tag und die Stunde, und ob die Sonne geschienen oder der Regen geregnet; aber von dem, was jüngst geschehen war, wußte er nichts, oder verwirrte es in der seltsamsten Weise. So nannte er Cäcilie wiederholt mit dem Namen der Geliebten seiner Jugend: Ulrike; und es war Cäcilie peinlich bis zum Schmerz gewesen, daß er dann und wann von ihrem Gatten sprach, von Gretchens Vater, als von einem geliebten Menschen, nach dem er eine große Sehnsucht empfinde, obgleich er ja erst kürzlich dagewesen, bis sie begriff, daß er Gotthold meine.
Es hatte sie im ersten Moment seltsam berührt; und dann, als der alte Mann wieder darauf zurückkam und so ruhig, als ob es nie anders gewesen sei, nie anders sein könne, ihren Namen mit dem des Geliebten in so innige Verbindung brachte, hatte sie es hingenommen, wie einen holden Traum, den man mit halbgeschlossenen Augen und halbwachen Sinnen träumt, bis sie vor der Gefahr, die in dem Traume lag, erschrocken aufgefahren war. Es durfte, es konnte ja nicht sein! weshalb sich eine Wirklichkeit vorgaukeln, die unmöglich war, eine Zukunft, die niemals kommen konnte!
Und das sagte sie mit einer leidenschaftlichen Heftigkeit und einem Strom von Thränen, mehr zu sich selbst, als mit dem Alten redend, wie er wieder einmal von Gotthold gesprochen, der zu lange ausbleibe, der sie, die sich so nach ihm sehne, das Kind, das so gern mit ihm spiele, zu viel und zu lange allein lasse. Sie sagte ihm, daß sie nicht daran denken dürfe; daß zu viel, zu viel geschehen sei, was sie für immer trenne, und daß sie ihr Blut, wenn es nicht ihrem Kinde und ihrem Vater gehörte, Tropfen um Tropfen für ihn hingeben würde, aber daß sie nie und nimmer seine Gattin sein könne.
Es war im Garten an einem der sommerlich schönen Abende dieses Octobermondes, und der Alte hatte, während sie sprach, tiefernsten Gesichts in den saffranfarbenen Ost geblickt, der durch das bunte Laub der Bäume schimmerte, in welchem auch nicht [849] der leiseste Hauch zu spüren war. „Ja, ja,“ sagte er, „Du hast viel, viel gelitten; aber“ – fügte er nach einer Pause hinzu – „es ist auch schon lange, so lange her. Die Zeit macht Vieles gut, Vieles!“
Er schien in seine Träumereien zu versinken von den Tagen, die nur für ihn kein Nichts waren, die nur für ihn aus dem Lethe auftauchten; dann aber, als sein Blick das stillweinende Antlitz an seiner Seite streifte, strich er sich mit der Hand über Stirn und Augen und sagte hastig, als fürchte er, es wieder zu vergessen:
„Nicht Alles! oder doch langsam, sehr langsam; es können sechszig, siebenzig, ich weiß nicht, wie viele Jahre darüber vergehen; und ganz gut wird es auch da noch nicht, bis man sich ein Herz faßt und es einem Menschen sagt. Ich habe es ihm gesagt, an dem Abende, als ich ihn auf dem Meere gerettet; und es ist so viel Gutes daraus gefolgt, so sehr viel Gutes; mir ist seitdem so leicht im Herzen geworden. Du mußt es auch Jemand sagen, nicht mir; ich vergesse so viel und könnte das auch vergessen. Du mußt es ihm sagen.“
Und als sie am nächsten Abend in demselben Gange des Gartens auf- und niederwandelten und das Abendlicht wieder durch die Zweige schimmerte, blieb er plötzlich stehen und fragte: „Hast Du es ihm gesagt?“ und so fragte er am dritten und vierten Tage und schüttelte immer sorgenvoller das weiße Haupt, als sie mit brennenden Wangen erwidern mußte: „Nein, Vater, ich habe es ihm noch nicht gesagt,“ und bei sich hinzufügte: „und werde es ihm auch nicht sagen, wenn er morgen kommt, und werde es ihm nimmer sagen.“
Gotthold kam, nicht allein. Fürst Prora, bei welchem er wiederum mehrere Tage auf Waldschloß zugebracht, um die Skizzen für den Waffensaal vorzulegen und die Reihenfolge der italienischen Landschaften für den Speisesaal endgültig festzustellen, hatte ihm auf dem Rückwege nach Prora durchaus das Geleit geben wollen, und als er hörte, daß Gotthold unterwegs noch in Dollan vorsprechen müsse, um sich vor seiner Reise nach Italien zu verabschieden, um die Erlaubniß gebeten, ihn auch dorthin begleiten zu dürfen.
„Denn wir sind doch eigentlich,“ sagte der junge Mann, „mag ich nun von Prora oder Waldschloß kommen, Nachbarn, gnädige Frau, und da wäre es längst meine Schuldigkeit gewesen, Ihnen meine Aufwartung zu machen; aber ich will es nur gestehen, daß mich heute noch ein besonderes Interesse herführt. Unser Freund hier hat mir früher schon von dem großen Hünengrabe erzählt, welches Sie in Ihrem Walde haben, und daß es vielleicht das am besten erhaltene auf der ganzen Insel sei. Nun brauchen wir für den Waffensaal durchaus eine Landschaft mit einem Hünengrabe, und als ich ihn an das Dollaner erinnere, sagt der halsstarrige Mensch, das eigne sich nicht. Ich behaupte natürlich, daß wir gar kein anderes brauchen können, sintemalen Dollan, bevor es in Ihre – ich meine die Wenhof’sche – Familie kam – was nun freilich auch bereits, wenn wir den schwedischen Zweig, wie billig, mitrechnen, zweihundert Jahre her ist –, Prora’scher Grund und Boden war, wie der ganze Theil dieser Insel; ja, es hat hier auf der Uferhöhe eine mit hohem Erdwall, Pfahlwerk und Graben umgebene Prora’sche Burg aus der Heidenzeit gelegen, deren Ueberreste in alten Chroniken noch Erwähnung geschieht, und es ist also leicht möglich, ja wahrscheinlich, daß jene Gräber die Gebeine meiner Vorfahren bedecken. Und um eine solche Reminiscenz sollte ich eines Künstlereigensinns wegen gebracht werden? Nimmermehr! Wir haben eine Stunde Zeit, hin und zurück brauche ich, wie ich höre, eine halbe Stunde – bitte, lieber Freund, derangiren Sie sich nicht! Sie sind der Letzte, den ich mitnehme, damit Sie mir durch Ihre Einreden die Stimmung verderben.“
„Ich will Sie gern begleiten,“ sagte der alte Boslaf; „ich bin mit Ihrem Herrn Urgroßvater Durchlaucht oft genug oben gewesen auf der Birsch. Ich bin lange, lange nicht oben gewesen; ich möchte gern noch einmal hinauf.“
Der Fürst blickte den Alten verwundert an; er hatte ihn, von dem ihm Gotthold so Manches erzählt, gleich zu Anfang mit Ehrfurcht begrüßt; aber es wollte ihm wie ein Märchen erscheinen, daß Jemand mit Malte von Prora zusammen auf der Jagd gewesen sein könne, der zu Friedrich des Großen Zeiten lebte und noch vor dem siebenjährigen Kriege von der schwedischen Regierung in einer diplomatischen Mission nach Berlin geschickt wurde.
„Das kann ich unmöglich annehmen,“ sagte er, „unmöglich!“
Aber der Alte schien nicht auf die höfliche Weigerung zu achten; er hatte bereits seinen Stock ergriffen und ging mit langen Schritten voran aus dem Garten, wo dieses Gespräch stattgefunden. Der Fürst beeilte sich lächelnd, ihm zu folgen.
„Durchlaucht verstatten wenigstens, daß wir nachkommen,“ sagte Gotthold.
„Ich bitte darum,“ erwiderte der Fürst, „um des alten Herrn willen, dem meine Gesellschaft auf die Dauer doch nicht genügen möchte,“ und dann, Gotthold noch ein paar Schritte weiter führend, fügte er hinzu; „Wir haben eine Stunde, lassen Sie sie nicht unbenutzt verstreichen. Nachdem ich diese Frau gesehen, verstehe ich, begreife ich Alles, was Sie mir nicht gesagt haben, Sie Verschwiegenster der Menschen. Möge Sie der Gott der verschwiegen Liebenden in seinen gnädigen Schutz nehmen!“
Gotthold schritt langsam zu dem Platze zurück, wo er Cäcilien verlassen und noch in derselben nachdenklichen Stellung stehen sah. Würde sie heute sprechen, würde sie schweigen, wie sie es bisher gethan, ihn schweigend ziehen lassen?
Er trat an sie heran und ergriff ihre herabhängende Hand. „Cäcilie!“
Sie hob langsam die dunkeln Wimpern und sah ihn mit einem Blicke rührender Bitte an.
„Ich soll Dich nicht reden heißen? soll Dich schweigen lassen, Cäcilie? Und doch muß gesprochen sein; so laß es mich für Dich thun. Du könntest es nur einer Frau sagen, und der brauchtest Du es nicht zu sagen: sie würde Dich ohne das verstehen. War es nicht so? Sollte die Liebe weniger hellsehend sein als das Auge einer mitfühlenden Freundin? Ich weiß es nicht; ich kann Dir nur sagen, was ich in Deinem Herzen lese. Und das ist es nun, Cäcilie. Du liebst mich, aber wagst es nicht, Deiner Empfindung frei zu folgen; ja, Du bebst vor dem Gedanken, meine Gattin zu werden, scheu zurück, wie vor einer Versündigung – an wem? Es klingt hart, Cäcilie, und doch muß ich es sagen: an Deinem Stolz. Das ist es, was Du fürchtest, Dich selbst, nicht mich. Du weißt – so sicher, wie dort die Sonne sinkt, um morgen wieder aufzugehen –, daß nie ein Tag kommen wird, nie eine Stunde, wo ich Dir mit einem Worte, einem Blicke einen Vorwurf daraus machen werde, daß Du – unglücklich, so unglücklich grenzenlos gewesen bist; Du weißt, daß ich Dir – wie ich denke – nichts zu vergeben habe. Aber Du, Cäcilie, Du meinst, daß Du es Dir nie wirst vergeben können; Du meinst, daß, weil Du als ein unerfahrenes sechszehnjähriges Mädchen Dich geirrt hast, Reue und Scham Dich verfolgen müßten in alle Zukunft, Reue und Scham Dich aufschrecken würden aus meinen Armen, wenn Du je dem Zuge Deines Herzens gefolgt wärst und Dich in meine Arme geworfen hättest.“
„Und hätte ich nicht Recht, so zu denken, zu fühlen?“ rief Cäcilie, während die Thränen über ihre glühenden Wangen strömten; „könnte ich mir je vergeben, das Weib dieses Mannes geworden zu sein – als sechszehnjähriges, unerfahrenes Mädchen, sagst Du? Ich war so unerfahren nicht; ich war welterfahren genug, um zu begreifen, daß das Leben in dem schönen Schlosse, in dem schattigen Park von Dahlitz glänzender werden dürfte, als das in einer düsteren Landpfarre. Und ich trat das Herz des armen Studenten unter die Füße, obschon eine Stimme, die nie wieder zum Schweigen gekommen ist, mir schon damals zuraunte: es ist der bessere Mann. Das sollte ich mir vergeben? und daß ich ihn mit halbgebrochenem Herzen in die Ferne ziehen ließ, ohne ein Wort des Mitleids, des Trostes für ihn zu haben, froh, daß seine treuen Augen nicht mehr auf mir ruhten, nicht mehr in meiner eitlen Seele lasen? Und nun, da aus meinem hoffährtigen Traume geworden ist, was werden mußte; nun, da ich so grenzenlos elend bin, wie ich es zu werden verdiente, und er zurückkommt und vor mir steht, ein edler, reiner Mann, der mit gerechtem Stolz auf seine keusche, arbeitreiche Vergangenheit blicken darf und mit freudiger Ruhe in seine Zukunft, die sich immer glorreicher entfalten muß – jetzt soll er seinen Siegerschritt hemmen, die so tief Gefallene aufzurichten; ja, was sage ich! soll sie für alle Zukunft an sich fesseln, um sich selbst zu fesseln, um sich die starken, arbeitfrohen Hände zu binden, den stolzen Geist, der immerdar im Höchsten beschäftigt sein soll, hinabzuzwingen zu der ewigen Betrachtung, zu der täglichen, stündlichen Theilnahme eines elenden, selbstverschuldeten Geschickes? [850] Stolz, sagst Du, wäre es, was mich verhindert, das zu thun? Sei es denn Stolz! aber doch nur für Dich, auf Dich! Ach, Gotthold, ich habe ihn nicht erst seit heute, diesen Stolz! ich bin schon stolz auf Dich gewesen, damals, wenn Du mit glänzenden Augen so schön sprechen konntest von Göttern und Helden, und daß der heldenhafte Mensch sich kühn den Göttern vergleichen dürfe; und als ich nach Jahren des Leides hörte, daß Du Dich durch unsägliche Hindernisse, an denen Andere tausendmal zu Grunde gegangen wären, durchgedrungen, und mit einer Schnelligkeit, die ihnen, die Dich nicht kannten, und Deine Kraft und Deinen Fleiß, wunderbar erschien, Dich zu der höchsten Höhe Deiner Kunst emporgeschwungen und der Name des jungen Künstlers nur mit den besten stets genannt wurde – ja, Gotthold, da bin ich stolz gewesen, so stolz und so dankbar! – ich habe gemeint, nun könne ich Alles leichter ertragen, da mein Frevel nicht an Dir heimgesucht, da ich allein zu sühnen hatte, was ich allein verbrochen!“
Sie waren aus den abendlichen Feldern, über denen die Sommerfäden im röthlichen Licht der sinkenden Sonne schwebten, in den stillen dunkelnden Wald getreten. Kein Laut, als das Rascheln der braunen Blätter zu ihren Füßen; und jetzt, als Cäcilie schwieg, der klagende Sang eines einsamen Vögelchens.
Aber Gotthold hörte keine Unterbrechung; ihm war, als ob die klagende Vogelstimme nur den Klaggesang der Menschenstimme weitersinge.
„Allein, allein,“ sagte er, „und immer wieder allein, und so willst Du genesen, armes Weib! Und kann denn der Mensch allein sein? und bist Du denn allein? Gesetzt, ich wäre – was ich nicht bin – der starke Held, der den einsamen Weg durch unendliche Arbeit sich hinaufringt zu dem goldenen Tische des Vaters – ist denn Dein Kind nicht da, dem Du die schöne, sonnige Welt erschließen sollst! Du, die sich verhüllten Hauptes in stummer Verzweiflung vom Leben abwendet? Welche Tugenden willst Du es lehren, die Du selbst so ganz der Freudigkeit ermangelst, in der einzig die Tugenden gedeihen; ja, die Du nicht mehr an die Tugend glaubst, an die beste, die höchste, die aller Tugend Tugend ist, die uns zu Dem macht, was wir sind, die uns zu Menschen macht: an die Liebe? Wer klagt mit dem Vögelchen dort, das, im herbstlichen Land verborgen, verwundet vielleicht und verstümmelt, zurückgeblieben ist, um elend zu verkommen? Keiner seiner Brüder und Schwestern, sein Gatte nicht, seine Kinder nicht – sie sind Alle achtlos fortgezogen und haben es zurückgelassen – allein, allein! Nun wohl, sie folgen dem ehernen Gesetz, das ihr Kommen und Gehen, ihr Leben und ihr Sterben bedingt, und so sündigen sie nicht, können nicht sündigen; aber wir können es und wir sündigen, wenn wir dem Gesetz nicht folgen, das uns regiert, wenn wir der Liebe nicht folgen. Sie ist das allgewaltige Band, das alle Geschlechter der erdgeborenen Menschen von Anfang bis Ende zusammengehalten hat und halten wird; die allmächtige Sonne, vor deren holdem Strahl es wieder lenzen muß auch in dem dunkelsten, trübsten Herzen; und so mit meiner Liebe halte ich Dich, Geliebte, wie Du Dich auch sträubst; durchglühe ich Dein Herz, wie Du es auch vor mir verschließest, denn ich bin mächtiger als Du, daß ich Dir leihen kann von meiner Kraft und dennoch genug behalte für mich und Dich und Dein Kind – unser Kind, Cäcilie!“
Sie war stehen geblieben, an allen Gliedern zitternd; bleich, die dunklen, thränenverschleierten Augen, die gefalteten Hände zu ihm erhebend:
„Erbarmen, Gotthold, Erbarmen! ich kann nicht mehr; ich kann nicht mehr!“
Ein rascher Schritt kam den schmalen Pfad, der zu den Hünengräbern führte, hinab.
„Gott sei Dank! ich wollte Ihnen entgegen; gnädige Frau – ich glaube – ich weiß, Sie sind nicht wie unsere anderen Damen –“
„Er ist todt!“ rief Cäcilie.
„Ich fürchte, wir finden ihn nicht mehr am Leben, wenn er auch noch die Kraft hatte, mich fortzuschicken. Ich ging ungern, aber er verlangte so sehr, so herzlich nach Ihnen, nach Ihnen Beiden.“
Sie liefen den Pfad durch das Unterholz hinauf, die Haidehügel empor, auf das Hünengrab zu, dessen gewaltige Masse sich dunkel von dem hellen Abendhimmel absetzte.
Er saß auf einem moosbewachsenen Stein, den Rücken an einen der größeren Blöcke gelehnt, die Hände im Schooß gefaltet, mit einem wunderbaren Ausdruck tiefsten Friedens auf dem bleichen, ehrwürdigen Gesicht, still in den Abend schauend, der über den Feldern, über den Wäldern, auf der Haide, auf dem Meere verglomm. Cäcilie war zu seinen Füßen in das Haidekraut gesunken, ihre Lippen auf seine erkaltenden Hände drückend
Bei der Berührung flog ein leises Beben durch die Glieder des Sterbenden. Sein Blick wandte sich langsam aus der Weite in die Nähe, und ruhte jetzt auf dem schönen blassen, thränenüberströmten Gesicht vor ihm. Ein seliges Lächeln dämmerte in seinen Zügen auf; „Ulrike!“ flüsterte er. Es kam leise, hörbar kaum über die blassen Lippen, und dann schlossen sich die Lippen und die Augen.
Cäciliens Haupt lag an Gotthold’s Brust; der Fürst, der während der ganzen Scene bescheiden in der Ferne gestanden, hatte sich abgewandt; er blickte mit großen, starren Augen in das Abendgold.
Und das Abendgold verglomm über Feldern und Wäldern und über dem Friedhof zu Rammin, auf dem sie so eben den Ahnen zu seinen Kindern und Kindeskindern gebettet hatten. Es war nur eine kleine, sehr kleine Gemeinde gewesen, die um das Grab gestanden, als man den Sarg hinabgesenkt, und sie hatte eines Priesters nicht bedurft, die Stätte zu weihen, die ihnen fortan heilig war. Dann hatte Frau Wollnow Cäcilie umarmt und ihr in’s Ohr geflüstert: „laß Dich nicht durch eine Philisterseele, die Euch begegnet, aus der Fassung bringen;“ und Cäcilie hatte ihr geantwortet: „sei unbesorgt; ich weiß, was ich thue.“ Und dann hatte Ottilie Gretchen geküßt, und der Fürst und Herr Wollnow hatten mit wenigen herzlichen Worten von Cäcilie Abschied genommen; und das leichte Wägelchen des Fürsten war nach Waldschloß, und die solide Equipage Wollnow’s auf dem Wege nach Prora davongerollt.
Auf dem andern Ende des Dorfes, wo der Weg nach Neuenfähr und weiter nach Sundin geht, hielt ein Reisewagen; und sie gingen jetzt durch das Dorf, Arm in Arm, still, und das Kind lief vor ihnen her und haschte nach den Schwalben, wenn sie allzudicht an ihm vorüberschwebten.
Sonst hatten die Schwalben freie Bahn. Hinauf, hinab zogen sie pfeilschnellen Fluges, jetzt an der Erde hin, jetzt sich hebend in anmuthigen Bogen, gerade aus, im Zickzack, zirpend, zwitschernd, unermüdlich die langen Schwingen regend.
Auch für sie war es wohl der letzte Abend, und morgen waren sie fortgezogen nach Süden, und kamen erst wieder mit dem Frühling.
Gotthold dachte daran; und dann dachte er an jenen Abend, als er durch die leere Dorfstraße ging und der Gesang der Schwalben ihm Thränen der Wehmuth in die Augen trieb, und wie leer sie ihm gewesen war, die Heimath und die ganze schöne Welt, und wie ihm jetzt die ganze schöne Welt wie eine Heimath erschien; und er blickte in das dunkle Auge der geliebten Frau und drückte die warme schmale Hand des Kindes, das sein Kind war, und er wußte jetzt, „was die Schwalbe sang“.
Der Strenggläubige sieht in jedem Naturforscher der Neuzeit, insbesondere in jedem Thierkundigen, welcher ebenso spricht und schreibt, wie er denkt, einen berechtigten Anwärter auf das höllische Feuer, wenn nicht mehr. Er überlegt sich nicht oder vergißt, daß der Mensch seine Götter und Götzen nach seinem eigenen Bilde sich erträumte und gestaltete, daß der Weiße die edelste Kaukasiergestalt, der Neger einen schwarzen, der Mongole einen schiefäugigen Gott sich ausmalte, und hängt deshalb mit Inbrunst an dem Wahne der gerade ihm gewordenen Ebenbildlichkeit. Nur hierdurch finde ich Erklärung des Entsetzens,
[852] welches die Lehren Darwin’s in gewissen Kreisen hervorgerufen haben, wie der geradezu kindischen Furcht vor dem sogenannten „Materialismus“ und seinen Anhängern. Mit Ergötzen habe ich oft schon erfahren müssen, daß anscheinend vernünftige Leute in wahren Feuereifer geriethen, wenn Darwin’s Name genannt wurde, und daß sie mit verschwenderischem Aufwande von Gründen und Scheingründen sich bemühten, jede Gemeinschaft mit dem weltberühmten Forscher und seinen Jüngern auf das Bestimmteste von sich zu weisen, oder daß man bei Erwähnung Moleschott’s, Vogt’s und Büchner’s wenigstens mit Worten ein Kreuz schlug; mit Behagen habe ich die ängstliche Abwehr wahrgenommen, welche meine eigenen Worte hier und da hervorriefen, mit absonderlichem Vergnügen die tadelnden Beurtheilungen meines „Thierlebens“ in pfäffischen Zeitschriften jedes Schlages oder die meist namenlosen Briefe gelesen, in denen ich zur Umkehr, Buße und Besserung ermahnt wurde.
Und dies Alles weshalb? Weil wir „Darwinisten“ und „Materialisten“ gemäß unserer Ueberzeugung uns dahin aussprechen müssen, daß der Mensch nichts weniger als ein Halbgott, sondern eben nur ein Säugethier ist, welches nach dem heutigen Stande der Wissenschaft, nach den eingehendsten und gewissenhaftesten Untersuchungen, größere Verwandtschaft mit den höchststehenden Affen bekundet als diese mit einigen, denen wir die niedrigste Stellung anweisen, daß folglich zwischen Mensch und Affe nicht einmal die Grenze einer Thierordnung, sondern höchstens die einer Thierfamilie aufrecht erhalten werden darf. In solcher Erkenntniß erblickt man eine mindestens ebenso ruchlose Ketzerei wie in der, welche das Unfehlbarkeitsdogma in Frage stellt, und gebehrdet sich, als ob Darwinismus und Materialismus jede sittliche Anschauung vernichten, jedes edlere Streben der Menschheit in den Staub herabziehen müßten. Gründe für derartige Vorurtheile weiß man allerdings nicht vorzubringen, scheut sich jedoch nicht, die überzeugende Kraft und den tiefernsten Gehalt der Darwin’schen Lehren zu verlästern oder durch plumpe Späße in das Lächerliche zu ziehen, auch wenn man vielleicht niemals in der Lage gewesen ist, Menschen und Affen in allen Abstufungen, Arten und Spielarten zu vergleichen.
Solche Vergleichung ergiebt zwar keineswegs die Gewißheit einer unmittelbaren Abstammung des Menschen von einem uns bekannten Affen, wohl aber verleiht sie dem Naturforscher unbestreitbar die Berechtigung, dem Menschen seinen ihm in der Thierreihe gebührende Platz anzuweisen. „Wenn auch“, sagt Victor Carus klar, kurz und bündig, „die geistige Entwickelung des Menschen denselben hoch über alle Affen erhebt, so wäre diese doch nicht möglich ohne eine besondere Organisation. Diese aber weist ihn unwiderleglich in die Nähe der übrigen Primaten oder Affen. Statt sich daher ausschließlich mit der geistigen Fortbildung des Menschen zu beschäftigen, hat die Naturgeschichte schön längst begonnen, bei Beurtheilung der körperlichen Grundlage jener denselben Maßstab anzulegen wie bei Erforschung anderer Wesen der belebten Natur. Die von allen Gegnern Darwin’s absichtlich verzerrte, um nicht zu sagen verfälschte Annahme einer möglichen Abstammung des Menschen von einem affenähnlichen Thiere oder richtiger seiner allmählichen Entwickelung und Fortbildung aus einem affenähnlichen Zustande zu dem, was er gegenwärtig ist, kommt bei Bestimmung seiner Stellung in der Thierwelt erst in zweiter Reihe in Betracht; denn in Bezug auf den Anschluß des Menschen an das Thierreich läßt sich weder irgend eine bestimmte, jetzt lebende Thierform als diejenige bezeichnen, aus welcher der Mensch hervorgegangen ist, noch ist die Frage überhaupt der Entscheidung nahe.“ Sie deshalb als unlösbar zu betrachten und abzustehen von Versuchen, der Lösung sie näher zu bringen, würde von jedem Forscher als eine Sünde gegen die Wissenschaft angesehen werden. Etwas Entsittlichendes, Zersetzendes und wie man sich sonst ausgedrückt hat, kann kein Vernünftiger in solchen Bestrebungen finden; denn ebenso berechtigt, wie die Beklemmungen der Menschen bezüglich ihres endlichen und unendlichen Seins, ist das Suchen nach Erkenntniß ihres Ursprunges jedenfalls. Und was den sittlichen Gehalt des Darwinismus anlangt, so meinen wir, daß es keine mehr erhabene und veredelnde Anschauung geben kann als diejenige, welche im Sein und Walten der Natur nur eine ununterbrochene, unaufhaltsame Entwickelung und Weiterbildung vom Niedrigen zum Höheren sieht, eine Fortentwickelung, welcher sich der Mensch ebenso wenig entziehen kann wie jedes andere lebende oder belebte Wesen. Wir Materialisten blicken trostvoll auf unsere Zukunft, weil wir nicht vom Halbgott zum Vieh hernieder, sondern vom Affen zum Menschen emporsehen.
„Was in aller Welt aber,“ ruft der mir wohlgeneigte Leser aus, „hat eine derartige Auseinandersetzung von Mensch und Affe, Darwinismus und Materialismus, Moral, Weiterentwickelung und Fortschritt mit dem prächtigen Bilde zu thun, welches ich vor mir habe? Ich will über die dargestellten Thiere, nicht aber über Darwin und seine Anhänger sowie deren Anschauungen und Ziele unterrichtet sein!“
Bitte, Verehrtester, erwidere ich, legen Sie das Blatt noch nicht unwillig aus der Hand. Die auf Mützel’s Bilde trefflich und lebenstreu wiedergegebenen, gegenwärtig im Berliner Aquarium lebenden Löwenäffchen (Hapale Rosalia) haben allerdings mit all dem zu thun. Gerade sie gehören zu einer Gruppe der Handthiere, für welche das oben Gesagte Gültigkeit hat; denn sie unterscheiden sich leiblich und geistig mehr von den „Menschenaffen“, zu denen wir Gorilla, Schimpanse, Orangutan und die mehrere Arten umfassenden Gibbons oder Langarmaffen rechnen, als diese sich von den Menschen, dienen also zum Maßstabe für die Bestimmung der Zusammengehörigkeit von Mensch und Affe, da sie erkennen lassen, wie erheblich die Verschiedenheit der einzelnen Familien und Sippen innerhalb der einen Ordnung sein kann.
Die Krallenaffen, zu deren ausgezeichneten Vertretern unsere Löwenäffchen gehören, bilden eine besondere Familie der Affen. Ausnahmslos klein und schwächlich gebaut, unterscheiden sie sich von ihren Ordnungsverwandten wesentlich durch ihr Gebiß und die Beschaffenheit ihrer Nägel. Ersteres besteht zwar aus ebensoviel Zähnen wie das des Menschen und der Altweltsaffen: die Zähne sind jedoch anders geordnet und auch anders gestaltet, nämlich spitzig und die Backenzähne spitzhöckerig, woraus man schon im Voraus auf eine andere Nahrung, als die Mehrzahl der Affen sie zu wählen pflegt, schließen darf; die Nägel sind mit Ausnahme des einen, welcher die Daumenzehen bekleidet, Krallen-, nicht aber Plattnägel, welche weniger zum Ergreifen als zum Einhäkeln beim Klettern dienen. Mit der Benagelung der Finger steht die verhältnißmäßige Unbeweglichkeit der Hand im Einklange: der Daumen kann den übrigen Fingern nur in beschränktem Maße gegenübergestellt werden, und die Hand sinkt dadurch fast zur Pfote herab. Sieht man vom Gebiß ab und behält man zunächst Gestalt und Bewegung im Auge, so kann man sich zu der Meinung hinneigen, daß sie Mittelglieder zwischen Affen und Eichhorn bilden, und wenn man sonst seiner Einbildungskraft nicht Zügel anlegen will, mag man sie als Thiere bezeichnen, welche aus Eichhörnchen zu Affen geworden sind. Einen solchen Aufschwung darf man ihnen nun wohl nicht zusprechen, jedenfalls aber sagen, daß sie die am wenigsten entwickelten Affen und somit unsere entferntesten Verwandten, nicht unsere Vettern, sondern höchstens unsere Andergeschwisterkinder darstellen.
Um zunächst einige Worte über ihr Freileben zu sagen, will ich bemerken, daß sie sammt und sonders in Süd- und Mittelamerika heimisch sind, in den Urwaldungen der Ost- und Westhälfte des Festlandes sich finden, bis Mexico nach Norden herab vorkommen, in sehr vielen Arten auftreten, welche meist einen beschränkten, nicht selten durch einen Fluß begrenzten Verbreitungskreis bewohnen, und in allen wesentlichen Eigenthümlichkeiten ihres Gebahrens, ihrer Sitten und Gewohnheiten unter einander übereinstimmen. Sie leben stets in Gesellschaften, halten sich ausschließlich auf Bäumen auf, klettern behend in deren Gezweige umher, ziehen gesellschaftlich von einem Orte zum anderen, des Nachts wahrscheinlich in Höhlungen sich verbergend, bei Tage unter oft wiederholtem, gemeinschaftlich ausgestoßenem Geschrei ihrer Nahrung nachgehend, nähren sich von allerlei Früchten, Baumknospen, Blättern und Kerbthieren, plündern wie unsere mit Unrecht verhätschelten Eichhörnchen unbarmherzig Nester aus, sind überhaupt verhältnißmäßig tüchtigere Räuber als alle übrigen Affen. Wie ihre Verwandten nicht eigentlich an eine bestimmte Zeit gebunden, bringen sie in jedem Monate des Jahres Junge zur Welt, gewöhnlich nur eins, manchmal zwei oder selbst drei, tragen diese mehrere Wochen lang mit sich umher und behandeln sie zärtlich, obschon bei weitem nicht mit solcher Innigkeit und [853] Hingebung wie andere Affen die ihrigen. Vielfach verfolgt von Adlern und vierfüßigen Räubern, bedroht auch von indianischen und weißen Jägern, welche Fleisch und Fell verwerthen, führen sie ein ununterbrochen gefährdetes Leben, kommen jedoch trotzdem noch überall und selbst in der Nähe bevölkerter Ortschaften vor, – Beweis genug, daß sie sich stark vermehren und allerorten schützende Schlupfwinkel finden. Ihres hübschen Aeußeren wegen hält man sie gern in Gefangenschaft, bezahlt auch drüben wie bei uns ziemlich hohe Preise für sie, für ein Pärchen Löwenäffchen z. B. gegen anderthalbhundert Thaler, selten weniger, oft mehr.
Als unsere entferntesten Verwandten, als die am tiefsten stehenden Affen bezeichnete ich sie, und die Gerechtigkeit verlangt, daß ich eine ihnen so wenig günstige Behauptung begründe. Das Affengepräge an ihnen läßt sich allerdings weder verkennen, noch in Abrede stellen, ist aber nicht zu voller Geltung gelangt. Sie besitzen weder die überlegte und gesicherte Beweglichkeit des höher stehenden Affen, noch dessen Begabungen, höchstens dessen Leidenschaften. Ihr Klettern ist kein selbstbewußtes Beherrschen des Gezweiges mehr, wie wir es bei den verschiedensten Baumaffenarten beobachten, vielmehr eher ein Baum- oder Astrutschen, wie es Eichhörnchen und andere Krallenkletterthiere ausüben. Sie klettern nicht wie die Menschenaffen nach Art eines baumbesteigenden Knaben, gehen nicht wie Stummel- und Schlankaffen oder Meerkatzen spazieren auf den Baumästen, werfen sich nicht ohne Besorgniß von einem Aste zum anderen, gleichviel ob letzterer breche und im Fallen ein neuer gesucht und ergriffen werden müsse, benutzen auch ihren Schwanz nicht als Greifwerkzeug wie viele ihrer Heimathgenossen, sondern rennen, mit ihren Krallennägeln sich an- und einklammernd, einfach an den Stämmen der Bäume empor oder auf deren Aesten dahin, springen zwar manchmal ziemlich weit, immer aber mit großer Vorsicht, ersichtlich und nicht ganz mit Unrecht fürchtend, das gesteckte, Ziel zu verfehlen und zum Boden herabzufallen. Als ungeschickt, täppisch, unbehende darf man sie übrigens nicht bezeichnen: es fehlt ihnen nur die Freiheit aller Bewegungen und Stellungen, wie sie die übrigen Affen bemerken lassen, die Vielseitigkeit der Kletterkünste, welche diesen in so hohem Maße eigen ist. Immer und immer wieder erinnern sie an das Eichhorn, nicht allein im Laufen, Klettern und Springen, sondern auch bezüglich der Haltung ihres Leibes, durch die ihnen eigene Gewohnheit, sich platt auf die Aeste zu legen oder zu drücken, wegen ihres ängstlich dummen Begaffens jedes fremdartigen Wesens und hinsichtlich anderer Eigenheiten mehr.
Die Aehnlichkeit zwischen ihnen und den Eichhörnchen tritt noch schärfer hervor, wenn man nicht allein ihre leiblichen Begabungen und gewohnheitsmäßigen Sitten, sondern auch ihre geistige Befähigung in Betracht zieht. Sie sind geistig ebenso viel Nager wie Affe. Mit beiden haben sie Reiz- und Erregbarkeit gemein, erheben sich aber wenig über die mit Recht verstandesarm genannten Nager. Auch ihr Geist ist lebhaft, ermangelt aber der Bieg- und Schmiegsamkeit höherer Affen. Fast will es scheinen, als ob ihre Gedanken niemals eigentlich zur Klarheit gelangten, und sie nicht recht wüßten, was sie wollten. Der höher entwickelte Affe ist geistig mehr oder weniger Abbild, mindestens Zerrbild des Menschen und hat Eigenheit: der Krallenaffe erinnert nur durch die Gesichtsbildung an seine Verwandten, und sein Eigenwesen tritt wenig hervor; bei jenem verkehrt man mit dem einzelnen, welcher sich, je nach den Umständen, nach Oertlichkeit und besonderen Verhältnissen, Umgang mit anderen Geschöpfen und dergleichen, oft wesentlich von seinen Artgenossen unterscheidet: diese sind sich, wie leiblich, auch geistig in hohem Grade ähnlich; einer handelt wie der andere: nicht einmal die Verschiedenheit der Art bedingt in dem Wesen derselben einen merklichen Unterschied. Der Affe im eigentlichen Sinne des Wortes ist entschieden selbstbewußt, klug, überlegsam, gedanken- und erfindungsreich, schlau, listig, witzig, oft boshaft und selbst etwas heimtückisch, aber auch muthig, anhänglich gegen Seinesgleichen oder über ihm stehende Wesen, hülfsbereit, barmherzig, sogar aufopferungsfähig; der Krallenaffe ängstlich, furchtsam, mißtrauisch, verschlossen, kleinlich und vergeßlich. Jener schließt sich dem älteren, verständigeren, erfahreneren seiner Art oder einem Verwandten, beziehentlich dem Menschen rückhaltslos an, läßt sich leiten, bemuttern, unterrichten, erziehen, fortbilden, erkennt ebenso dankbar empfangene Wohlthaten an, wie er ihm widerfahrene Unbill nachträgt und gelegentlich zu rächen sucht: dieser sieht in keinem anderen Geschöpfe einen Rathgeber, Führer und Beschützer, gewöhnt sich an ihm zu Theil werdende Freundlichkeit, wie sich ein Eichhorn, eine Ratte solche gefallen läßt, ohne deshalb Dankbarkeit an den Tag zu legen oder auch nur Vertrauen zu gewinnen. Man nennt ihn zahm, wenn er nicht mehr nach der ihm schmeichelnden Hand zu beißen droht, seinem Pfleger nicht mehr Grimassen schneidet, in denen sich ebensoviel Furcht wie Prahlsucht ausdrückt, wenn er sich auf den Arm nehmen, streicheln und sonstwie liebkosen läßt, ohne mit zitternden Lauten aufzuschreien; von einer Hingabe an seinen Wohlthäter, einem Sichanschmiegen oder auch nur Entgegenkommen bemerkt man nichts. Er läßt sich vielleicht zu diesem oder jenem abrichten, aber nicht lehren, erlangt kaum Verständniß für Worte oder Befehle, zeigt sich ebensowenig empfänglich für Belehrungen wie für Strafe, ist daher weder bildsam noch lernbegierig. Anscheinend seiner Schwäche und Hülflosigkeit sich bewußt, sieht er in jedem anderen, ihm stärker dünkenden Geschöpfe einen fürchterlichen Feind, dem er zunächst zu entfliehen, kaum zu widerstehen trachtet. Diese ungemessene Furchtsamkeit bestimmt alle hervorragenden Züge seines Wesens: die Scheu, welche er selbst dem zärtlichsten Pfleger gegenüber selten ablegt, das Mißtrauen, mit welchem er jede Handlung desselben überwacht und deutet, die uns oft als Bosheit erscheinende Abwehr, zu der er sich zuweilen, meist in durchaus ungerechtfertigter Weise, aufrafft. Er besitzt alle Eigenschaften eines verächtlichen Feiglings: die klägliche Stimme, welche uns wie der Ausdruck ewiger Unzufriedenheit mit seinem Schicksale vorkommen will, die ersichtliche Unfähigkeit, richtiger vielleicht Unwilligkeit, in Unvermeidliches sich zu fügen, die jammerhafte Hinnahme aller Ereignisse, die krankhafte Sucht, jede Handlung eines anderen Geschöpfes auf sich zu beziehen etc., ist mit einem Worte ein Heuler der widerlichsten Art. Der Kapuzineraffe schaut mit seinem verwetterten oder doch gefurchten Mönchsgesicht ebenfalls nicht sonderlich fröhlich in die Weite und heult, wenn auch nicht über die Sündhaftigkeit der Welt wie sein Nach- oder Ebenbild, so doch zum Zeitvertreibe, ist aber bei all dem ein munterer, heiterer Gesell, welcher, so lange er nicht friert und hinlänglich zu essen hat, unverkennbar Humor bekundet: der Krallenaffe hat von Humor gar keine Ahnung, weil er selbst keine Spur davon besitzt, geht überhaupt niemals auf Scherze ein, wie jeder andere Affe thut. Geselligkeit ist ihm nicht gänzlich abzusprechen; er sucht sie aber nur im Umgange mit Seinesgleichen, nicht mit anderen Thieren; Hülfsbereitschaft zeigt, Mildthätigkeit übt er einzig und allein an seinen eigenen, nicht an fremden Jungen: die von uns oft bespöttelte und so rühmenswerthe Bemutterungssucht und „Affenliebe“ seiner Verwandtschaft, welche sich an jedem jungen hülfsbedürftigen Wesen bethätigt, scheint ihm fremd zu sein.
Niedlich aber sind sie trotz alledem, diese Krallenaffen; niedlich insbesondere erscheinen sie Frauen und Kindern oder Denen, welche in den höherstehenden Affen immer nur das Zerrbild und nicht eine Vorbildungsstufe des Menschen erblicken können. Ohne daß man es vielleicht weiß, vergleicht man jene mit Nagethieren und denkt daher zunächst an diese. Dem Nagerleibe verleihen das Affengesicht mit den lebhaft blickenden Augen und die Pfotenhände etwas uns Ansprechendes und Bestechendes; auch erfreut man sich wohl an der zwar oft grellbunten, meist aber doch nicht unangenehm in’s Auge fallenden Färbung des feinen Pelzes, an den raschen Bewegungen und selbst an der bei den meisten Arten förmlich flötenden, im Maule des Säugethieres geradezu einzigen Stimme, welche mehr noch als die einer singenden Maus an das Gezwitscher eines Vogels erinnert. Die unliebsamen Eigenschaften der Thiere, ihre geringen Verstandeskräfte, ihr uns auf die Dauer unbefriedigendes Gebahren lernt man erst nach eingehenderer Bekanntschaft mit ihnen, nach schärferer Beobachtung ihres Wesens, ihrer Sitten und Gewohnheiten kennen, hält sie deshalb allgemein für weit klüger, anmuthiger und liebenswürdiger, als sie sind, und erklärt sie für allerliebste Geschöpfe in jeder Hinsicht. Am Käfige unserer Löwenäffchen verweilen fast Alle, welche das Berliner Aquarium besuchen, und zumal alle Frauen länger als an jedem andern Behälter, und nur freundliche, wohlwollende Worte werden bei Besichtigung der Thierchen laut, während dieselben Frauen angesichts unseres vortrefflichen, gutmüthigen, harmlosen, in Scherz und Spiel, namentlich in wohlüberlegten [854] Turnkünsten sich gefallenden Schimpanse meist, wenn nicht Widerwillen, so doch kein Wohlwollen bekunden. Augenblicklich aber kehrt sich das Verhältniß um, wenn der Futtermeister oder einer der Wärter sich mit diesem und jenem Affen beschäftigt, sowie also der Mensch mit dem einen oder dem anderen Umgang pflegt.
Gegenüber dem Menschenaffen, welcher mit Bewußtsein und Vergnügen mit Menschen sich unterhält, in dessen Umgange sichtlich erhoben sich fühlt, nach Art eines munteren und etwas muthwilligen oder auch eines verzogenen, verhätschelten Kindes sich benimmt, bald verständig und folgsam, bald eigensinnig und unfolgsam sich zeigt und Kindereien aller Art in der Weise eines übermüthigen Knaben verübt, sinkt das ewig sich gleich bleibende, störrische, furchtsame, mit dem Menschen niemals ein wirkliches Freundschaftsverhältniß eingehende Löwenäffchen trotz seiner zierlichen Gestalt, schmückenden Behaarung und Färbung, Lebhaftigkeit und Beweglichkeit zu einem wenig bedeutenden Wesen herab; es verthiert gleichsam vor dem prüfenden Auge, während der Schimpanse sich vermenschlicht. Einen Vergleich vertragen die Beiden nicht, es sei denn, daß man sie nehmen wolle als das, was sie sind: den einen als Menschen-, den anderen als Eichhorn-Affen. In jenem sehen wir unseren rechtmäßigen Verwandten; bei diesem denken wir kaum an einen Zusammenhang zwischen ihm und uns.
Diese und ähnliche Gedanken fasse ich, vorurtheilsfreien Besuchern des Aquariums gegenüber, angesichts beider Affen zuweilen in Worte, und noch niemals ist es mir begegnet, daß ich bei solchen Leuten auf Widerspruch gestoßen wäre: so überzeugend wirkt die Vergleichung beider Affen. Blind sein Wollende suche ich nicht zu bekehren.
„Ich hätte nicht erwartet,“ sagte im vergangenen Sommer ingrimmig spottend, ein Herr mit weißer Halsbinde und ausgeprägtem Erbsündergesichte, nachdem er einem kleinen Kreise von Herren und Damen vor dem Schimpansekäfige sich zugesellt hatte, „hier im Aquarium für ein so niedriges Eintrittsgeld auch noch einen philosophischen Vortrag über unsere Abstammung von oder unsere Vetterschaft mit diesem holden Wesen, dem Schimpanse, anhören zu können; denn ich habe nicht gewußt, daß Darwinismus und Materialismus selbst hier reisepredigen.“
„Mein nach Gebühr zu verehrender Herr,“ erwiderte ich ihm, „wir haben Jahrhunderte lang nicht allein Gutes, sondern auch offenbaren Widersinn, gehalt- und geistlose Phantasien über Ursprung und Ende des Menschen, kindische Sagen und Märchen anhören und widerspruchslos hinnehmen müssen: warum sollten nicht auch Sie einen Beitrag zu der geistvollsten und überzeugendsten Annahme des bedeutsamsten aller jetzt lebenden Naturforscher mit einer diesem Reformator der Thierkunde gebührenden Achtung anhören können?!“
Was hätte ich dem Manne auch sonst noch sagen sollen? Denen, welche nicht erkennen wollen, bleiben Darwin’s Werke mit sieben Siegeln verschlossene Bücher.
Als ich Mitte Januar 1871 auf meiner Fahrt mit einem deutschen Sanitätszuge nach Frankreich von Brumath aus einen Abstecher zu Schlitten nach Straßburg machte, fiel mir, schon im Bereiche der Laufgräben und Verwüstungen zur Linken von der Straße gleich bei Schiltigheim, ein allein unversehrt gebliebenes großes Gebäude mit Kirchlein auf. Mein Rosselenker, ein fünfzehnjähriges elsässer Bürschchen, erklärte das für ein Waisenhaus und setzte mit besonderer Betonung hinzu: „Da druff habbe se nit schisse därfe.“
Hätte ich damals gewußt, durch welch ein Mirakel nur kurze Zeit vorher dieses Haus verherrlicht ward, so würde ich mir es wohl zweimal angesehen haben, denn in der That trug diese Stätte bei, ein neues Zeugniß dafür zu liefern, wie viel Unglaubliches im Glauben noch heutzutage geleistet werden kann.
Zu Illfurth, einem katholischen Pfarrdorfe des Bisthums Straßburg, im ehemaligen Arrondissement Altkirch des französischen Departements Oberrhein – jetzt im kaiserlich deutschen Reichslande Elsaß – ist ein „unbemittelt, aber christliches und frommes“ Elternpaar Burner, das sich durch Handarbeit ernährt, in Besitz zweier Knaben, von welchen der ältere, Theobald 1854, der jüngere, Joseph, zwei Jahre später geboren wurde. Im Spätherbst 1864 fingen Beide an zu kränkeln: „ein mehrartiges Fieber äußerte sich.“ – Aerzte konnten nicht helfen. Wie aber den Knaben dennoch geholfen wurde, offenbart uns der „Treue Bericht“ von dem Herrn Pfarrer zu Illfurth Karl Brey, veröffentlicht „mit Erlaubniß des Hochw. Ordinariats von Straßburg“, dem ich das Folgende mit größter Gewissenhaftigkeit nacherzähle. Nach diesem Berichte wurde am St. Katharinentag (25. November) 1865 Theobald, auf dem Rücken liegend, plötzlich schnell wie ein Rad herumgedreht; dann warfen beide Knaben, „wie von einer unsichtbaren Gewalt genöthigt“, sich schreiend auf ein Bett, schlugen mit Händen und Füßen auf dasselbe, daß starke Bretter aus der Bettstatt fielen, und setzten dieses Dreschen, wie sie es selbst nannten, mehrere Tage oft halbe Stunden lang und nahe an hundert Male fort, und zwar ohne davon zu ermüden, denn nach demselben gingen sie stets lachend und scherzend wieder zu ihren anderen Geschwistern. Bald stellten sich auch convulsivische Bewegungen und Krämpfe ein. Dies Alles geschah natürlich im Beisein vieler Zeugen, von denen Jeder irgend ein bewährtes Heilmittel anzurathen wußte. Indeß nur Einer der Umstehenden traf das Rechte: er rieth, den Leidenden ein mit etwas Gesegnetem gemischtes Getränke zu geben. Und siehe, kaum hatte Theobald davon genossen, so erstarrte er und blieb fast eine Stunde lang bewegungslos wie ein Todter liegen.
Dieser gesegnete Trank war es offenbar, der das Unheilige in den Kindern in Aufruhr gebracht hatte, denn nun erfolgte, wie der Herr Pfarrer sich ausdrückt, „eine lange Reihe der verschiedenartigsten, wunderlichsten Phänomene oder Erscheinungen, welche man in die Fabelwelt verweisen möchte, gäbe es nicht Hunderte von bewährtesten Augen- und Ohrenzeugen, welche für deren Wahrheit bürgen.“ Die Beschreibung aller dieser Vorkommnisse würde, wie der Herr Pfarrer ebenfalls versichert, mehrere Bände füllen; um dies zu vermeiden, wollen wir uns mit einigen der merkwürdigsten Vorfälle begnügen.
Es geschah u. A. Folgendes. Wenn die Knaben auf ganz schweren, hölzernen Stühlen saßen, wurden sie in die Höhe gehoben und die Stühle in eine, die Knaben in die andere Ecke geschleudert. Bald überkam die Kinder eine Art von Wolfshunger, und zu gleicher Zeit fühlten sie ein Stechen am ganzen Leib. Und da sah nun Jedermann, wie ihnen schmutzige Federn und Seegras aus den Ohren und anderen Körpertheilen „gleichsam“ hervorwuchsen. Es half nichts, die Kinder umzukleiden, Hemd und Hosen waren doch gleich wieder voll dieses Unraths.
Das dauerte wochenlang und die Knaben waren endlich so geschwächt, daß sie das Bett nicht mehr verlassen konnten. Convulsionen und Magenkrämpfe stellten sich ein, ebenso Geschwulst des Unterleibes und Gefühl, als ob eine Kugel oder etwas Lebendiges im Magen herumliefe, und dabei waren die Beine „wie biegsame Ruthen zusammengewunden“, so daß kein Mensch sie auseinanderreißen konnte. Gegen diese Uebel mußte Etwas geschehen, und man griff, wie der Herr Pfarrer berichtet, nach einem einfachen Mittel: man brachte nämlich das heilige Kreuzzeichen und das Besprengen der Leidenden mit Weihwasser in Anwendung.
Abermals scheint die fromme Cur das Böse nur gereizt zu haben, denn wenn man jetzt den Knaben ein in Tuch eingenähtes Kreuz, eine geweihte Medaille oder das zu Ehren des heiligen Joseph besonders angefertigte St. Josephschnürchen noch so sorgsam und fest auf den Leib band, so riß es eine unsichtbare Macht doch hinweg und noch die Hemden dazu entzwei. Auch das Beten wurde den Knaben immer schwerer, „die Aussprache der heiligsten Namen Heiliger Geist, Jesus, Maria weckte in den Kleinen starke Convulsionen!“ Das Schlimmste waren die gespenstischen Erscheinungen, von welchen Tag und Nacht namentlich der ältere Knabe geplagt wurde; „ihm zeigte sich ein den Umstehenden unsichtbares, ungestaltes, aber gräuliches Wesen; es hatte einen Entenschnabel, bekrallte Hände und den Leib mit unsauberen Federn bedeckt.“ Wenn dieses Ungethüm über dem [855] Knaben schwebte und ihn zu würgen drohte, so riß er ihm mit beiden Händen Federn aus, die er dann an die Umstehenden vertheilte. Solche Teufelsfedern werden in vielen Familien als „Reliquien“ aufbewahrt. Wenn man sie verbrannte, stanken sie sehr; freilich stinken da andere Federn auch, aber doch wohl nicht so sehr, wie Teufelsfedern.
Die ganze Angelegenheit war endlich so ruchbar geworden, daß auch die Obrigkeit sich derselben annehmen konnte. Anfangs Februar 1868 ließ der Gemeindevorsteher (damals noch Maire) Nikot beide Knaben aus dem elterlichen Hause in das alte Schulgebäude bringen und sie, getrennt, der Aufsicht zweier Krankenschwestern der Stadt Mühlhausen, Schwester Methula und Schwester Severa, übergeben. Nachdem beide vergeblich einen Betrug in den Vorgängen zu erspähen gesucht, ließ man Aerzte von Mühlhausen und Altkirch zu den Knaben kommen. Da sah man nun, erzählt der Herr Pfarrer, daß ein Arzt, welcher offenbar von der wahren Erkenntniß der Krankheit am weitesten abgewichen war, denn er wollte sie als Hysterie, Veitstanz, Schlafwandeln etc. erklären, von den Knaben deßhalb höhnisch belobt wurde. Dagegen fand der Herr Pfarrer auch „einen unter jeder Rücksicht ausgezeichnetsten Arzt“ dabei, denn derselbe „stellte die Möglichkeit der Umsessenheit der Knaben nicht in Abrede.“ Jedenfalls hat der Herr Pfarrer darin ganz Recht, denn was soll denn aus Besessenheit und Teufel werden, wenn Niemand mehr an sie glauben will?
Glauben muß man aber an Besessenheit, sobald folgende wörtlich nach des Herrn Pfarrers Bericht mitgetheilte „unzweifelhafte Anzeichen“ derselben vorhanden sind: „1) Kenntniß fremder Sprachen, die nie gelernt worden sind; 2) wissenschaftliche Einsichten und auffallende Fertigkeit, über wissenschaftliche Sachen sich auszusprechen von Seite solcher Personen, die nie mit dergleichen sich abgegeben; 3) das Aufdecken und Wissen geheimer oder solcher Dinge, die an entfernten Orten vorgehen, namentlich das Eindringen in die Gedankenwelt Anderer; 4) Kraftäußerungen, welche über alle menschlichen und natürlichen Kräfte offenbar hinausgehen.“
Von den genannten Anzeichen machten beide Knaben den beiden Krankenschwestern gegenüber bald den empfindlichsten Gebrauch: sie entdeckten ihnen unter Anderem, offenbar zu deren entsetzlichem Schrecken, „ihre geheimsten Sachen“. Eben so wenig schonten sie neugierige Besucher, auch diesen „entdeckten sie frei gewisse geheime, oft schwere Fehler, so daß sie tief beschämt, blaß und wie vom Blitze getroffen, von dannen zogen.“ Ferner wußten die Knaben nicht blos zu unterscheiden, ob man ihnen etwas Geweihtes oder Ungeweihtes darbot, sondern waren mit allen Vorkommnissen nicht blos Illfurths, sondern entfernterer Ortschaften so vertraut, daß „Mancher und Manche sich ein seltenes Vergnügen daraus machten, wenn es ihnen gegönnt war, den kleinen, interessanten Erzählern aufzulauschen.“ Auch den Tod zweier Personen sagte Theobald richtig voraus; beide Knaben ertheilten auf Fragen über geschichtliche Thaten Auskunft, ebenso über Familienverhältnisse auf zwanzig und vierzig Jahre zurück, und zwar in verschiedenen ihnen bisher fremd gewesenen Sprachen; namentlich drückte Theobald sich ganz gut lateinisch aus, wie der Herr Pfarrer versichert, ja, er gab sogar häufig auf lateinische Fragen französische Antworten. Und dabei vermochten es beide Knaben, wie Hähne zu krähen, wie Hunde zu heulen und wie wilde Thiere zu brüllen, und zwar dies Alles – „wie (auch) das Reden, bei fast geschlossenem Munde, ohne Bewegung der Lippen.“
Zwei Vorkommnisse enthüllten endlich die Anwesenheit des Bösen auf das Klarste. Am dritten Fastensonntage nämlich hatte die fälschlich verbreitete Nachricht, daß an diesem Tage die Knaben vom Teufel befreit werden sollten, einige hundert Fremde nach Illfurth gelockt, – und am Ende desselben Tags jubelte Theobald hoch auf, „weil durch diesen Besuch gar Viele den Gottesdienst versäumt hätten!“ War das nicht eine echt teufelische Freude? Und – „als kurz darauf die Kinder sich zum Empfange des heiligen Bußsacraments vorbereiteten, vernahmen die Anwesenden eine düstere, aus Theobald kommende Stimme sprechend: ‚Dem Hündlein (Kinde) will ich das Gehör nehmen, damit er (!) nicht mehr durch das Gitter blasen (beichten) könne, und er wird gehörlos bleiben bis zur Stunde seiner Befreiung.‘“
Und so geschah es. Beide Knaben wurden taub, und Theobald blieb es bis zu der vom Teufel selbst ganz offenherzig angegebenen Frist; Joseph aber erhielt sein Gehör schon vorher wieder, und zwar – wie er selbst sich ausdrückte – „auf das Verlangen der großen Frau“, das ist, der seligsten Jungfrau Maria.
Da die Mühlhäuser Krankenschwestern Methula und Severa den Knaben nicht helfen konnten, so kehrten beide Theile nach Hause zurück. Theobald’s aber erbarmten sich zwei Bürger von Illfurth, Herr Franz Joseph Brobeck und Herr Dominicus Tresch; sie unternahmen mit ihm im Sommer 1868 eine Wallfahrt nach Maria-Einsiedeln, und dort fanden sich endlich die rechten Helfer in der Noth: die hochwürdigen Patres Laurenz Hecht und vor Allem der Exorcist Nepomuk Buchmann. Letzterer gab das schriftliche Urtheil ab: „daß nicht unzweideutige Beweise wahrer Besessenheit wahrgenommen werden und daß der Herr Pfarrer von Illfurth sich bemühen solle, bei der bischöflichen Behörde zu Straßburg dahin zu wirken, sie wolle einen Exorcisten zur strengen Untersuchung und endlichen Erledigung dieser Angelegenheit ernennen.“
Der Herr Pfarrer ließ sich das nicht zweimal sagen. Welche außerordentliche Wichtigkeit er einer amtlichen Erklärung der bischöflichen Behörde über das Vorhandensein der Besessenheit eines Menschen etc. beimaß, möge unseren Lesern die Anmerkung[1] darthun. Dem Manne ward geholfen. Im August 1869 kam endlich der Tag, wo „der Hochwürdigste Herr Bischof von Straßburg für gut erachtete, den Theobald (sammt seiner Mutter) nach St. Karl, einer Waisen-Anstalt bei Schiltigheim, zu berufen. Die Schwestern derselben erhielten den Auftrag, den Knaben fünf Wochen lang Tag und Nacht in seinem Thun und Reden zu beobachten. Seine bischöfliche Gnaden ernannten zur allseitigen Prüfung desselben eine Commission, bestehend aus den hochwürdigen Herren Rapp, Generalvicar, Stumpf, Vorstand des Priesterseminars, Eicher, Vorstand der Jesuiten, sämmtlich von Straßburg. Alle sprachen sich einstimmig für das Bestehen einer wahren Besessenheit aus. Der Hochwürdigste Herr Bischof beauftragte nachher den hochwürdigen P. Souquat aus der Gesellschaft Jesu, die Beschwörungen vorzunehmen.“
Dies geschah in der Capelle jenes Waisenhauses bei Schiltigheim am vierten October 1869. Hauptzeugen und geistliche Beistände bei der heiligen Handlung waren: Erzpriester Spitz, Seminar-Superior Stumpf, Waisenhausanstaltsvorstand Hauser, Seminarist Schrantzer, Abbé und Professor der Sittenlehre am Straßburger Priesterseminar Rossé, die General- und Local-Oberin des Hauses und einige Schwestern. Wir nennen die Namen dieser Personen hier als Zeugen für die Wahrheit unserer Erzählung. Es kann ihnen das, von ihrem Standpunkte aus, nur lieb sein. Schämen werden sie sich schwerlich. – Die Beschwörung geschah genau nach der Vorschrift des römischen Rituals, das auch dafür einen besondern Artikel enthält. Die Procedur mußte zwei Mal vorgenommen werden, weil der Teufel das erste Mal nicht weichen wollte. Der Knabe wurde, wie Tags zuvor, in die Capelle geführt und vor dem Chor niedergelegt.
Hören wir nun den Bericht des geistlichen Vorstandes von St. Karl über das Weitere: „Der Leidende befand sich im nämlichen Zustande wie gestern; nur schwer konnte man ihn bemeistern, er schäumte vor Wuth. Diese Raserei war äußerst groß, besonders in gewissen feierlichen Augenblicken und namentlich als man auf dessen Haupt das Bildniß der unbefleckten Jungfrau, den Kopf der Schlange zertretend, legte. Allein diese Krisis war die letzte. Einige Augenblicke nachher blieb der Kranke ruhig, bewegungslos, einem tief schlafenden Menschen gleich; das Kreuzbild, welches man auf seine Brust gelegt, beibehaltend. Alles wurde still und die Anwesenden [856] beteten fort, bis man endlich den Knaben, schlafend, in jene Abtheilung des Hauses tragen ließ, wo die Priester, die Schwestern und die Mutter des Kindes sich versammelt hatten. Nach einer Viertelstunde erwachte er wie aus einem tiefen Schlafe, hörte ganz gut, er, der bei achtzehn Monate ganz taub war, antwortete mit einer großen Liebenswürdigkeit und verspürt in diesem Augenblicke keine Nachwehen mehr. Er erinnert sich nicht einmal dessen mehr, was sich mit ihm zugetragen hatte.“
Der Triumph der siegenden „heiligen Kirche“ war natürlich ein ebenso großer, als – gerechter, aber doch nur ein halber, so lange der unreine Geist noch in dem Knaben Joseph hauste. Die That dieser zweiten Vertreibung war, nach dem Willen des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Straßburg, unserm Herrn Pfarrer vorbehalten und er vollbrachte sie am siebenundzwanzigsten October 1869, und zwar „in einer alten, der lieben Mutter Gottes gewidmeten Kirche, die auf dem Gottesacker zu Illfurth steht.“ Dorthin wurde besagten Tages in aller Frühe, trotz heftigen Sträubens, der Knabe getragen. Die vorgeschriebenen Exorcismen begannen nach der heiligen Messe. Der Herr Pfarrer erzählt den merkwürdigen Verlauf so:
„Als die Beschwörung anhob, schrie der böse Geist: ‚Ich gehe nicht, ich werde nicht gehen!‘ Der Exorcist aber fuhr fort, und je mehr er dem Teufel zusetzte, desto hartnäckiger bewies sich dieser. Endlich nach einem heftigen zweistündigen Kampfe wurde Satans Macht gebrochen. Denn als er den Befehl vernahm, zu weichen im Namen der unbefleckten Jungfrau, so schrie er verzweiflungsvoll: ‚Jetzt ist’s denn mit mir aus; ich bin überwunden, ich ziehe fort.‘ Da auf sein Verlangen, in die Schweine, Gänse etc. fahren zu dürfen, ihm geantwortet wurde: ‚Nein, in den Abgrund der Hölle fährst Du!‘ knirschte er mit den Zähnen, wüthete bei einer Viertelstunde noch im Körper des Kleinen, der sich bäumte, krümmte wie ein zertretener Wurm. Man sah, wie der böse Geist ein Glied nach dem andern zu verlassen sich anstrengte; er konnte beinahe nicht aus seiner Beute sich herauswinden. Dieses gewaltsame Scheiden des Satans vom Leibe, den er so lange bewohnte, bot allen Gegenwärtigen einen erschütternden, herzbrechenden Anblick dar.“
Auch Joseph erwacht nach der Vertreibung des Teufels wie aus einem tiefen Schlaf und weiß natürlich von allem Vorgegangenen nichts. Um so merkwürdiger ist’s, daß er, wie der Herr Pfarrer erzählt, „sittlich ganz verwandelt“ neben ihm in die Kniee sinkt, um mit allen Anwesenden „dem dreieinigen Gott und der unbefleckten, stets makellosen Jungfrau Maria den innigsten Dank für den wunderbar errungenen Sieg über die Hölle zu bringen.“
Wer nun glaubt, daß mit dem Tedeum, das am folgenden Sonntag unter dem Geläute aller Glocken abgehalten wurde, die Verherrlichung dieser Teufelsaustreibung schloß, der irrt sich. Dieser Triumph der h. Kirche soll noch weiter ausgebeutet werden; dies spricht sich aus in dem Wunsch: „daß auch in andern Bisthümern bei ähnlichen Fällen ein Exorcist aufgestellt und überdies in den Bildungsanstalten der Priester die Lehre der heiligen katholischen Kirche von dem Einwirken böser Geister, von den kirchlichen Mitteln zur Zernichtung jeglichen teuflischen Einflusses gründlicher denn je vorgetragen werde“ – und gipfelt in dem Plane: in Illfurth zu Ehren der unbefleckten Empfängniß und ihres Triumphes über den höllischen Drachen eine aus Erz gegossene Bildsäule der Madonna zu errichten, welche durch ihre Größe und Schönheit den Vorübergehenden bis in die spätesten Zeiten die Macht und Erbarmung derselben in der Befreiungsgeschichte der beiden Knaben verkünden soll.
Das ist die Geschichte dieser jüngsten Teufelsbeschwörung im Bisthum Straßburg. Wir übergeben sie, wie sie ist, dem Nachdenken unserer Leser. Nur eine Bemerkung können wir nicht unterdrücken: Wir haben so viele, viele Jahre lang vom deutschen Rheinufer Erwin’s Wunderbau in Feindesland sehen müssen, – das war unser tiefster patriotischer Schmerz. Mit welchem Herzen soll aber der Deutsche heute zum Münster emporschauen, wenn er die ewig herrlichen Hallen von solchen Priesterhänden entweiht sieht! Straßburg ist erobert, – erobere der deutsche Geist nun auch sein Münster zurück!
Sind Sie, verehrte Freundin, einmal durch die breiten stolzen Straßen der Isarstadt gewandert, die wie ein aufgeschlagenes Buch der Kunstgeschichte vor uns liegen mit ihren hellenischen und gothischen Bauten, mit ihren Basiliken, Glyptotheken, Pinakotheken, Siegesthoren? Hier wird es uns so feierlich ernst zu Muthe; man sieht sich nach einem Professor um, der uns in aller Eile ein Collegium liest, indem er diese Bauwerke als erläuternde Illustrationen benutzt; man wundert sich, daß nicht jeder Münchner mit einer Zeichenmappe durch die Straßen wandert, und meint, man müsse lauter idealen Gesichtern mit griechischen Profilen begegnen und lauter Grazien, Musen und Madonnen, da eine solche künstlerische Atmosphäre doch nicht ohne Einfluß bleiben kann auf die Wesen, die in ihr athmen. Sie lächeln, verehrte Freundin? Sie sind gewiß in München gewesen und haben Unglück gehabt; Sie haben keine Gesichter mit akademischem Schnitt gesehen, sondern joviale Biergesichter; Sie haben die Straßen leer gefunden, wo die Prachtgebäude stehen, und ein Getümmel fröhlicher Menschen an den classischen Stätten, wo der kastalische Quell der Münchner, der edle Gerstensaft, strömt; Sie sind den Gestalten begegnet, die Sie aus den „Fliegenden Blättern“ kennen, der drallen Biermamsell, dem Falstaff in Civil und Uniform, dem oberbairischen Bauern mit den Frage- und Ausrufungszeichen im Gesicht, wenn er an den steinernen Wundern vorübergeht, dem Mönch, der diesen heidnischen Säulenordnungen keinen Blick schenkt.
Das sind Contraste, verehrte Frau, und Contraste sind ebenso lehrreich wie pikant. Es giebt ein doppeltes München, das München des Volks und das München des Königs; dort herrscht das Bier, hier herrscht die Kunst; beide berühren sich wohl, aber sie verschmelzen nicht miteinander.
Gleichwohl ist die bairische Hauptstadt eine schöne und stolze Stadt, und Niemand wird durch ihre Kunstgalerien wandern, ohne anregende und geistig befreiende Eindrücke zu erhalten. Sie kennen die Pinakothek und Glyptothek; doch Münchens Kunstschätze sind nicht mit den Staatssammlungen erschöpft; es giebt Privatgalerien, in denen sich Gemälde von höchstem Kunstwerth befinden.
Ich führe Sie zu einem deutschen Dichter. Es ist nicht Emanuel Geibel, der jetzt an den Ufern der Trave seine patriotische Harfe schlägt; es ist nicht Paul Heyse, der feine Novellist mit dem Rafaelskopf; es ist nicht Hermann Lingg, der historische Freskenmaler, der in neuester Zeit eine von mir nicht getheilte Vorliebe für die Schicksale der Vandalen an den Tag legt; noch weniger ist es Mirza Schaffy, der in einem stillen Thale Thüringens Buße thut für die kecke Fröhlichkeit seiner westöstlichen Maskerade. Vor allen Dingen aber verbannen Sie jeden Gedanken an Kotzebue’s armen Poeten und an eine Dachstube. Der Dichter, zu dem ich Sie führe, besitzt eine Gemäldegalerie, welche nicht blos einen hohen Kunstwerth, sondern auch einen hohen Geldwerth repräsentirt; ein armer Poet, der seine Dachstube mit Neu-Ruppin’schen Bilderbogen tapeziert, müßte hier in seines Nichts durchbohrendem Gefühle dastehn.
Ein freundlicher Herr empfängt uns, mit diplomatischen Formen, mit wohlwollendem Lächeln und geistreich leuchtenden Augen; er führt uns zu diesen Schätzen, er erläutert uns die Gemälde, auf welche manche königliche Galerie stolz zu sein ein volles Recht hätte. Da sind die genialen Oelgemälde von Genelli: der Raub der Europa, auf welchem Bilde der kühne Erfinder und Zeichner auch Herrschaft über das Colorit an den Tag legt; da ist Herkules und Omphale, da ist der Kampf zwischen Bacchus und Lykurgus, eine der vermessensten Compositionen kraftgenialischer Malerei; da sind Meisterstücke von Schwind, kleine Gemälde von geistreicher Erfindung und stimmungsvoller Haltung, mit dem [857] Pinsel ausgeführte lyrische Gedichte von einer mächtig hervorquellenden Genialität, die selbst das anscheinend Seltsame, den verwegenen Einfall, harmonisch in das ganze Kunstwerk einzuordnen weiß. Da sind Gemälde von Anselm Feuerbach, wie der „Fischerknabe“, Bilder von süßverlockendem Reiz und magischem Colorit; da sind prachtvolle Copien jener erhabenen Fresken des Michel Angelo, welche in der Sixtinischen Capelle uns zu hoch über den Häuptern schweben, als daß wir uns in das großartig Markige ihrer Darstellung mit dauerndem Genuß versenken könnten.
Unser freundlicher Cicerone aber ist Friedrich von Schack, der meisterhafte Uebersetzer des „Firdusi“, der Verfasser einer trefflichen Geschichte des spanischen Drama’s, ein Literaturkenner wie wenige, ein Kunstfreund und Kunstmäcen, der großen strebenden Talenten die Wege geebnet, einen Genelli der Noth des Lebens entrissen hat, und außerdem ein begabter Dichter.
Mag von unseren lyrischen Poeten Schiller’s Sentenz gelten, daß die Jugend schnell fertig ist mit dem Worte, mag die Mehrzahl derselben ihre Verslein auskriechen lassen, ehe sie flügge geworden sind, und sie, noch mit den Eierschalen behaftet, auf den Jahrmarkt der Literatur schicken – Friedrich von Schack gehört nicht zu diesen schnellfertigen Dichtern. Er hat sich als Literarhistoriker, als Uebersetzer einen Namen gemacht, ehe er seine eigenen Poesien dem verschwiegenen Pult entnahm und der Oeffentlichkeit übergab. Es geht in der That nichts über die Mittheilungslust junger Lyriker, und während Andere ihre Jugendsünden zu verschweigen lieben, plaudern diese sie mit Vorliebe in alle vier Winde aus. Wie ein Liebender den Empfindungen, von denen sein Herz voll ist, Luft zu machen sucht, so auch der junge Poet, und jeder Sterbliche, der ihm in den Weg kommt, wird das Opfer seiner Muse. Mein Freund Wilhelm Jordan, verehrte Frau, war als jugendlicher Dichter einer der gefährlichsten; er wegelagerte sogar, legte raubritterlich auf jeden empfänglichen oder unempfänglichen Schulfreund Beschlag auf offener Straße und schleppte ihn dann auf sein Zimmer, wo er ihn zum Genuß seiner neuesten poetischen Ergüsse verurtheilte. Was ein Dörnchen werden will, krümmt sich bei Zeiten. Jetzt hat Jordan sich für seine „Nibelungen“ diesseits und jenseits des Oceans die größten Auditorien zusammengetrommelt und der Ehren Fülle geerntet.
Wie viel Entsagung gehört also dazu, mit seinen Musenkindern Jahrzehnte lang allein zu bleiben und die ungeduldige Sehnsucht nach dem Licht der Oeffentlichkeit, dieselbe Sehnsucht, die eine nichtgehaltene Landtagsrede für einen ruhmbedürftigen Abgeordneten zu lebenslänglicher Qual macht, siegreich zu überwinden!
Erst im Jahre 1867 öffnete Friedrich von Schack den Käfig, der seine schwungkräftigen und melodischen Lieder gefangen hielt; es erschienen zuerst „Gedichte“, denen dann „Episoden“, poetische Erzählungen, die humoristische Dichtung „Durch alle Wetter“ und neuerdings „Lothar“, ein Gedicht in zehn Gesängen, folgten.
Friedrich von Schack ist kein Poet, der an der Scholle haftet, und auch seine Gedichte haben etwas Reiselustiges und tragen das Gepräge weiter Weltwanderungen. Der Dichter kennt den Süden Europas, Spanien und Italien; er kennt den Orient, Syrien und Aegypten. Daher erfreut uns in seinen Gedichten das lebendige feurige Colorit, das aber nirgends in die gluthrothe Manierirtheit einiger Landschaftsmaler ausartet, ebensowenig eine geistlose Panoramenmalerei durch bestechenden Farbenprunk zu heben sucht. Ueberall ist die Muse Schack’s gedankenreich. Wenn er uns den „Pic von Teneriffa“ mit einigen großartigen Zügen vor die Seele zaubert, so vergleicht er die furchtbaren Mächte der Tiefe mit den grausen Dämonen, die im Menschenherzen schlummern. „Die Jungfrau“ aber, die im Strahle der sinkenden Sonne schimmert, fragt er, ob sie mit Geistern anderer Welten sich Flammenzeichen gebe oder jenseits der Erde ungeahnte Geheimnisse erblicke, daß süßes Erschrecken ihr die Wangen röthet. Schöne Landschaftsbilder im classischen Stile eines Poussin und Claude Lorrain bilden die Gedichte „Der Tempel von Aegina“, „La Cava“, „Im Theater des Dionysos“, orientalische Reisebilder die Gedichte „Jaffa“, „Auf dem Nil“ etc.
Wen hat nicht einmal eine Sehnsucht nach dem schönen Spanien angewandelt, besonders nach jenen Zauberlandschaften, wo die höchsten Bergriesen der Nevada herabsehen auf die Fluren, die der Xenil durchströmt, und auf das Zauberschloß der Mauren, die vielbesungene Alhambra? Friedrich von Schack ist heimisch in diesem Lande; er ist der genaueste Kenner des spanischen Theaters, dem er ein mehrbändiges Werk gewidmet hat; er hat die Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien in einem sinnreichen Werke geschildert; natürlich fehlt auch seine Muse nicht, wo es gilt, diese von geschichtlichen Erinnerungen verklärte Pracht der Landschaft zu besingen, und wie Ludwig Tieck die mondbeglänzte Zaubernacht des deutschen Mittelalters heraufbeschwört, so beschwört Schack in den „Liedern aus Granada“ die Zaubernacht der spanisch-maurischen Vorzeit herbei und versenkt sich in die sieben Himmel des Propheten:
Nun noch einmal, Nacht der Nächte,
Zauberweib vom Morgenlande,
Zeig’ noch einmal dich als echte
Sultanin im Prachtgewande!
Einmal noch im Purpurflore,
Der um Thal und Hügel walle,
Zieh’ hinein durch diese Thore
Zu der alten Königshalle!
Feur’ge Meteore lasse
Durch die Himmelswölbung schießen
Und auf Garten und Terrasse
Rothe Flammen niedergießen!
Bunte Wunderlampen hänge,
Wie sie Aladdin besessen,
In die Lauben, in die Gänge,
An die Zweige der Zypressen!
Wirf empor die Silberwellen
Aus den Alabasterschalen,
Daß sie hell wie Naphthaquellen
Durch der Gärten Dämm’rung strahlen!
Auf den flüssigen Krystallen,
Wie sie kriechend sich verschlingen,
Wie sie steigen, wie sie fallen,
Mag ein Lied des Ostens klingen.
Sie kennen diese Lieder des Ostens; wir haben sie leider zur Genüge gehört und es ist wahrhaft trostreich, daß ein Dichter wie Schack, der uns die „Stimmen vom Ganges“ zugeeignet hat, der so innig mit dem Geiste des Orients vertraut ist, es stets verschmähte, sich in das westöstliche Costüm jener Strophenbildungen zu hüllen, welches eine Zeitlang auf unserem Parnaß Mode war, Dank dem Vorbilde der beiden formgewaltigen Dichter Rückert und Platen! Welche westöstliche Formbewältigungen haben Sie in nächster Nähe schaudernd erlebt! Da ist Ihr Nachbar, der gräfliche Sänger im Schlosse am Meere, den bisweilen der heilige Bardenwahnsinn an das Gestade der hochaufrauschenden baltischen See führt. Hier schlägt er zwar nicht die Harfe, da dies nicht mehr zeitgemäß ist; aber er zieht die Brieftasche und den Bleistift heraus und notirt sich die unsterblichen Gedanken, welche der Gischt der heiligen Meerfluth ihm in’s Gehirn spritzt. Und diese Brieftasche, die er wie einen meuchlerischen Dolch stets „im Gewande“ trägt, zieht er dann bei jeder Begegnung heraus und setzt uns seine lebensgefährlichen Gedichte auf die Brust. Früher waren es nur abendländische Knüttelverse, welche an eine Fahrt auf den Knüppeldämmen seines Guts erinnerten, da er sich trotz aller landräthlichen Mahnungen wenig mit Wegebesserung beschäftigt; seitdem er aber die Bekanntschaft Rückert’s und Platen’s gemacht hat, dichtet er Makamen, jene Knüttelverse des Morgenlandes, die bei ihm mit ihren Schlag- und Klappreimen wie mit Fliegenklatschen jeden verständigen Zusammenhang todtschlagen. Und gar die Ghasalen! Der kleine Schulrath in X. fabricirt in seinen Mußestunden solchen unchristlichen Klingklang! Sie wissen, wie der wohlbeleibte, aber galante Herr sich bei den jungen Grazien Ihres Nachbarschlosses beliebt zu machen sucht, indem er an ihrem Federballspiel thätigen Antheil nimmt! Wenn er dabei athemlos in den verschiedensten ungraziösen Stellungen, vorstürzend und zurückstolpernd, denselben Ball immer wieder aufzufangen und zurückzuschlagen sucht – dann ahnt er gewiß nicht, daß man dabei an seine Ghasalendichtungen denken muß, wo er auch immer einen und denselben Reim über die holperigsten Verszeilen hinweg, unter den unschönsten Verrenkungen der Wortstellung, auffängt und zurückschlägt!
Und wie unseren guten Freunden, die ihre Poesie leider! durch den Druck einer ruhmlosen Vergessenheit anheimgegeben haben, so ergeht es auch vielen namhaften Dichtern, die sich auf einmal den Turban aufsetzen und die „Schönen“ nach [858] östlicher Sitte im Plural feiern, wie schon Karl Immermann gesungen hat:
Von den Früchten, die sie aus dem Zauberhain von Schiras stehlen,
Essen sie zu viel, die Armen, und vomiren dann Ghaselen.
Darum freuen wir uns, daß ein so meisterhafter Uebersetzer orientalischer Dichtungen wie Schack den Nachdruck auf den Geist und nicht auf die Form legt. Seine Sehnsucht nach Indien, die er in einem schwunghaften Gedichte ausspricht, die Sehnsucht nach den Tempeln am Gangesstrome, die das Weltgeheimniß hüten, dorthin, wo der Geist der Urzeit in den windbewegten Palmen von den Wunderträumen der ersten Weltnacht singt, macht den Sänger nicht zu einem Brahmanen, auch nicht zu einem Buddhisten, der in das Nichts der Weltentsagung versinkt, wie der philosophische Einsiedler der Table d’hôte von Frankfurt am Main mit seinem Faust-Pudel, wie Arthur Schopenhauer, nein, bei aller Verherrlichung brütenden Tiefsinns beseelt doch Schack’s Gedichte der thatenkräftige Geist des Abendlandes.
Schon in den „Gedichten“ Schack’s, noch mehr in den „Episoden“, finden sich poetische Erzählungen, denen vorzugsweise ein lebendiges Colorit nachzurühmen ist; es fehlt ihnen allerdings die Prägnanz lakonischer Darstellung, sie ergehn sich behaglich in’s Breite, aber sie werden dabei nie von den Grazien verlassen.
„Lothar, ein Gedicht in zehn Gesängen“ ist die umfangreichste von Schack’s poetischen Erzählungen, die ebenfalls nicht neuerdings entstanden ist, sondern, eine Schöpfung früherer Zeit, erst jetzt an das Licht tritt. Das Gestirn, das am Himmel des Dichters stand, als er seinen „Lothar“ schuf, ist das Doppelgestirn Byron’s und Freiligrath’s. Von Jenem hat die Dichtung die politische Begeisterung, den Haß gegen die Stimmführer einer dumpfen, rückwärts gewendeten Zeit, den Enthusiasmus für die Befreiung Griechenlands, welche einer thatenlosen Epoche als die glorreiche Wiedererweckung einer alten Heldenzeit erschien; von Freiligrath hat Schack die Vorliebe für das exotische Colorit, für afrikanische Wüstenbilder, die hier im sechsten und siebenten Gesange mit einer jenem Dichter ebenbürtigen Meisterschaft ausgemalt werden. Hier haben die Abenteuer selbst etwas Ergreifendes und Spannendes und lesen sich wie Romancapitel, was für eine epische Dichtung immerhin ein seltenes Lob ist, denn wir alle wissen ja, welche Mohnkörner die epische Muse auszustreuen liebt und wie eine erhabene Langeweile die Blätter von Kalliope’s unsterblichen Manuscripten umblättert. Doch unsere Zeit ist so ungeduldig geworden, daß sie kaum mehr die Ruhe hat, epische Gesänge anzuhören, besonders wenn die Geschicke der Helden so ohne alle Spannung verlaufen. Ein echter Epiker geht auf sein Ziel los, wie man durch eine endlos gestreckte Pappelallee auf die Poststation zufährt, doch wir wollen in der Dichtung auf Wegen wandeln, die sich anmuthig krümmen, sich bald in Gebüsch verstecken, bald unter Wiesenblumen verlieren, bald, an freien Berghängen sich schlängelnd, anmuthige und wechselnde Fernsichten bieten. Unsere Epiker müssen die Kunst der Spannung von den Romandichtern lernen; sind sie echte Poeten, so wird ihnen dadurch nicht das Concept verdorben. Nicht allen Gesängen des „Lothar“ können wir indeß diese Kunst der Spannung nachrühmen; in einigen hat es sich der Dichter bequem gemacht und für Verwicklung und Lösung zum Theil verbrauchte Motive benutzt, im Vertrauen auf seine Kunst, auch diese durch poetischen Schwung zu adeln. In allen Gesängen aber weht ein echt patriotischer Geist, jene ideale deutsche Gesinnung, von welcher die blasirte Muse des englischen Lords nichts weiß. Lebendig ist Lothar’s Jugendliebe geschildert, sein studentischer Freiheitsdrang, das Duell mit dem Aristokraten, das einen so tragischen Ausgang nimmt. Dann folgt die Selbstverbannung, Kämpfe und Liebesabenteuer in Spanien, Erlebnisse in Afrika und Griechenland, bis der Schluß den Helden wieder der Heimath und den Seinen zuführt.
Schack, verehrte Frau, ist kein Dichter von absonderlicher Genialität und von jenem erschreckenden Tiefsinn, der seine Orakel oft in unverstandenem Schwulst verkündet. Es giebt Kritiker, denen alles flach vorkommt, was die verhängnißvolle Eigenschaft der Gemeinverständlichkeit besitzt, und es giebt Dichter, welche sich für groß halten, wenn sie sich in labyrinthischen Gedankengängen verlieren. Schack gehört nicht zu ihnen, aber auch nicht zu den glatten und geleckten Akademikern; er wahrt die schöne Mitte künstlerischer Richtung. Seine Sprache hat echten Adel, seine Verse melodischen Fluß – und solchen Zauber werden Sie nicht gering achten, verehrte Frau; denn es ist der Zauber der Schönheit, mit dem Sie vertraut sind, so lange Sie auf Erden wandeln!
Nicht der bildenden Kunst, nicht einem Zeitungsblatte ist’s gegeben, uns den ganzen Jammer zur Anschauung zu bringen, welchen die Hochfluth am dreizehnten November über alle dem Nordoststurme offenen Ostseeländer verhängt hat. Die Statistik mit ihrer ruhig rechnenden Hand wird diese Aufgabe lösen, und lauter und eindringlicher als die ergreifendsten Schilderungen werden dann die stummen kalten Zahlen reden, welche mit den Summen des verwüsteten und für immer verlorenen Habes und Gutes zugleich die schreckliche Summe des vernichteten Menschenglückes aufstellen.
Noch bis heute kommt nur Einzelnes, zerstreut vom Zufall Hingeworfenes von der langen Küstenstrecke voll Noth und Elend und Klage uns vor Augen und Ohren. Wie viel Entsetzliches ist noch nicht entdeckt worden oder hat noch keinen Erzähler gefunden, und wie viel Klagen hat der Tod schon beendet und wie viel Seufzer wird er noch ersticken, selbst wenn überall hin die Hülfe so rasch käme, als das wärmste Herz es nur wünschen kann!
Auch wir geben heute nur ein Bild von den hunderten, ja vielleicht tausenden, wie sie an den deutschen Ostseeküsten von Nordschleswig bis Ostpreußen das Grauen, Entsetzen und Mitleid des verhärtetsten Menschen erregen. Es stellt den Einsturz eines Hauses in dem Dorfe Niendorf am Lübeckischen Meerbusen dar, Dr. Avé-Lallemant in Lübeck schreibt uns hierüber:
„Am Sonnabend (16. November) war ich in Travemünde und ging von da nach dem eine Stunde davon entlegenen eutinischen (oldenburgischen) Dorfe und Badeorte Niendorf. Ich habe das Meer sehr oft in wilder Aufregung gesehen, aber eine solche Empörung der Elemente gegeneinander, diese Vernichtung alles dessen, was der Mensch gebaut und geschaffen hat, eine solche Neuschaffung eines ganz anderen Ufers und Erdbodens kann auch die lebhafteste Phantasie sich nicht erträumen. Man steht im dumpfen starren Staunen am Gestade, zu Nichts fähig, als die Allmacht zu bewundern, welche nach diesem gigantischen Kampfe der Elemente gegen einander dennoch wieder Frieden zu stiften vermochte, einen Frieden, dem sie aus dem Schutt und den Ruinen alles Menschenwerks ein schauerliches Denkmal setzte.“ Das arme Dorf war, ähnlich wie Eckernförde, von zwei Wassern zugleich bedrängt. Während von der See her die Fluth heranstürmte, die Boote zertrümmerte, an den Häusern rüttelte und die Bewohner zwang von Heerd und Hof zu fliehen, trat auch der Himmelsdorfer See aus seinen Ufern, als müsse er sich dieser allgemeinen Flucht entgegenstemmen. Vier Menschen büßten dadurch das Leben ein. Unser Künstler, der berühmte Seemaler Oesterley, mag wohl nach den Berichten von Augenzeugen diesen Augenblick darzustellen gesucht haben. Von sechsundzwanzig durch die Fluth erreichten Häusern sind zwölf spurlos verschwunden, die andern wankende Ruinen. Achtunddreißig Familien sind um Alles gekommen, nicht blos um das Obdach und Alles, was darin und darum war, nicht blos um Vieh, Hausrath, Arbeitsgeräthe, Lebensmittel, Holz und Torf und selbst um das Trinkwasser, das die See mit ihrer Salzlache verdorben, sondern auch um Wiesen, Felder und Gärten, denn die Wogen rissen die fruchtbare Erde fort und gaben den Armen dafür in überreichlichem Austausch Schlamm und Sand. Die Badegäste, welche sich jährlich hier am Strande erquickten, wann werden sie die Menschen wieder froh und das Gelände wieder voll Segen finden?
Allein auf der kurzen Küstenstrecke des oldenburg-eutinischen Gebiets sind über hundert Familien vollständig an den Bettelstab gekommen! In allen Bittbriefen und Zeitungsausschnitten, die uns zugesendet worden, wiederholen sich dieselben Verwüstungsbilder,
[859][860] dieselben Klagen, aber auch an Beispielen muthigster Hülfe und Aufopferung ist kein Mangel. Theilen wir nur Einiges daraus mit; doch müssen wir bemerken, daß die Angaben der Verluste fast sämmtlich aus den ersten Tagen nach dem Unglück stammen, wo der ganze Umfang derselben noch lange nicht völlig ermittelt war.
Furchtbar hat der Sturm auch den größten Theil von Vorpommern betroffen, aber welche Männer fand er da! Auf Hiddensee (nächst Rügen) hatten die Hogshagener in zehnstündiger Todesangst um ihr Leben gekämpft, und kaum selber dem Verderben entronnen, retteten sie die elf Mann starke Besatzung einer gestrandeten Barke. Sie haben Alles verloren, und das Schlimmste ist, daß selbst für baar Geld ihre einzigen Erwerbsgeräthe, ihre Boote und Netze, nicht sofort zu ersetzen sind. Da heißt es: die Menschen erhalten, bis sie es selbst wieder können. Aber Deutschland wird nicht vergessen, daß es Pommern sind, welche die bittenden Hände erheben, Pommern von jener Art, die bei Gravelotte nach sechszehnstündigem Tagesmarsch noch den blutigsten Sieg errangen.
Wie Stralsund an jenem Schreckenstage in Feuer und Wasser gestanden, ist bekannt. Ebenso das Schicksal von Eckernförde, und doch müssen wir von diesem noch Etwas erzählen. Eckernförde liegt bekanntlich zwischen seinem Meerbusen und einem Binnenwasser, das Noer (gesprochen Noor) genannt; beide trennt ein Damm, welcher wieder die beiden Theile der Stadt miteinander verbindet. „Der starke Nordostwind (so schreibt eine Eckernförderin an ihre Schwester in Hildesheim, die den Brief der Hildesh. Ztg. übergab) hatte schon am Abend des Zwölften die neue Anlage bei Borby und den ganzen Weg unter Wasser gesetzt. Doch blieb es ohne merkliche Steigung bis zum nächsten Morgen 4 Uhr. Von da an stieg es so, daß um 7 Uhr die unteren Straßen unserer Stadt überschwemmt waren. Bis 8 Uhr Morgens nahm es zu. Da auf einmal hörte das Steigen auf, das Wasser fiel mit rapider Schnelle und in kurzer Zeit waren die Straßen trocken. Der Damm war durchgebrochen, mit furchtbarer Schnelligkeit erweiterte sich die schmale Oeffnung, das Wasser schoß in gewaltigem Strom in’s Noer hinab. Es unterwühlte den Grund des Dammes, und war der Grund locker gelegt, so stürzten die Stücke des Geländers hinab. Alles folgte dem gewaltigen Strom; fast athemlos wurden die Leute, als ein Boot mit zwei Fischern durch die Oeffnung schoß; glücklicher Weise konnten sie gerettet werden und ebenso die Bemannung eines größeren Bootes, welches später durchging. In 1½ Stunden war der ganze Damm fort, und die grauen Wogen mit weißem Kamm gingen darüber hin, als wäre nie ein Hemmniß dort gewesen. Bald war das durch den Dammbruch geöffnete Becken des Noers gefüllt, und nun stieg die Fluth auch wieder in unseren Straßen, so daß schon Mittags die Böte umherfuhren. Was fliehen konnte, floh, oder suchte mit seinen besten Sachen fortzukommen. Bis 4 Uhr Nachmittags nahm die Fluth immer zu, und während dieser Zeit richteten die Wogen den Gräuel der Verwüstung an. Endlich ging der Wind um, und dadurch ward dem Meer sein ‚Bis hierher und nicht weiter‘ zugerufen. Die Leute mitten in der Stadt athmeten wieder auf. Da – um halb 8 Uhr – läuteten die Glocken. Da muß Feuer sein! Mein Gott, zu Wassersnoth auch noch Feuersnoth bei diesem Sturm und bei den mit Wasser gefüllten Straßen! In der Kalkfabrik von W. Clausen brannte es; aber Dank unserer Feuerwehr, welche bis an die Brust in’s Wasser ging, wurde die Gefahr bald beseitigt.
Der Wind war ruhig geworden, die Wellen ließen nach, der Strom ward schmaler, das Wasser trat in sein Bett zurück; aber welches Bild zeigte der folgende Morgen! Ganze Häuserreihen völlig verschwunden und an ihrer Stelle nur ein Steinhaufen. Einige Dächer standen auf der Erde, andere waren ganz wegrasirt, und dazwischen die wüsten Trümmer von Hausgeräth aller Art. Ganz zerstört sind in der Stadt achtzig bis neunzig Häuser, verwüstet einhundertdreißig bis einhundertvierzig. In Borby ist die Verwüstung verhältnißmäßig ebenso groß. Auch die ganz neuen massiv gebauten Häuser sind zusammengestürzt. Man könnte Blut weinen, wenn man das Elend ansieht. Da wir hoch wohnen, so haben wir doch unser Haus behalten und konnten die Unglücklichen, die in Böten zu uns kamen, aufnehmen. Ich hatte über hundert Menschen im Hause, aber wie gerne thut man es! Auf den Treppen im Hause bis oben hinauf saßen die Kinder die Nacht hindurch. – Fast hätte ich auch meinen Mann verloren! Muthig, wie immer, ist er draußen hingeritten, um Menschenleben zu retten, kann sich aber nicht halten, kommt unter’s Wasser und wäre verloren gewesen, wenn er nicht ein so guter Schwimmer wäre. Durchnäßt bis über die Ohren kommt er zu meinem größten Schrecken nach Haus, rasch in trockene Kleider und wieder in die Böte, um die Menschen von unten zu holen.“
Was Todesangst ist, hat auch der Lootse von Schleimünde mit den Arbeitern am dortigen Steindamme des Leuchtthurms erfahren. Das Lootsenhaus liegt am höchsten auf einem schmalen Streifen Landes, dabei ein achtzig Fuß langer Schuppen für Boote, jetzt das Nachtquartier jener Arbeiter, und ein Stall für ein Pferd, ein paar Kühe und Schafe. Als der Sturm in der Nacht losbrach, flohen die Arbeiter aus dem Schuppen in das Lootsenhaus. Achtundzwanzig Menschen staken in dem engen Raume, aber sie hielten sich für sicher; denn noch nie, so lange der Lootse denken konnte, war das Wasser bis zu ihm heraufgestiegen. Aber es kam doch, es drang schon durch die Thür. Eiligst suchte man Thür und Fenster möglichst zu verstopfen, aber vergeblich. Da brechen sich die Wellen an den Wänden, und Alle flüchten auf den Boden, unter das Dach. Noch schützen die Nebengebäude das Lootsenhaus vor dem directen Wogensturme. Vergeblich lugen sie nach Hülfe aus. Ein schwedischer Schooner versucht, das Boot auszusenden, aber es mißlingt viermal. Da reißt eine riesige Woge Schuppen und Stall zugleich fort, Kühe und Schafe treiben blökend und brüllend vorüber, und nur das Pferd sucht schwimmend sich an jedem Baumzweige festzuhalten. In dieser höchsten Noth umarmt der Lootse Weib und Kinder und streckt sich hin, den Tod erwartend. Das Haus schwankt, jede Woge kann es begraben. Aber – plötzlich lauscht des Lootsen sicheres Ohr auf – der Sturm hat sich gewendet, die See wird ruhiger, die Wasser wogen zurück, die Menschen sind gerettet. Jetzt brachte der Schwede Alle auf’s Trockene. Und auch das Pferd fanden sie wieder, an einem Häuflein Heu kauend, das ihm eine gutmüthige Seele gereicht.
Auch in den Dörfern am Flensburger Busen kostete das Retten von Menschenleben Wagniß und Opfer. Das Fischerdorf Wenningbund, dessen zehn Häuser am Strande und auf den Wiesen zerstreut lagen, ist vom Erdboden verschwunden. Als das Hochwasser kam, packten die Leute ihre tragbare Habe in Säcke und Koffer und flüchteten mit ihrem Vieh auf die Böden. Aber das Wasser erreichte die Dächer auch hier. Unter größter Gefahr nahte ein Boot sich einem der Häuser. „Werft ein Stück Bettzeug in’s Boot und dann das Kind!“ rief man hinauf. Als man das Würmchen hinlegte, war es still. Ueberschwer beladen gelang doch die Fahrt, und sie wurde, später von einem geretteten Schiffer geleitet, wiederholt, bis Alle geborgen waren. Nur ein Mann, der auch noch die Schafe retten wollte, versank mit ihnen in die Fluth.
Aus einem andern Dorfe wird die Rettung von ein Paar alten Leuten erzählt. Kannten sie die Gefahr nicht, oder wollten sie sich von ihrem Heim nicht trennen? Man rief vergeblich, schlug endlich die Wand ein und fand sie im Schweinestalle, wohin die Alten durch das Kuhhaus von ihrer Stube aus gelangen konnten: da saß die Alte – und strickte! Von kräftigen Armen wurde sie und ihr Mann, der aus seiner Stube und von seinem „Zeug“ mit Gewalt fortgerissen werden mußte, in ein Boot getragen.
Der Erzähler dieser Flensburger Vorfälle schließt seinen ebenfalls von der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ abgedruckten Brief so: „Aber, lieber E., was wirft das erzürnte Meer noch immer an’s Land! Leichen, Wagen, todte Thiere, Commoden mit Silber- und Werthsachen, Kasten mit Geld, Kleidungsstücke etc. Zu Rennberg sollte ein neues Haus gebaut werden; jetzt schwimmt das Bauholz, Tausende von Thalern werth, im Flensburger Fjord. – So sieht es bei uns aus. Wie wird es werden? Bis jetzt hat man uns Deutschen in Nordschleswig noch nicht gezeigt, daß wir zum großen Ganzen gehören; wir haben das frostige Gefühl, Stiefkind zu sein; möge es bei dieser Gelegenheit besser werden!“ –
Ist der letzte Vorwurf gerecht, so kann kein Wunsch dringender sein als der: diesen Schmerzens- und Stiefkindern endlich das ganze Vaterland recht warm fühlbar zu machen!
Es sind beinahe vier Wochen verflossen, seit ich Ihnen das letzte Mal schrieb. Aber Sie müssen mich entschuldigen, da alsbald nach der Präsidentenwahl im Anfange des Monats November das Vorlesungswesen meine Kräfte der Art in Anspruch nahm, daß kaum Zeit für etwas Anderes übrig blieb. Ein Vorleser oder Lecturer, wie der englische Kunstausdruck lautet, hat es hier nicht so bequem, wie in deutschen Städten, wo Alles, was sich für eine Vorlesung oder Vorleser interessirt, an demselben Punkte zusammenströmt. Hier ist es umgekehrt, und ein Vorleser muß sich mit Rücksicht auf die riesigen Entfernungen innerhalb New-York’s und seiner Schwesterstädte bequemen, an zehn oder zwölf verschiedenen Punkten seine Vorträge zu wiederholen, und dabei selbstverständlich Zeit und Kräfte zuzusetzen. Da geht es denn von einer Car (Pferde-Eisenbahn-Wagen) in die andere; von einer Ferry (Fährboot) in die andere, bis man endlich müde und zusammengerüttelt am Bestimmungsorte anlangt und schließlich jenem vielköpfigen Ungeheuer, welches man Publicum nennt, gegenübersteht, bisweilen an einem eleganten, mit Blumen oder Teppichen umrahmten Lesepult, bisweilen an einem alten wackeligen Tisch, den man nicht berühren darf, ohne das auf demselben stehende Glas Wasser zum sanften Ueberschwappen zu bewegen. Dabei ist man in der Regel noch nicht fertig mit dem Hinunterschlucken jener kleinen Aergernisse, welche das Anbringen oder Aufhängen einer Anzahl von zu der Vorlesung nöthigen Tafeln oder sonstigen Gegenständen an passender Stelle bei der Unverständigkeit der Bediensteten oder dem Mangel an dazu nöthigen Materialien im Gefolge hat; oder man hat noch kaum eine Minute Zeit gehabt, sich von unzähligen Begrüßungen, persönlichen Vorstellungen und der Anstrengung unaufhörlichen Händeschüttelns zu erholen – und schon steht man auf der sogenannten Platform, um dem aus den verschiedensten Elementen gemischten Zuhörerkreise innerhalb des unsagbar kurzen Zeitraums von ein bis zwei Stunden mitunter die schwierigsten Probleme der Wissenschaft oder der realistischen Forschung klar und verständlich zu machen, eine Aufgabe in der That, welche, wie es scheint, zu den schwierigsten gehört, die der menschliche Geist sich stellen kann.
Aber wie verschieden spiegelt sich denn auch das Gesagte wieder in den vielen verschiedenen Gehirnen, welche mit Auge und Ohr die Worte des Redners in sich aufnehmen! Dem Einen ist der Vortrag zu gelehrt, dem Andern zu ungelehrt; dem Einen giebt er zu viel, dem Andern zu wenig; dem Einen ist er zu lang, dem Andern zu kurz; dem Einen ist er zu materialistisch, dem Andern ist er nicht materialistisch genug; der Eine will Witze, der Andere will keine; der Eine hat schon Alles gewußt, der Andere nicht Alles verstanden. Zarte Damengemüther fühlen sich beleidigt von einigen für die Zwecke des Vortrags unentbehrlichen, aber doch an sich höchst unschuldigen anatomischen Erörterungen; während starkgeistige Frauen und energische Frauenrechtlerinnen darüber mitleidig die Achseln zucken und sich sehr in ihren Rechten gekränkt fühlen, wenn man sie von einem Vortrage ausschließt, welcher die Aufgabe hat, die berühmte oder berüchtigte Seelensubstanz-Theorie an den Thatsachen der Zeugung und Vererbung zu prüfen. Endlich ist man fertig und wird von dem gestrengen Publicum-Richter mit dem üblichen Applause entlassen.
Aber von Ruhe ist darum keine Rede; denn nun geht das Vorstellen und Händeschütteln erst recht los. Ist auch dieses glücklich überstanden, so folgt die letzte, aber auch härteste Prüfung, durch welche der betreffende Verein oder das betreffende Comité, welches den Redner eingeladen hat, den praktischen Beweis dafür zu liefern sucht, daß die neuerdings so oft gehörte Behauptung, der Materialismus der Wissenschaft und der Materialismus des Lebens seien himmelweit verschiedene Dinge, unrichtig ist. Ist man schließlich nach unerhörten Anstrengungen auch mit diesen sinnlichen Genüssen fertig geworden und hat eine Anzahl von Toasten angehört und beantwortet, so darf man sich endlich um oder nach Mitternacht aus diesem Zauberkreis entfernen, um abermals mittelst einer kleinen Reise den schützenden Hafen des heimischen Hauses zu erreichen. Andern Morgens erwacht man mit etwas dumpfem Kopfe, um beim Frühstück die Zeitungen zur Hand zu nehmen und die während der Nacht gedruckten Berichte über dasjenige zu lesen, was man Abends vorher da oder dort verübt oder angestellt hat, und sich davon zu vergewissern, ob man es den gestrengen Herren Repräsentanten der öffentlichen Meinung recht gemacht oder nicht.
Dieser „Kreislauf des Lebens“ wiederholt sich dann denselben oder den folgenden Abend in ähnlicher oder nahezu gleicher Weise und mit stets gleichem Erfolge; und ein gewissenhafter Vorleser sieht sich dabei vor allem Andern zu der Frage an sich selbst veranlaßt, ob und welchen wirklichen Nutzen oder nützlichen Einfluß seine so fortgesetzte Thätigkeit auf die Geister seiner Zuhörer auszuüben im Stande ist.
Das allgemeine Interesse des Volkes, wie der Gebildeten, an öffentlichen Vorträgen nimmt sowohl in Europa wie in Amerika mit jedem Jahre mehr zu, was wohl nicht der Fall sein könnte, wenn die Erfahrung gegen ihre Nützlichkeit sprechen würde. Mag auch Vieles und Manches dabei sogenannte Modesache sein, so doch nicht Alles; und jedenfalls dürften sie ein gutes Gegenmittel gegen jene Verflachung der Bildung abgeben, welche durch das, wenigstens in Amerika, in einem riesigen Maßstabe überhand nehmende Zeitungs-Wesen herbeigeführt zu werden droht. Es giebt in Amerika, selbst bis in die untersten Schichten der Bevölkerung herab, kaum Jemanden, der nicht täglich eine oder mehrere Zeitungen liest, und daraus erklärt sich denn auch deren immense Verbreitung. Tägliche Auflagen amerikanischer Zeitungen von weit über Hunderttausend sind bei den hervorragenderen Blättern (wie Times, Herald, Tribüne, World, Evening Post u. s. w.) etwas Gewöhnliches. Deutsche Zeitungen machen selbstverständlich kleinere Auflagen; aber doch trägt die in New-York und im Osten verbreitetste deutsche Zeitung, die „New-Yorker Staatszeitung“ ihrem Besitzer fabelhafte Summen ein und hat ihn veranlaßt, mitten im belebtesten Theile der Stadt für seine Zeitung eine Heimstätte zu erbauen, welche an Pracht, Ausdehnung und Kostspieligkeit mit den schönsten europäischen Palästen zu wetteifern im Stande ist. Was den Inhalt betrifft, so steht freilich die deutsche Presse der Vereinigten Staaten der amerikanischen weit nach und bezieht ihre besten Sachen in der Regel aus europäischem Nachdruck; auch ist die Eifersüchtelei und gegenseitige Bekämpfungswuth unter den Organen deutscher Zunge nachgerade bis auf einen fast unerträglichen Höhepunkt gediehen. Aber nicht blos in der Presse, sondern auch im Leben hat sich die alte deutsche Uneinigkeit hier leider in hohem Grade erhalten und steht allem Gemeinschaftlichen, mit vereinten Kräften zu Erreichenden hindernd im Wege.
Arrangirt z. B. an einem bestimmten Orte eine Partei eine Vorlesung, so wirkt ihr die andere entgegen, mag auch die Sache selbst noch so sehr mit ihren Principien harmoniren, und umgekehrt. Freilich muß man zur Entschuldigung sagen, daß hier Alles Partei ist, und zwar nicht blos bei den Deutschen, sondern ebenso bei den Amerikanern. Ich besuchte bei Gelegenheit der Präsidentenwahl (welche jetzt vorüber ist und ein Ihnen ohne Zweifel längst bekanntes Ergebniß geliefert hat) mehrere politische Versammlungen und überzeugte mich zu meinem nicht geringen Erstaunen, daß man eigentliche Volksversammlungen im europäischen Sinne hier gar nicht kennt, und daß alle derartige Versammlungen nur sogenannte Parteiversammlungen sind, welche auf den Unbefangenen mehr den Eindruck einer großen theatralischen Schaustellung, als einer Volksbefragung machen. Alles ist vorher abgekartet und abgemacht, die Rollen sind vertheilt, die Liste des Präsidenten und zahlloser Vicepräsidenten liegt gedruckt vor und die Zuhörer spielen nur die Rolle von Statisten, welche an passenden Stellen durch Händeklatschen ihren zustimmendem Gefühlen Ausdruck geben und schließlich die vorgelesenen Resolutionen [862] ohne Widerrede annehmen dürfen. Zwischendurch erklingen jene in Amerika bei keiner Festlichkeit oder öffentlichen Gelegenheit fehlenden ohrenzerreißenden Töne, welche von einer im Hintergrunde postirten Musikbande herrühren; auch sieht man von Zeit zu Zeit einen Gesang- oder sonstigen verbündeten Verein mit Fahnen, Transparenten und mit klingendem Spiele zur Thür hereinziehen. Auf der Platform aber sitzen mit ernsten, unbeweglichen Mienen die sogenannten „prominenten“ Männer der Partei und blicken darein wie Catone und Sokratesse. In den Reden selbst aber schwirrt es von lauter Grant’s, Greeley’s, Kukluxen, Copperheads, Carpetbaggers und wie alle die merkwürdigen politischen Bezeichnungen heißen mögen, in denen sich ein europäisches Gehirn unmöglich zurechtzufinden vermag, und jeder Ausfall auf den feindlichen Candidaten findet den reichlichen Beifall der Statisten, unter denen Manche nicht bloß mit den Händen, sondern auch mit den Armen und Füßen arbeiten. Unterhalb der Platform sitzen die Reporters oder Berichterstatter der Zeitungen, denen von Zeit zu Zeit ein Blatt von oben hinabgereicht wird und welche folgenden Tages das Ganze in verschönernder Perspective dem obersten Richter, dem Gesammtpublicum, vorlegen.
Während dieser Vorgänge im Innern hat die Partei draußen vor dem Local auf einer vor dem Hause errichteten Platform ein gleiches Vergnügen für dasjenige Publicum arrangirt, welches den freien Himmel den beengenden Räumen des Versammlungssaales vorzieht – ein Vergnügen, welches überdem durch Raketen, Böllerschüsse, bengalische Lichter etc. auf einen möglichst hohen Grad zu bringen versucht wird. Am meisten kommt dieses Vergnügen der lieben Straßenjugend zu Gute, welche hier als ein Theil des souveränen Volkes der unbeschränktesten Willensfreiheit genießt und nicht blos in Wahlzeiten, sondern jederzeit (unglaublich, aber wahr!) ihre abendlichen Mußestunden mit Anzünden von großen Straßenfeuern zweckmäßig auszufüllen sucht. Die Herren Jungens suchen und stehlen dabei alles denkbare Brennmaterial aus der nächsten Umgebung zusammen, und wenn dann die Flammen lustig zum Himmel emporschlagen, oft in nächster Nähe der unaufhörlich passirenden Straßen-Eisenbahnwagen, so hockt die kleine Bande um das Feuer und stiert wollüstig in die Gluth oder führt einen indianermäßigen Rundtanz um dieselbe auf. Niemand denkt daran, sie in diesem gefährlichen Vergnügen zu stören; und es wäre eine dankbare Aufgabe für einen Psychologen, zu untersuchen, ob die häufigen, großartigen Brände und die zahllose Menge kleinerer Brände in amerikanischen Städten nicht in einem inneren und psychologischen Zusammenhange mit dieser in der amerikanischen Jugend fortwährend genährten Feuerlust stehen.
Ueberhaupt ist die Geduld und Langmuth des amerikanischen Publicums im Ertragen von Mißständen und selbst Unbequemlichkeiten, trotz alles Republikanismus, eine geradezu grenzenlose und für europäische Begriffe unerhörte. Man läßt sich nicht bloß die Straßenfeuer der Jugend und zahllose Mißstände der Straßenpolizei ruhig gefallen, sondern man läßt sich auch tagtäglich ohne Murren in den sogenannten Cars oder Straßen-Eisenbahnwagen in einer Weise zusammenpferchen, daß die berüchtigten Schrecken eines Sclavenschiffs dahinter zurückstehen müssen. Diese lammartige Geduld mag denn auch viel zu der politischen Corruption beigetragen haben, welche ich Ihnen in einem meiner früheren Briefe geschildert habe, und eine Hauptursache dafür sein, daß in keinem andern Lande so sehr wie hier die öffentliche Meinung ein Resultat der sogenanntem „Mache“ ist, obgleich man das Gegentheil voraussetzen sollte. Geld, Zeitungen und öffentliche Kundgebungen scheinen in dieser Beziehung neben heimlichen Wühlereien allmächtig zu sein, und nur wenn es die politischen Faiseurs von Zeit zu Zeit allzu arg machen, bäumt sich das öffentliche Bewußtsein dagegen auf. So bei der diesjährigen Wahl des Newyorker Mayors oder Bürgermeisters, für dessen Amt ein Irländer, Namens O’Brien, ein würdiger Nachfolger von Tweed und Genossen, große Aussicht hatte gewählt zu werden. Aber er unterlag seinem in allgemeiner Achtung stehenden Gegencandidaten Havemeyer. Diese Wahl fand gleichzeitig und gemeinschaftlich mit der Präsidentenwahl am 5. November statt und verlieh der ganzen Wahlcampagne, welche im Uebrigen außerordentlich still vorüberging, ein erhöhtes Leben. Ich besuchte einige sogenannte Polls oder Wahllocale an verschiedenen Punkten der Stadt und fand dieselben weit stiller als bei ähnlichen Gelegenheiten in Deutschland. Die Jungen, welche vor den Wahllocalen herumlungerten und Zettel anboten, erschienen beinahe zahlreicher als die Wähler selbst. Am meisten Leben entfaltete sich gegen Abend, wo bereits theilweise Wahlresultate aus den Provinzen eintrafen und dem souveränen Volke durch eine große erleuchtete Tafel, welche eine der großen Zeitungen auf der Höhe eines Hauses am Unionsplatze hatte anbringen lassen, nach und nach, sowie sie eintrafen, bekannt gemacht wurden. Zwischendurch brachte die nach Art der Nebelbilder sich stetig verändernde Scheibe Anzeigen hiesiger Firmen; und so oft eine der einen oder anderen Partei günstige Nachricht auf derselben erschien, wurde sie von deren Anhängern mit Hurrahs begrüßt, welche sich übrigens nicht einmal durch besondere Kräftigkeit auszeichneten. Als endlich Grant als Sieger aus dem Wahlkampfe hervorging, war der Jubel ein allgemeiner, und die politischen Gegner, welche sich noch Tags vorher mit Erbitterung bekämpft hatten, reichten sich versöhnt die Hand. Als einzige Nachwehen bleiben nur die großen Summen zu verschmerzen, welche die Anhänger der durchgefallenen Candidaten und diese selbst für die Zwecke ihrer Wahl unnütz ausgegeben haben, sowie einige Beulen, welche sich die Herren Irländer aus Liebe zur Freiheit (d. h. zu ihrer eigenen) einander an die Köpfe geschlagen haben. Für vier Jahre hat das Land nun wieder politische Ruhe, soweit nicht die durch den Ausfall der Wahl nöthig gewordene Neubildung oder Umänderung der politischen Parteien dieselbe zu stören geeignet ist. Die unnatürliche Verbindung der Demokraten und Südländer mit den Greeleyiten fiel natürlich sofort mit der Beseitigung Greeley’s über den Haufen; und es wird nunmehr Alles darauf ankommen, ob und wie die republikanische Partei ihren Sieg zu benutzen wissen wird. Wahrscheinlich werden sich ihre Anstrengungen zunächst auf Beseitigung der Wahlmännerwahlen und auf Einführung eines directen Wahlmodus für die Präsidenten der Republik, sowie vielleicht auch auf Einführung des Frauenstimmrechts richten. Doch davon später!
Uebrigens fehlt es hier nicht an Leuten, welche es für möglich halten, daß ein energischer Präsident aus der Republik eine Monarchie machen könne (eine freilich höchst unwahrscheinliche Sache), sowie es auch nicht an Solchen fehlt, welche für die Vereinigten Staaten einen zukünftigen Religionskrieg prophezeien. Ein Religionskrieg in unserer Zeit, und obendrein in einer Republik, würde freilich ein Anachronismus der kolossalsten Art sein. Wenn man aber sieht, wie tief hier das religiöse Leben in alle Verhältnisse eingreift und wie groß der Haß zwischen Katholiken und Protestanten ist, so kann man ein solches Ereigniß wenigstens nicht als außerhalb des Bereiches der Möglichkeit liegend ansehen.
Vor einigen Tagen besuchte ich West-Point, die berühmte Militärschule der Vereinigten Staaten, aus welcher bekanntlich die meisten der großen Generale des Südens hervorgegangen sind. Diese in jeder Beziehung musterhaft eingerichtete Anstalt liegt einige Meilen von New-York am Hudson aufwärts und hat einen der reizendsten Flecke der Erde inne. Ein bogenförmig vom Hudson umflossenes, sehr geräumiges Hochplateau ist rings von einem unvergleichlich schönen Gebirgspanorama eingerahmt, welches nur da, wo man den Hudson aufwärts blickt, eine Lücke zeigt. Der Blick in diese Lücke liefert das malerischste Bild, das man sehen kann; und keine Phantasie könnte die ganze Scenerie ansprechender gestalten, als sie wirklich ist. Der von einer Menge kleiner, im Sonnenschein blinkender Segelboote belebte Fluß ist auf beiden Seiten von mehrfach vorspringenden Bergreihen eingerahmt, ähnlich wie der berühmte Königssee in Baiern, während sich im fernen Hintergrunde eine zweite sonnenbeglänzte, mit freundlichen Wohnhäusern belebte Landschaft öffnet.
Nachmittags bestiegen wir zur bessern Uebersicht das Fort Putnam, ein altes, auf hohem Berge gelegenes, aus dem Kriege mit den Engländern stammendes und jetzt in Trümmern liegendes Bergschloß, wahrscheinlich die einzige Bergruine Amerikas. Entbehrte der Hudson nicht der malerischen und romantischen Verzierung alter Schlösser und verfallener Burgen, so könnte er sich durch seine Naturscenerie unserm Rheine an die Seite stellen, den er überdem in seinen unteren Theilen durch seine seeartige Ausbreitung in Bezug aus Großartigkeit übertrifft.
Die vortreffliche Einrichtung der sogenannten Palastwagen [863] auf der neben dem Flusse herlaufenden Eisenbahn, welche mit großen Spiegelscheiben versehen sind, ermöglicht dem Reisenden, auch mittelst der Eisenbahn die landschaftlichen Schönheiten der Gegend zu genießen – eine Einrichtung, deren Einführung unseren rheinischen Eisenbahnen sehr zu empfehlen sein dürfte. Freilich ist der Naturgenuß in Amerika unzertrennlich von einem Kunstgenuß, den man glücklicherweise in Europa mehr oder weniger entbehren muß, ein Genuß, der unwillkürlich an die berühmte Geschichte von Kieselack erinnert. Denn so, wie es Kieselack verstand, seinen Namen überall und selbst an den unzugänglichsten Stellen der Erdoberfläche anzubringen, so verstehen es die amerikanischen Maler oder Weißbinder, nicht blos alle Straßenecken oder Bretterschuppen, sondern gewissermaßen die ganze Natur mit den widerwärtigen Anzeigen der New-Yorker Shopkeeper oder Pflasterschmierer zu beklecksen.
In riesengroßen Buchstaben und in allen möglichen Farben und Verzierungen prangen diese Anzeigen an allen Wegen, Straßen, Zäunen, Abhängen und selbst an den scheinbar unzugänglichsten Felsenklippen. Der Matador dieses Anzeigenhumbugs scheint gegenwärtig der glückliche Erfinder oder Besitzer des nach seiner Meinung weltberühmten Centaur-Liniment zu sein; und man kann sicher sein, auf allen Wegen und Stegen in und um New-York diesem Centaur-Liniment an jedem Punkte zu begegnen, der nur die leiseste Möglichkeit bietet, eine in die Augen fallende Inschrift auf demselben anzubringen. Auch dieses Recht eines halbverrückten Kerles, in seinem persönlichen Interesse die halbe Natur zu verklecksen, deren Schönheiten doch wohl für Alle da sein sollen, gehört hier zum Wesen der persönlichen Freiheit, welche aber im Grunde nur möglich ist durch die grenzenlose Lammsgeduld aller Uebrigen.
Lassen Sie mich diesen Brief mit der Erzählung einer netten Anekdote beschließen, welche zeigt, daß die berühmte Smartneß der Amerikaner (ein Ding, wofür wir im Deutschen keinen Ausdruck besitzen) sich auch in religiösen Dingen geltend zu machen versteht. Als ich in Hudson-City, einer auf dem linken Ufer des Hudson New-York gegenüber, auf einer langhingestreckten Anhöhe gelegenen Schwesterstadt New-Yorks, in welcher sehr viele Deutsche wohnen, und von deren Höhen herab man einen prachtvollen Blick über New-York und seine Umgebung genießt, eine Vorlesung hielt, waren die Gemüther der Bewohner dieser guten Stadt noch aufgeregt über den Schurkenstreich eines angeblichen Dieners Gottes, welcher zur größeren Beförderung der Frömmigkeit eine Sonntagsnachmittagsbetstunde eingerichtet hatte. Während nun die Gläubigen um ihn versammelt waren und seinen frommen Worten lauschten, erbrachen seine Spießgesellen die Häuser der in der Betstunde Anwesenden und raubten sie aus. Ging die Sache nicht schnell oder glücklich genug von Statten, so empfing der Mann Gottes durch die Fenster des Betsaales gewisse Zeichen, welche ihn veranlaßten, die fromme Andacht bis zu dem glücklichen Austrage des Geschäfts zu verlängern. Bekam er endlich Nachricht, daß Alles gelungen sei, so entließ er mit einigen salbungsvollen Worten sein fromme Herde, welche keine Ahnung davon hatte, wer ihr den feinen Streich gespielt hatte, bis ein Zufall die Sache an das Licht brachte.
Auch an Klöstern, Mönchen und Nonnen, diesen werthvollen Errungenschaften europäischer Vergangenheit, fehlt es in diesem freien Lande nicht; und wenn man den europäischen Mönchen des Mittelalters nachrühmt, daß sie es stets verstanden hätten, ihre Nester an den schönsten Punkten des Landes aufzubauen, so ist dieses eine Tugend, welche ihre amerikanischen Herren Collegen auch heute noch auszuüben verstehen. Als ich vor einigen Sonntagen bei Friedrich Lexow, dem Herausgeber des weit verbreiteten „Belletristischen Journals“, auf seinem schönen Landsitze in Union-Hill, der einen prächtigen Ausblick nach dem Festlande hin gewährt und mit seinen freundlichen Gärten, Wiesen und Wäldern ganz den Eindruck einer deutschen Landschaft macht, einen ruhigen Tag fern von dem Toben der Weltstadt zubrachte, gewahrte ich, ungefähr zwanzig oder dreißig Schritte von dem Hause entfernt, auf dem höchsten und schönsten Punkte des Höhenzuges ein neues, stattliches, etwas im mittelalterlichen Stile gehaltenes steinernes Gebäude. Als ich fragte, was das für ein Gebäude sei, erhielt ich zur Antwort: „Ein Kloster!“ – und als ich erstaunt weiter fragte: „Sind denn auch Mönche darin?“ so hieß es: „Freilich!“ Und ich verbesserte mich selbst in Gedanken, indem ich bereute, so dumm gefragt zu haben, und sagte zu mir: „Warum sollte es in Amerika keine Mönche geben, da ja hier das Princip der persönlichen Freiheit herrscht?“ Und damit leben Sie wohl bis zu meinem nächsten Briefe!
Am „alten abgelegten“ Claviere.[2] „Es war lange trüb’, sehr trüb’ um mich her, aber es wird heiterer!“ so lautet das Facsimile unseres Altmeisters Pestalozzi auf seinem Bilde, welches mein einfaches Stübchen ziert. Ich kann den Vordersatz aus tiefster Seele nachsprechen; paßt er doch auf meine Vergangenheit auch recht treffend und vollgültig; aber auch den Nachsatz – wenn auch nur in gewissem Sinne – kann ich nun mit unterschreiben!
Wer wüßte nicht ein Lied von der Noth der Lehrer zu singen? Mein Dasein gleicht dem vieler meiner Collegen wie ein Ei dem andern. Ich stehe im Vollgenusse des karg zugeschnittenen Minimalgehaltes im Regierungsbezirke Frankfurt an der Oder und habe davon (außer mir) Frau und sieben Kinder zu ernähren, zu bekleiden etc. Kann man da nicht mit Uhland sprechen:
„Daselbst erhub sich große Noth,
Viel Steine gab’s und wenig Brod!“
Denn bei wenig Brod mangelt’s uns nimmer an den Steinen des Anstoßes, des Kummers, des Aergernisses und der Bosheit! Wie aber soll man bei unserm Gehalte die Mittel erschwingen, um in dieser Trübsal den Geist und das Gemüth nicht schmachten zu lassen? O, auch wir arme Lehrer haben unsere Freude, hohe, tiefempfundene Freude, an einer reichhaltigen und gediegenen Bibliothek, an den Schätzen der musikalischen Literatur, an dem Labung und Trost spendenden Harmonienstrome eines Piano. Aber wie Wenigen von uns lacht das Glück, von all diesem Sehnen auch nur das bescheidenste Theilchen zu befriedigen! Es ist nur zu gewiß, unsere leibliche – und in natürlicher Folge – unsere geistige Noth ist noch nicht in vollem Maße weder von maßgebenden Autoritäten, noch von der großen Masse unseres Volkes gekannt, und warum? Weil man diese Noth selbst durchgekostet und durchgerungen haben muß, um ihre Größe zu erfassen und zu würdigen.
Doch, Gott Lob, es giebt immer noch hochherzige, von lauterster Liebe zu unserem Stande durchdrungene Männer- und Frauenseelen, die hier und dort im weiten deutschen Vaterlande manches Lehrerherz trösten, aufrichten und mit neuen Hoffnungen erfüllen. Von solchen Blüthen echter Menschenliebe hat die Gartenlaube schon so oft erzählt. Ich kann abermals eine solche Blüthe verzeichnen!
Es war am 3. September d. J., als mir durch die Redaction der Gartenlaube die köstliche Nachricht – für mich eine wahre Siegesdepesche – zuging, es stünde für mich durch die Güte einer Dame, die nicht genannt sein wolle, ein Instrument zur Verfügung und möchte ich u. s. w. War das Traum, war’s Wirklichkeit? Soll ich meinen damaligen Jubel beschreiben, schildern das helle Aufjauchzen meiner Kinderschaar und die Freudenthränen meines an Kummerthränen so reichen treuen Weibes? Das kann keine Feder zeichnen, kein Pinsel malen! Genug, die Botschaft machte unser Haus zu eng; nicht die Herzen allein, nein das ganze „schulmeisterliche“ Haus hüpfte vor Freuden.
Aber nun kam eine Zeit stillen Harrens, eine Geduldsprobe, zu der uns, wie so manchen Harrenden, die „Anhaltische Bahn“ verurtheilte: denn das heißersehnte Piano ließ fünfzehn – für uns unendlich lange – Tage auf sich warten, und doch wußten wir, daß es auf der Reise sein müßte. Bereits hatten wir das erforderliche „Quartier“ dem lieben Angebinde angewiesen, und – diese Stelle sollte leer bleiben? Wie eilten unsere Augen und Herzen dem Briefboten täglich entgegen, der uns Kunde bringen sollte von der glücklichen Landung unseres Sorgenbrechers!
Und so saßen wir abermals an einem Sonnabende – der Tag ging zu Rüste – in Gedanken über unser vergebliches Hoffen versunken; der Briefbote hatte wie gewöhnlich mit dem Kopfe geschüttelt; leer war die Stätte für „der Töne Reich“ geblieben: – Da, horch! „Was hör’ ich draußen vor dem Thor?“ Ein schweres Fuhrwerk rasselt heran und herein stürmt meine kleine Schaar mit „Trompetengeschmetter“: Pianino, Pianino!
[864] Ja, da war es, noch in unscheinbarer Hülle eingeklammert. Ein wohlmeinender Freund hatte es auf dem nächsten Bahnhofe für mich in Empfang genommen und überraschte mich damit, indem er es sofort auf eigenem Gefährt bis vor meine Thür sandte. Viel fehlte nicht, ich hätte im ersten Freudentaumel Kutscher und Pferde, die mir die freundliche Gabe zuführten, umarmt. Und meine Kinder, was sie trieben? Schweiget, Worte! Bald war das gehaltvolle Schiff in sichern Hafen bugsirt. Und da stand es, das trauliche Instrument – ein prächtiges Pianino –, und die Tasten, die langentbehrten, lachten mir entgegen und lockten zum langersehnten Schmause für Herz und Ohr, und – da rauscht es hervor aus dem goldenen Born:
„Gott grüße Dich! Wenn dieser Gruß
So recht von Herzen geht,
Gilt bei dem lieben Gott der Gruß
So viel als ein Gebet.“
Und wem galt dieser Gruß? Du räthst es, lieber Leser! Wenn das Volkswort wahr ist, so muß es in diesem Augenblick mächtig in den Ohren einer edeln Dame geklungen haben, und in den Ohren wahrlich nicht allein, sondern wie uns: im frohen Herzen! – Und als der feierliche Gruß verhallt war, da wurde der neue Hausfreund in allen möglichen Rede-Variationen erst recht herzlich willkommen geheißen, hatte er doch für uns und zu uns gesprochen mit aller Innigkeit reiner, wohliger Harmonien.
Nun galt es, Umschau und Heerschau zu halten über den ganzen musikalischen Apparat; ob ihm die lange Herreise geschadet, ob Auf- und Abladen, ob Stoßen, Schütteln und Rütteln dem kostbaren Werke Uebles gethan! Doch Alles in schönster Harmonie: jede Taste, jeder Hammer, jede Saite in voller, guter Ordnung.
Aber ein buntes Auditorium drängt mich von meiner Ocular-Inspection hinweg! Die noch nie gehörten, ja die unerhörten prachtvollen Tonwellen, die aus den kleinen Schulhausfenstern in die Gassen des Dorfes hinauswogen, sie rufen die halbe Gemeinde herbei, Alt und Jung, Reich und Arm wundert und freut sich über die Einkehr solcher Herrlichkeit bei ihrem Lehrer, und, was soll ich’s verheimlichen, der Anblick dieses Auditoriums voll staunender Neugierde und herzlicher Theilnahme bewegt mich, auf’s Neue und voll und kräftig in die Tasten zu greifen, und was ich einst geträumt, geliebt, geweint, gelacht, das stieg da vor mir auf und wurde zum musikalischen Gebilde und Gebet!
Endlich bin ich allein mit den Meinen! Der Abend neigt sich tiefer, aber die Brust, heute so reich und weit, hebt sich höher und meine Gefühle lösen sich in den Accorden des herrlichen Chorals „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren!“ Ja, ich kann wieder freudig singen: „Lasset die Musicam hören!“ Ist sie doch jene Himmelstochter, mit und durch deren Hülfe ich mit Pestalozzi sprechen kann: „Es wird heiterer!“ Wie manches Lehrerherz haucht in der Sprache der Saiten all’ seinen Schmerz, sein Wehe aus und bricht durch ihre Gewalt einer stillen, heiteren Ergebung Bahn!
Wir aber, meine lieben Collegen von nah und fern, die wir gleiches oder ähnliches Glück theilen und genießen: laßt uns nicht erröthen ob der uns gewordenen Gaben; stand doch auf allen die Devise: „Laß die Linke nicht wissen, was die Rechte thut!“ So lange der deutsche Aar noch nicht die Kraft ober den Willen hat, uns mit seinen Fittigen gegen die Drangsale des Mangels zu schützen, so lange wollen wir uns gern von der Taube der Wohlthätigkeit den Oelzweig der Freude in unser Haus bringen lassen. Es müßte schlimm um ein Herz stehen, das von einer That echter Menschen- und Bruderliebe sich in seiner Standeswürde gekränkt fühlen könnte.
gingen wieder ein: Kirchner in Neustadt a. H. 10 Thlr.; M. G. in Leipzig 5 Thlr.; W. O. in Gotha 1 Thlr.; Bienenzüchterverein in Oberfrohna 6 Thlr. 10 Ngr.; M. K. in Lützen 2 Thlr.; F. Thieme in Dresden 3 Thlr.; Rittmeister V. in Forchheim 4 Thlr.; A. F. in Teterow 1 Thlr.; F. B. 1 Thlr.; A. R. in Amberg 4 Thlr.; C. R. in Langenfels 1 Thlr.; Scat in Elberfeld 4 Thlr.; aus dem Spartopf von Josefa, Elsbeth und Christine in Asch 2 Thlr.; A. Mörath in Schwarzenberg 5 Thlr.; Kegelclub A. in Oederan 12 Thlr.; C. F. in Baden-Baden 1 Thlr.; Vendel in Uckrath 1 Thlr.; M. A. u. M. Heubes in Toul 2 Thlr.; aus der Sparbüchse von Hans, Clotilde, Anette und Maria 4 Thlr.; Schreck in Saalburg 1 Thlr.; Janeck in Dresden 10 Thlr.; N. N. in Altena 5 Thlr.; Wehr in Heilsberg 5 Thlr. 5 Ngr.; Privatschule in Wilsdruff 2 Thlr. 10 Ngr.; aus Schandau 5 Thlr.; Trockne Körnlein vom Lippeschen Sand, trocknen Ein Thränlein am Ostseestrand 2 Thlr.; Lehser in Schmalkalden 1 Thlr.; aus Heidelberg 20 Reichsmark = 6 Thlr. 20 Ngr.; von den Schulkindern in Pfiffelbach 6 Thlr. 15 Ngr.; Lehrer Frankenstein daselbst 1 Thlr.; Kaiserslautern 1 Thlr.; Eine Böhmakin in Asch 1 Thlr.; Deutsche Gesellschaft in Venedig 20 Thlr.; J. Hänsel in Borna 2 Thlr.; Julius Peter 2 Thlr.; R. in Freiburg 2 Thlr.; Tilly in Königsbrück 1 Thlr.; aus Leipzig 5 Thlr.; aus Therese’s Sparcasse 1 Thlr.; E. und M. in Markneukirchen 5 Thlr.; Notar Schäzler in Scheinfeld 2 Thlr.; G. M. in Ostrach 1 Thlr.; aus der vorjährigen Christbescheerung der Gartenlaube 13 Thlr.; Schreiber in Tiefenbrunn 3 Thlr.; A. B. in Buckow 1 Thlr.; Gesangverein Cäcilia in Chemnitz 3 Thlr.; Reußner in Cunnersdorf 1 Thlr.; Brutal Nachf. in Chemnitz Thlr.; Anna W. in Lengefeld 1 Thlr. 22⅓ Ngr.; A. Sch. in Lauenstein 1 Thlr.; L. M. in Marburg 1 Thlr.; Schüler der ersten Classe der Schule zu Kändler 1 Thlr.; Dankwarth in Pechanin 2 Thlr.; aus Dresden 20 Thlr.; M. K. in Tetschen 1 Thlr.; Ben Manssur 10 Ngr.; Dittrich Opelt in Rumburg 12 Thlr.; Bremser August Weise 1 Thlr.; von der Kegelgesellschaft Friendship in Leipzig 10 Thlr. 10 Ngr. mit den Worten:
Es war das Geld bestimmt zum heil’gen Christ,
Doch opfern wir es gern Euch armen Kindern,
Und wenn’s auch nur ein kleines Scherflein ist,
So hilft’s doch mit das große Elend lindern.
O. A. in Köln 1 Thlr.; Emilie 1 Thlr.; J. Köberlin in Leipzig 3 Thlr.; von der zweiten Mädchenclasse der evangelischen Stadtschule in Hirschberg 2 Thlr.; aus Oschersleben, wenig aber herzlich 1 Thlr.; Gustav Berger in Burgstädt 5 Thlr.; von den Schulkindern der Parochie zu Gautzsch 5 Thlr. 2 Ngr. 2 Pf.; Karl W. in Hanau 2 Thlr.; aus Kötschenbroda 5 Thlr.; aus Barmen, von Einem, der auch Trost und Hülfe sucht 3 Thlr.; R. S. in Raschau 10 Thlr.; von einigen Lesern der Gartenlaube 3 Thlr. 10 Ngr.; Edmund in Leipzig 10 Thlr.; aus Leipzig 1 Thlr.; bei Baarmann in Leipzig gesammelt von sieben deutschen Herzen 7 Thlr.; ein Unbekannter aus Leipzig 1 Thlr.; A. O. 1 Thlr.; Gero und Melanie 10 Thlr.; durch M. Ullrich in Hanau 3 Thlr. 2 Ngr. 5 Pf.; aus Stralsund 5 Thlr. mit den Worten:
Den ersten Kuß empfing ich heut’ von Liebchens Mund,
D’rum geben Sie dies Geld den Armen von Stralsund.
Nr. 30 A. Z. 5 Thlr.; Professor Bock 10 Thlr.; C. M. in Frankfurt a. M. 2 fl.; Ch. H. in Michelstadt 4 fl.; aus Bamberg mit dem Motto: Viel hab’ ich nicht der Güter, jedoch ein Herz für Brüder, 10 fl.; F. B. H. in Frankfurt a. M. 10 fl.; H. J. in Stollberg 18 Ngr.; von den neunundzwanzig Waisen der G. Seyler’schen Waisenanstalt zu Wüstewaltersdorf i. Schl. Thlr.; für’s arme Kind am Ostseestrand 1 Thlr. 10 Ngr.; F. S. in Genf 5 Thlr.; von dem Dichter Karl von Holtei in Breslau 33 Thlr. 10 Ngr. mit den Worten:
Es behauptet durchaus die „Gartenlaube“:
Sie schulde mir noch ein Honorar?
Eine Behauptung, an die ich nicht glaube;
Zum Mind’sten ist mir die Sache nicht klar.
Doch da Jene den guten Ausweg gefunden,
Das Sümmchen wohlthätigem Zwecke zu weih’n,
Fühl’ ich mich ihr sogleich verbunden,
Und stimme aus ganzer Seele ein:
Was ich angeblich gut noch habe,
Mit Danke nehm’ ich’s, und biet’ es dann
Als eines alten Sängers Gabe
Nothleidenden deutschen Brüdern an.
- Breslau, November 1872. Holtei.
von dem Prager Hülfs-Comité der in Böhmen Ueberschwemmten empfangen wir noch die für die Letzteren von der Gartenlaube gesammelten Unterstützungsgelder, 188 Thlr. 6 Ngr. 5 Pf., mit der freudigen und dankenswerthen Mittheilung zurück, daß der Noth der böhmischen Unglücklichen hinlängliche Abhülfe geschehen und daß es dem Comité eine große Freude sei, nunmehr das Geld für die Bedrängten an der Ostsee senden zu können. Dem Prager Comité herzlichsten Dank!
Wir bitten dringend, keine Schmuckgegenstände zu senden.
Mit dieser Nummer schließt das vierte Quartal und der zwanzigste Jahrgang unserer Zeitschrift. Wir ersuchen daher die geehrten Abonnenten, ihre Bestellungen auf das erste Quartal des neuen Jahrgangs (Preis 16, nicht 15 Ngr.) schleunigst aufgeben zu wollen.
Wir sind in der angenehmen Lage, unsern Lesern mittheilen zu können, daß dieser nächste Jahrgang folgende Erzählungen veröffentlichen wird:
denen sich kleine Novellen von E. Wichert („Schuster Lange“), Werber („Ein Meteor“) etc. anschließen werden.
Von den demnächst erscheinenden belehrenden Artikeln heben wir vorläufig hervor: Die Württemberger Bastille. Von S. W. – Ein protestantischer Großinquisitor. Von Henne-Am Rhyn. – Goethe. Sein Leben und Dichten. In Vorträgen für die deutschen Frauen geschildert von Johannes Scherr. – Der Rothschild Amerikas und die Geschichte seines Vermögens. Von L. L. in New-York. – Das Wagner-Theater in Bayreuth. Von Otto Gumprecht in Berlin. – Am Grabe der Familie Karl’s des Großen. – Die Unfälle auf Eisenbahnen. Von M. M. v. Weber. – Bühnen-Erinnerungen etc. etc.
- ↑ „Denn“ – sagt der Herr Pfarrer S. 35 seines Treuen Berichts – „eine im Namen der bischöflichen Behörde geschehene Erklärung hat eine außerordentlich große Kraft, die Vorurtheile gegen Besessenheit zu zernichten, die Zweifel niederzuschlagen, den Verdächtigungen ein schnelles Ende zu machen, die wegen dieser Angelegenheit schon lange und heftig entzweiten Gemüther zu einigen und selbst Gelehrte, welche noch nie wie Joseph Görres (‚Die christliche Mystik‘, Manz in Regensburg), dieser große Gelehrte Deutschlands, einen tiefen Blick in die Regionen des teuflischen Reichs gethan, zu ernstem Nachdenken über dergleichen Vorfälle zu bewegen und von deren Wahrheit zu überzeugen.“ So bitter rächen sich die Schriftstellersünden des Lebens noch nach dem Tode! –
- ↑ In Nr. 22 der Gartenlaube ließen wir auf die Bitte eines armen braven Lehrers die Nachfrage nach einem etwaigen „alten abgelegten Clavier“ abdrucken, nicht ganz unbesorgt über die Aufnahme derselben in unserm Leserkreise. Aber schon in Nr. 31 konnten wir über einen Erfolg jener Anfrage berichten, wie ihn schwerlich Jemand im ersten Augenblicke erwartet hatte. In wenigen Tagen war uns ein halbes Dutzend Instrumente zur Verfügung gestellt, und da die Kunde davon auch noch mehr Bewerber herbeirief, so konnten auch mehrere in kurzer Zeit ihre Wünsche erfüllt sehen. Von Einem derselben erhielten wir die Zuschrift, die als ein Gesammtausdruck der Empfindungen und des Dankes für Alle gelten möge. Leider müssen wir mit dieser Notiz die dringende Bitte verbinden, von der Redaction der Gartenlaube nicht mehr zu fordern, als sie leisten kann. Seitdem ein Brief der Redaction an einen der mit einem Instrument bedachten Lehrer durch die Zeitungen läuft, bringt jeder Postbote Dutzende von Lehrerbitten um alte abgelegte Claviere. Wir müßten sie hundertweise zu vergeben haben, um alle Anliegen zu berücksichtigen. Es sind uns im Ganzen nur zehn Instrumente angemeldet worden; vier davon hat die Redaction den betreffenden Lehrern portofrei zugesendet, drei sind von den Gebern direct besorgt worden, und über drei erwarten wir noch die Verfügung der Besitzer. Wie gern wir nun auch alle Zuschriften in dieser Angelegenheit wenigstens mit ein paar Worten des Trostes beantworteten, so ist uns doch bei der Menge derselben auch das unmöglich, und wir bitten, diese Erklärung als Antwort für Alle annehmen zu wollen.D. Red.