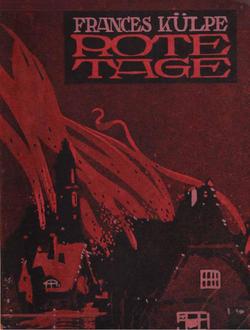Rote Tage
der Revolutionszeit ::
Berlin W.
[5]
[6]
[7] Funkelnd mit leisem Plätschern schaukelten die Wellchen um den Bug des winzigen Passagierdampfers. In einer halben Stunde sollte das fauchende kleine Ungetüm abfahren. In seiner protzigen heisern Stimme, die so wenig im Einklang zu seinem stolzen Namen „Bojarina“ stand, verkündete es prustend und zitternd seine ernstgemeinte Absicht, die kurländische Hauptstadt Mitau zu verlassen.
Eine kühle Septembersonne schien aus halbbewölktem Himmel über das Prunkstück des Städtchens, das rosenrot getünchte, ehemalig herzogliche Schloß, blitzte nachdenklich um den hochaufragenden Trinitatiskirchturm, streifte die welken Kastanienblätter des Schloßparks und verlor sich zitternd in den kleinen unruhig hüpfenden Wellchen des Aaflusses.
Am Landungsplatz tummelten sich geschäftig lettische Gepäckträger, schrien und zeterten ein paar Gemüsehändlerinnen auf einen jüdischen zerlumpten Burschen ein, der ihnen die halbwegs [8] geleerten Marktkörbe über den wackelnden Dampfersteg getragen hatte und nun mit trotzig aufgeworfener Oberlippe auf fünf Kopeken mehr Trägerlohn bestand.
Ein paar jugendliche Lungerer standen, die Hände in den Hosentaschen, grinsend daneben. Aus der Rocktasche des einen lugte verräterisch ein Flaschenhals. Jetzt stießen sie einander an. „Ein richtiger deutscher Kungs!“ sagte der eine halblaut. „Wohl so’n Baron. Sieh, was der für’n feinen Koffer hat! Oder ist’s der hinkende Teufel selber; das linke Bein ist ihm ja zu kurz geraten. Und das da ist wohl das gnädige Fräulein Braut? Nu, ich, Jahn Kalning, hätt’ mir eine frischere ausgesucht; dünn wie’n Brett!“ Sie brachen in ein rohes Gelächter aus.
„Platz da!“ sagte die ruhige Stimme des Herrn. Er trug einen grauen Überzieher und einen weichen Filzhut mit breiter Krempe. Seine Rechte stützte sich auf einen Stock mit silbernem Griff, in der Linken trug er einen Handkoffer. Er war soeben aus einer Droschke gestiegen, ihm folgte in einiger Entfernung eine junge Dame; ihres Gepäcks hatte sich der jüdische Bursche bemächtigt und drängte eilig vorwärts. Dabei stieß er den Herrn mit dem Koffer unsanft in den Rücken.
Ärgerlich drehte sich der Herr um; als er die biegsame Gestalt der jungen Dame erblickte, lüftete er den Hut und ließ ihr den Vortritt auf dem Brettersteg. Sie grüßte leicht und schritt an ihm vorüber. Er folgte.
[9] „Ein Billet erster Klasse bis Annenburg!“ sagte das Fräulein klar und bestimmt. „Wann sind wir in Annenburg?“
„Um fünf Uhr nachmittags!“ war die Antwort des dicken, rotbäckigen lettischen Kapitäns. Er stand am Schalltrichter. „Fertig!“ rief er dann in den Maschinenraum hinab.
Von kräftigen Bauernfäusten wurde der Brettersteg auf den Dampfer gezogen, noch einmal ertönte wütend und verdrossen zugleich der trompetenartige Ton der Dampfpfeife, und fauchend und prustend begann das Fahrzeug sich leise zu drehen.
So, als gewönne das häßliche kleine Dampfschiff durch die Bewegung allmählich ein wenig gute Laune wieder, stieß es jetzt noch einen heisern Schrei aus und paddelte in zorniger Geschäftigkeit stromaufwärts. Mitaus Häuserreihen strichen langsam vorüber, das Schloß, die Trinitatiskirche, die alte Mühle auf dem andern Ufer streckten sich neugierig, die Eisenbahnbrücke wölbte sich einige Momente über dem gedrungenen Schornstein des Dampfers, und links und rechts breiteten sich flache grüne Ufer mit bewaldeten Strecken vor den Augen der jungen Dame.
Sie stand in Gedanken versunken am Schiffsrand und blickte mit großen grauen Augen in die bläulichen Waldfernen. Sonnenschirm und Plaidriemen lagen auf der Bank; ihr Koffer nahm sich neben dem eleganten Gepäckstück des Herrn recht bescheiden aus, obgleich er viel größer war.
Hinter ihr, auf der gegenüberstehenden Bank, hatte sich der Herr niedergelassen. Er hielt sein offenbar steifes Bein von sich [10] gestreckt und hatte seinen Spazierstock als Stütze daruntergeschoben. Seinen Oberkörper beugte er seitwärts vornüber und starrte über den Schiffsrand in das wirbelnde Wasser, das schäumend von dem Rade spritzte. Das glattrasierte ausdrucksvolle Gesicht mit dem blonden Haar erinnerte an den Kopf eines Schauspielers. Eine nervöse Falte auf der breiten Stirn vertiefte sich langsam; lässig stützte er den linken Arm auf den Schiffsrand und begann mit dem zweiten und dem kleinen Finger einen Triller auf der Holzbrüstung zu spielen.
Mit einem kleinen Seufzer hatte sich das junge Mädchen von dem gleichförmigen Landschaftsbilde abgewandt und Platz genommen. Ihr Blick streifte ihr Gegenüber und blieb amüsiert an den unentwegt forttrillernden Fingern haften. Dann schlug sie den grauen Schleier ihres Reisehütchens zurück, nahm aus der Tasche ihres Regenmantels ein Büchlein und begann zu lesen. Ihr zartes blasses Profil mit den feingeschwungenen dunklen Augenbrauen und dem beseelten Ausdruck hob sich weiß und leuchtend von dem Grün der Wiesen ab, an denen der kleine zornige Dampfer prustend vorüberschwamm. Sie mochte die allererste Jugend überschritten haben, ein energischer Zug um die schmerzlich zusammengepreßten Lippen verriet, daß sie das Sichbescheiden gelernt hatte.
Nun stolperte ein breitschultriger Mann herbei und fragte, ob die Herrschaften etwas zu speisen wünschten.
„Ich bitte um ein Glas Tee mit Zitrone,“ sagte das Fräulein kurz.
[11] „Eine Portion Kaffee mit Brot, Butter und Schinken,“ bestellte der Herr.
Eine Viertelstunde später erschien das Schiffsfaktotum wieder mit einem Tablett auf der Schulter. In der Hand schleifte der Mann einen kleinen Tisch. „Befehlen Sie das Frühstück auf einem Tisch?“ fragte er.
„Das hängt von der Dame ab. Ist’s Ihnen recht, gnädiges Fräulein?“ Der Herr war aufgestanden und verbeugte sich höflich nach dem jungen Mädchen hin.
Sie nickte.
Geschäftig trug der Schiffsdiener zwei Klappstühle herbei, deckte den Tisch und stellte das Tablett darauf. „Es ist angerichtet,“ sagte er.
Die junge Dame stand auf. „Bitte!“ sagte sie mit einer einladenden Handbewegung.
„Mein Name ist Ernst Philippi,“ sagte der Herr verbindlich.
„Claire Schenkendorff.“
Beide setzten sich einander gegenüber.
„Wir scheinen ja die einzigen Passagiere erster Klasse zu sein. Das ist ein Ausnahmefall, denn sonst pflegt ja gerade der September die müßigen Städter zur Jagd aufs Land hinauszulocken. Auch die Landwirte und Gutsbesitzer sind heute merkwürdig seßhaft.“
„Aus dieser Bemerkung darf ich wohl schließen, daß Sie nicht zu den müßigen Städtern gehören, Herr Philippi,“ sagte [12] das junge Mädchen mit einem halben Lächeln, „auch daß Sie weder Landwirt noch Gutsbesitzer sind.“
„Das stimmt allerdings. Ein müßiger Städter bin ich nicht, doch habe ich auch keinen festen Beruf, wenigstens jetzt nicht,“ verbesserte er sich. „Ich benutze daher meine freie Zeit zu einem Landbesuch bei einem alten Studiengenossen und Jugendfreunde.“
„Und ich,“ sagte die junge Dame, „trete eine neue Stelle als Lehrerin an.“ Sie seufzte.
Teilnehmend blickte er zu ihr hin. „Das klingt bei Ihrer Jugend seltsam.“
„O bitte, ich bin fünfundzwanzig Jahre alt,“ sagte sie einfach, „und an seltsame Wechselfälle bin ich gewöhnt. Dies ist bereits meine dritte Stellung. Das ist ja das Harte in unserm Beruf, daß man nirgends Wurzel fassen kann. Hat man sich einigermaßen in eine Familie eingelebt, so entwachsen die Kinder nur allzubald unsrer Leitung, und dann heißt es, sein Bündel schnüren und dieselbe Arbeit auf neuem Boden von vorn beginnen. Aber dies ist auch das letztemal, daß ich zu einer Familie ziehe,“ fuhr sie energisch fort. „Ich habe nämlich in zwei Jahren die Anwartschaft auf eine feste Anstellung in einem Petersburger Institut, und dort will ich dann bleiben,“ schloß sie befriedigt, nicht ohne einen Anflug von Selbstironie, „bis ich alt und grau werde!“
Er sah sie betroffen an. „Halten Sie denn die Aussicht für so erstrebenswert?“ fragte er. „Das Arbeitsmaterial, die [13] Schuljugend meine ich natürlich, wechselt ja auch von Klasse zu Klasse.“
„Aber dann habe ich doch ein dauerndes Heim!“ rief das junge Mädchen mit glänzenden Augen. „Ich habe mein eigenes Zimmer, mein Zuhause, aus dem mich niemand vertreiben kann, mein eigenes Kopfkissen, meine eigenen Möbel!“ Es klang beinahe triumphierend.
Armes Kind! dachte der Mann mitleidig. „Wie anspruchsvoll sind doch wir Männer im Vergleich dazu!“ sagte er laut. „Ist solch ein bescheidenes Zukunftsbild nicht gar zu bescheiden? Ein eigenes Heim, wie Sie es sich ersehnen, habe ich schon längst, doch stelle ich mir unter meinem Heim etwas ganz andres vor. Eine liebe Frau, glückliche, gesunde Kinder – das ist’s, was ich unter einem Heim verstehe.“
Sie lächelte fein. „Gewiß,“ sagte sie, „warum sollten Sie nicht? Sie sind ja ein Mann.“
„Und ein Krüppel,“ fügte er bedächtig hinzu.
Nun mußte sie hell auflachen. „Verzeihen Sie,“ bat sie, „ich bemerkte vorhin, daß Ihr Knie ein wenig steif ist; da können Sie aber unmöglich das tragische Wort ‚Krüppel‘ auf sich anwenden.“
„Und doch bin ich viele Jahre einer gewesen,“ beharrte er ernsthaft. „Jahrelang habe ich sitzend in einem Rollstuhl verbracht. Die lustigen übermütigen Spiele einer Knabenjugend kenne ich nur aus der Anschauung, nicht aus persönlicher Erfahrung [14] Eine besondere Vergünstigung war es für mich, daß ich die oberen Gymnasialklassen im Rollstuhl durchmachen durfte. Ja, ich habe eine bittere Jugend hinter mir, und ich fühle, ich bin auf dem geradesten Wege, ein Sonderling zu werden.“
Die grauen Augen des Fräuleins leuchteten auf. „Ein Sonderling!“ wiederholte sie leise. „So nennt mich meine Tante, die mich erzogen hat, schon seit Jahren. Eigentlich müßte ich ihr den Titel zurückgeben, denn ein sonderbareres Wesen als meine Tante habe ich nie gesehen. Freilich wurde mir das erst klar, als ich unter andre Menschen kam, und seitdem ich anfing zu vergleichen. Meine Mutter hab’ ich nie gekannt, sie starb gleich nach meiner Geburt; meinen Vater hab’ ich nur zweimal gesehen, auch er ist schon lange tot. Erzogen hat mich meine Tante Griseldis, und die war, solange ich zurückdenken kann, Klassendame im Katharineninstitut in Petersburg. Steif, würdevoll, manieriert, von einer unendlichen befehlenden Höflichkeit des Benehmens war sie. ,Vous aurez la bonté de vous lever à l'instant, Claire' – so pflegte sie mich morgens zu wecken. ,Avez-vous debarassé votre coeur aux pieds du Seigneur?' – das war ihr Gutenachtgruß. Sie war die Ordnungsliebe und Pünktlichkeit in Person. Zärtlichkeiten durfte ich mir ihr gegenüber nur in unserm Stübchen erlauben, vor den Schülerinnen hielt sie mich besonders streng, denn man sollte ihr nicht nachsagen dürfen, daß sie ihre Nichte bevorzugte. Ich war ein lebhaftes Kind, und als ich ihr einst mit ausgebreiteten Armen auf dem Schulkorridor [15] entgegenlief und sie ungeschickt anrempelte, mußte ich eine Stunde lang nachsitzen. ,Vous aurez la bonté de comprendre, Claire,' sagte sie mir später, ,que je n’ose jamais faire des exceptions pour vous.' Aber leicht mochte es ihr nicht geworden sein, denn sie hatte damals Tränen in den Augen. Es war ja schon ein mächtiger Ausnahmefall, daß sie mich in ihrer Stellung bei sich behalten durfte. Zu meinen schönsten Erinnerungen gehören die Sommerferien, die ich mit Tante Griseldis in dem Hause einer befreundeten russischen Gutsbesitzersfamilie auf dem Lande zubrachte. Da lernte ich wirkliches Familienleben kennen. Da gab es große Gärten, Spielplätze, einen echten Tannenwald, Felder, Wiesen, Haustiere und wilde Knaben.“
„Haustiere und Knaben!“ wiederholte Ernst Philippi lächelnd.
Sie errötete und lachte herzlich. „Sie haben recht, zu spotten,“ sagte sie, „aber denken Sie bloß, Haustiere und Knaben, das waren für mich armen Schößling eines Mädcheninstituts zwei gleich fernstehende Dinge. Außer einem lahmen Pensionskater gab es keine Tierseele in unserm Hause. Und Knaben ebensowenig. Wie oft habe ich mich nach einem Bruder gesehnt! Die kleinen Mädchen im Hause liebten ihre Brüder zärtlich und wurden von ihnen zwar gründlich geneckt, aber auch anderseits ritterlich beschützt.“
„In dieser Beziehung bin ich besser dran gewesen als Sie", sagte Ernst Philippi; „ich habe zwei Schwestern, und sie haben [16] mich auch in ihrer Art verzogen. Zum ritterlichen Beschützer taugte ich zwar nicht, doch habe ich ihnen stets ihre deutschen Aufsätze gemacht. So war ich doch zu etwas nütze.“
Ein bitteres Lächeln glitt über seine Lippen.
Erschrocken sah Claire zu ihm hin.
„An einem Kurorte – ich glaube, es war in Karlsbad –“ fuhr er fort, „war ich in einer Pension mit einem taubgewordenen Musiker zusammen. Etwas Herzzerreißenderes als das Lachen dieses armen Tauben habe ich nie erlebt. Er wollte doch auch einmal fröhlich sein, und hatte er denn nicht ein Recht darauf? Er war ja Mensch und seinen Anlagen nach ein reicherer Mensch als wir andern, denn trotz seines toten Gehörs vernahm er innerlich Musik, und so war er auch mit sich im reinen, solange er allein war. Unter Menschen aber schien er sich seines ganzen Jammers bewußt zu werden; da lachte er oft grundlos und zornig auf, oder wenn die andern fröhlich scherzten, saß er da mit zusammengezogenen Brauen und brütete finster vor sich hin, um dann plötzlich an unrechter Stelle zu wilder Heiterkeit überzugehen. Sie sehen mich verwundert an, mein Fräulein, und denken: Wozu erzählt er mir diese traurige Geschichte? Sie steht doch in keinem Zusammenhang mit diesem wohlsituierten Herrn. Und dennoch – das ist gewissermaßen meine Geschichte!“
„Ihre Geschichte?“ Die Augen des jungen Mädchens wurden weit und groß.
[17] „Gewissermaßen,“ sagte ich. „Aber um Ihnen das zu erklären, müßte ich ziemlich weit ausholen. Mein Vater, ein griesgrämiger, strenger Mann, wünschte sich nach zwei Töchtern nichts sehnlicher als einen Sohn. In einem kräftigen, gesunden Träger seines Namens wünschte er ein altes Predigergeschlecht aufleben zu sehen, das in meinem Großvater erloschen war und seit drei Jahrhunderten mit Ehren bestanden hatte. Mein Vater selbst hatte es nur zum Apotheker gebracht. Mein Eintritt in die Welt war von einem bösen Omen begleitet, ich wurde mit einer gebrochenen Hüfte geboren. Die Hüfte wurde zwar geheilt, ich aber blieb ein schwächlicher, zarter Bub, und nach einem unglücklichen Sturz wurde ich ein Krüppel. Mein Bein war und blieb steif. Die strenge, düstere Atmosphäre meines Elternhauses reifte nur eine Sehnsucht in mir: den brennenden Wunsch nach Leben und Freude. Ich war einst im Theater gewesen, man hatte den ‚Don Carlos‘ gespielt. Ich wollte Schauspieler werden – Schauspieler mit einem lahmen Bein!“
„Ich hielt Sie für einen Schauspieler,“ sagte das Fräulein leise.
„Nun, um es kurz zu sagen: alles übrige dazu fehlte mir nicht: Stimme, Vortrag, Leben und das angeborene geheimnisvolle Etwas, was den Künstler macht. Ich lernte gut und leicht, ich hatte unzählige Rollen im Kopf und unterzog mich willig den schmerzhaftesten Kuren. ‚Laßt dem Jungen seinen Spleen,‘ sagte meine sanfte Mutter. Sie wußte nicht, wie grausam diese Sanftmut war. So wiegte ich mich immer tiefer in meinen [18] Glückstraum ein. Konnte ich erst gehen und stehen, so gab es vielleicht eine Möglichkeit, die Steifigkeit meines Beins zu verdecken. Ich machte ein gutes Abiturium, und dann – ja, dann kam das bittere Erwachen. ‚Ich bin mit Dir zufrieden, mein Sohn,‘ sagte mein wortkarger Vater in seiner strengen Art, und es klang so, als verkündige er mir eine bittere Strafe. ‚Es ist an der Zeit, daß du dir die dummen Schauspielerflausen aus dem Kopf schlägst. Ein lahmer Schauspieler, das ist ein Unding, und ein Rollenfach für Lahme wie ein Helden- oder Liebhaberfach gibt’s einfach nicht. Dagegen bist du als Theologe am besten gegen dein Ungemach gewappnet, du kannst es seelisch und geistig überwinden und dir eine hervorragende, angesehene Stellung schaffen. Zudem weißt Du, es ist mein Herzenswunsch, daß die unterbrochene Reihe der Theologen unserer Familie[WS 2] in dir eine würdige Fortsetzung finde.‘ So mein Vater. Und ich muß ja zugeben, daß er von seinem Standpunkt recht hatte. Aber er rechnete nicht mit dem heißen zurückgedrängten Künstlertriebe eines leidenschaftlichen Jünglings. Ich fiel in eine tiefe, schwere Bewußtlosigkeit, und als ich erwachte, war ich ein gebrochener Mensch. Ich studierte Theologie, ich ward ein Musterknabe; ich tat alles, was man von mir verlangen konnte, ich machte sogar ein Examen um das andre – aus Pflichtgefühl, ohne jegliche Freude an meiner Wissenschaft – machte sogar meinen Kandidaten und trat auf die Kanzel zur Probepredigt. Doch da wurde mir das Ungeheure klar, das ich zu begehen im Begriff war: ich [19] wollte die Kanzel zu einem Beruf mißbrauchen, den ich nicht in mir fühlte. Ich erklärte meinem Vater meinen Zwiespalt. Er konnte oder wollte mich nicht verstehen, und da kam es so weit, daß ich ihm, dem Erben einer Theologengeneration, auseinandersetzen mußte, daß mir die Kanzel zu heilig sei, um sie zum Piedestal meines bürgerlichen Vorwärtskommens zu erniedrigen. Es gab einen Riß zwischen ihm und mir, und ehe der verheilte, traf ihn der Schlag, und er starb.“
Leise und monoton hatte Philippi gesprochen. Trübe fuhr er fort: „Was bin ich jetzt? Ein Theologe ohne Beruf! Ein Künstler ohne das primitivste Handwerkzeug – ein Krüppel, nicht nur am Körper, ein Krüppel auch an der Seele – der Erbe und Kummer meines verstorbenen Vaters, die Enttäuschung meiner Familie – – eine traurige Mißgeburt also!“ Er lächelte bitter. Unablässig schlug er seinen Triller auf der Tischplatte.
„Sie sind ein ehrlicher Mensch!“ sagte plötzlich die Stimme der jungen Dame fest und laut. „Und das sind nicht viele!“
Er blickte auf. Das junge blasse Mädchengesicht ihm gegenüber leuchtete von Wärme und Mitgefühl. Die dunklen Härchen über den kleinen Ohren zogen sich kraus zusammen und glänzten in der Sonne. In diesem Augenblick war sie schön.
Er streckte ihr die Hand entgegen. „Ich danke Ihnen,“ sagte er einfach. „Es ist mir lieb, daß Sie eine gute Meinung von mir haben, obwohl“ – er lächelte sarkastisch – „das Ehrlichsein noch herzlich wenig sagen will.“
[20] Sie schien nicht hinzuhören, denn plötzlich und unvermittelt fragte sie: „Haben Sie den Rezitator Türschmann gehört? Er war blind.“
„Gehört nicht, aber in Mitau auf der Straße gesehen. Wie kommen Sie auf den?“
„Man hat manchmal seltsame Ideenverbindungen[WS 3],“ sagte sie und stand auf. „Ob die Uhr bald fünf ist?“ fragte sie in gänzlich verändertem Tone.
Er zog die Uhr. „Zehn Minuten nach vier,“ sagte er und sah schmerzlich betroffen zu ihr hin.
Wie stand sie ihm plötzlich kühl und unnahbar gegenüber, sie, der er soeben sein zuckendes Innenleben offenbaren konnte! Was war mit ihr vorgegangen? Hatte er sie durch irgend ein hingeworfenes Wort verletzt? Was hatte er denn gesagt? In Gedanken wiederholte er sich die Wendung, die das Gespräch genommen hatte.
„Verzeihen Sie,“ begann er wieder, „wie kamen Sie auf Türschmann?“
„Nun, das ist doch sonnenklar,“ sagte sie. „Das ist auch ein Mann gewesen, dessen großes schauspielerisches Talent in der Blüte seiner Kraft durch Blindheit gebrochen war. Da wurde er eben Rezitator.“ – „Es ging eine dämonische Kraft von ihm aus,“ fügte sie nach einer Pause hinzu.
„Seine Frau begleitete ihn auf seinen Vortragsreisen. Man sagt, sie lese ihm die Dramen solange vor, bis er sie könne. Was [21] muß das für eine bewunderungswürdige Frau sein!“ murmelte er in Gedanken versunken.
Eine rasche Antwort unterdrückend sagte das junge Mädchen mit leisem Spott: „Sie hätten in ähnlichem Fall eine Frau nicht nötig; Sie können ja sehen.“ Dann nahm sie ihr Büchlein wieder auf und fuhr fort zu lesen.
Nachdenklich setzte sich Ernst Philippi auf seinen früheren Platz. Eine trübe Stimmung war leise über ihn gekommen. Verstohlen betrachtete er das junge Mädchen. Ihr schmaler Fuß mit dem hohen Blatt bewegte sich nervös tippend auf und nieder. Ihre ganze feine, zierliche Gestalt hatte etwas von der geschlossenen Elastizität eines jungen Rehs. Die kleine Hand mit dem bläulichen Geäder hielt das Büchlein, und an der Bewegung ihrer Lider sah er, wie schnell sie die Zeilen überflog.
„Schif–fe, die nachts sich be–geg–nen,“ buchstabierte er mühsam zusammen. Ob sie auch schon ihrem Schiff begegnet ist? fuhr es ihm durch den Sinn. In der Mädchenpension – ha ha! Aber später vielleicht auf ihren beiden Stellungen. Wer kann’s wissen? Er starrte gedankenvoll auf die vorbeifliegenden grünen Ufer, und ein unerklärliches Gefühl legte sich ihm schwer auf die Brust. Eine Ziegelbrennerei mit hohem Schlot erhob sich vor ihm, graugrünes Weidengebüsch, ärmliche Niederlassungen, ein paar saubere lettische Ziegelhäuser ... Schiffe, die nachts sich begegnen, summte es in ihm fort. Warum auch nicht tags? Schiffe, die tags, die heute sich begegnen!
[22] Er zuckte zusammen, ein freudiger Schreck fuhr ihm durch die Glieder. Ein weites großes Glücksgefühl erhob sich in seiner Seele. Impulsiv stand er auf und machte einige Schritte zu seiner Reisegefährtin hin. Erstaunt blickte sie auf.
„Ich danke Ihnen,“ begann er bewegt, „für die schönen Stunden unsers heutigen Zusammenseins. Ich habe noch nie so ehrlich mit jemandem von mir selbst geredet. Es war mir Bedürfnis, Ihnen das zu sagen, Fraulein Claire – – Claire!“ rief er.
Ihm war, als sähe er einen breiten glänzenden Strom vor sich, und stände er auf einer schwebenden Brücke, unter sich den glitzernden Strom ...
Sie sah ihn ruhig an, und der glitzernde Strom versank in ein Nichts, die schwebende Brücke verschwand. Er stand auf einem kleinen zornigschnaubenden Dampfer, und vor ihm saß eine junge wohlerzogene Dame, die eine neue Gouvernantenstellung antrat, und las in einem Buche: „Schiffe, die nachts sich begegnen“, und er war ein lahmer Theologe, ein gebrochener Mann ...
Eine dunkle Röte der Verlegenheit flog über ihre Stirn. „Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, Herr Philippi – ich ... ich danke Ihnen für ihr Vertrauen, ich spreche mich auch ungern über mich selbst aus; heute tat ich es, und Tante Griseldis hätte sich sicher sehr über mich gewundert.“
[23] Da hob er die Hände. „So lassen Sie um Gottes willen Ihre Tante Griseldis aus dem Spiel!“ sagte er fast heftig. „Was hat diese würdige Dame zwischen Ihnen und mir zu schaffen?“
Erkältet, verletzt sah sie ihn an. „Ich verstehe Sie nicht,“ sagte sie kühl. Die warme Stimmung zwischen ihnen war verflogen.
Er verstand sich selbst nicht mehr. Halte, halte das Glück! rief es in ihm. Vergebens – es zerstob ihm unter den Fingern wie perlendes glänzendes Wasser. Mit einer steifen Verbeugung sagte er: „Verzeihung, gnädiges Fräulein, ich unterbrach Sie in Ihrer Lektüre.“
„Oh – tut nichts,“ sprach sie mit konventionellem Lächeln und sah in ihr Buch hinein. Aber um ihre Mundwinkel zuckte es wie bei einem kleinen Kinde, als wolle sie weinen.
Er setzte sich steif auf seinem Platz zurecht und starrte ins schäumende Wasser. Wirbelnd mit unheimlicher Geschwindigkeit tanzten sein zweiter und kleiner Finger ein Presto con fuoco auf der Geländerbrüstung.
So saßen sie beide in düsterm Schweigen. Das stoßweise Klappern des Schiffsrades schlug den Takt dazu ...
Claire wandte eine Seite ihres Büchleins um die andre um, sie las mechanisch; plötzlich aber mußte sie eine Stelle darin gefesselt haben, sie überlas sie noch einmal, und sacht fuhr ihre Hand in die Tasche ihres Mantels und brachte ein Tüchlein [24] hervor. Verstohlen wischte sie sich die Augen. Plötzlich stand sie auf und ging in die enge Kajüte hinunter.
Sie blieb lange unten. Endlich vernahm sie, daß das Dampfrad langsamer und wie in giftigem Zorn lauter aufschlug, die schrille Dampfpfeife kreischte dröhnend, und ruhiger schütterte das griesgrämige Fahrzeug auf ein grünes Ufer los.
Vor dem winzigen Kajütenspiegel strich sich Claire die Haare zurecht, zog den Schleier herab und eilte die Treppe hinauf. „Sind wir schon in Annenburg?“ fragte sie mit unbewußter Steifigkeit.
„Dies ist Garosen, eine Station vor Annenburg,“ erwiderte Ernst Philippi höflich. Ihn schien der winzige Flecken mehr zu interessieren als seine Reisegefährtin.
Der Steg wurde hastig auf das Ufer geschleudert, hin und wieder tönten lettische Zurufe, das Schiffsfaktotum setzte einige Körbe mit Kohl und Kartoffeln ans Land, dann erschien eine dicke altliche Dame, echauffiert und mit einer halboffenen ledernen Reisetasche, und begab sich auf das Deck der ersten Klasse. Ihr folgte ein schüchterner junger Mann, er trug einen Handkoffer.
„Daß Sie das nicht wissen,“ begann die Dame laut und ungeniert, „daß Pastor Berger der beste Prediger weit und breit in der Runde ist! Ja, wo haben Sie denn ihre Ohren?“
Claire horchte auf.
„Ich bin ja erst seit kurzem hier in der Gegend, gnädige Frau,“ stotterte der junge Mann, über und über errötend, „da [25] hab’ ich noch nicht Gelegenheit gehabt, Pastor Berger zu hören.“
Ernst Philippi zog ein verzwicktes Gesicht. Ihn schien diese Unterhaltung höchlich zu amüsieren. „Also Pastor Berger erfreut sich eines so vorzüglichen Rufes als Redner,“ mischte er sich in das Gespräch. „Das freut mich, ich kenne ihn von Dorpat her.“
„So?“ sagte die dicke Dame eifrig. „Wie interessant! Aber nicht nur als Redner sucht Pastor Berger seinesgleichen, sondern fast mehr noch als Mensch. In diesen unruhigen Zeiten, wo die revolutionären Hetzer ihr möglichstes tun, um das Ansehen der Deutschen und der Pastoren zu untergraben, hat er sich eine feste Stellung geschaffen und ist in seiner lettischen Gemeinde als Deutscher allgemein beliebt. Das will schon etwas sagen. Schade nur, daß er sich an diese geschiedene Frau gehängt hat!“ Die dicke Dame pustete und warf einen beschwörenden Blick gen Himmel.
„Er soll aber doch überaus glücklich mit ihr sein!“ warf Philippi ruhig ein.
„Ja, wissen Sie“, fuhr die Dame eifrig fort, „was bleibt ihm denn andres übrig? Hat man A gesagt, muß man auch B sagen. Mit diesem Menschen ist’s kein Kunststück, glücklich zu werden.“
„Vielleicht aber wohl eins, ihn glücklich zu machen!“
[26] „Ach herrje!“ echauffierte sich die Dame immer mehr. „Wir haben hierzulande so nette, liebenswürdige Mädchen – die wären selig, einen solchen Mann bekommen zu haben. Da sind zum Beispiel gleich die Freundinnen meiner Tochter – reizende Mädchen, sage ich ihnen, und so gescheit.“
„Ihrem Fräulein Tochter fehlt’s doch auch gewiß nicht an Gaben –“ bemerkte Ernst Philippi lächelnd.
Die Dame stutzte. „Wieso denn? Kennen Sie Eveline?“
„Ich habe nicht die Ehre, Fräulein Eveline zu kennen,“ sagte Ernst Philippi mit seinem verbindlichsten Lächeln, „aber es ist eigentlich selten, daß eine Mutter die Vorzüge der Freundinnen ihres Fräulein Tochter hervorhebt und diese selbst unerwähnt läßt.“
Die dicke Dame wurde rot. Sie wußte nicht recht, sollte sie diese Worte übelnehmen oder sich geschmeichelt fühlen? Sie entschloß sich zu dem letzteren. „Ja, meine Tochter ist ein tüchtiges Mädchen,“ sagte sie mit zufriedener Behäbigkeit, „und so häuslich. Freilich,“ fuhr sie giftig fort, „ein Schöngeist wie die Frau Pastorin Berger ist sie nicht, die malt ja und soll sogar schriftstellern! Weiß der liebe Himmel, wo sie dazu die Zeit hernimmt – wenn man seinem Mann zwei Kinder als einzige Mitgift in die Ehe gebracht hat ... Na, vom Wirtschaften hält die ja wohl überhaupt nicht viel.“
„Wenn der Pastor nur zufrieden ist, das ist doch für meine Cousine die Hauptsache.“
[27] Die Dame starrte ihn entgeistert an, ihr Mund öffnete sich weit vor Schreck. „Ihre Cousine ...? Die Frau Pastorin Berger Ihre Cousine, mein Herr?“ stotterte sie. „Wai, ich will ja nichts gesagt haben – der eine hat diese, der andre jene Geschmacksrichtung, nicht wahr? Der eine liebt zu wirtschaften, der andre mag eben schriftstellern – wie ein jeder kann.“ Sie warf beleidigt die Lippen auf und wandte sich angelegentlich ihrem schüchternen Nachbar zu.
Philippi war aufgestanden und zu Fräulein Schenkendorff getreten. „Dort, jenes massive dunkle Gebäude ist der Annenburgsche Krug,“ sagte er. „Ob uns das Leben jemals wieder zusammenführt, gnädiges Fräulein?“
Scheu blickte sie ihn an. „Ich wünsche Ihnen alles Gute, möchten Sie die Befriedigung finden, die Sie das Verfehlte Ihres Lebens vergessen macht!“ sprach sie leise.
„Das ist ein guter Wunsch, mein Fräulein!“ sagte er warm. „Ich meinerseits wünsche Ihnen, daß Sie sich in Ihrer neuen Stellung so wohl fühlen, daß Sie Ihre Zukunftsträume im Katharineninstitut vergessen.“
„Das werde ich nie!“ rief sie kampfbereit. „Was bleibt mir denn besseres übrig?“ fügte sie resigniert hinzu.
„Also, ich wünsche Ihnen das Bessere,“ sagte er bedeutungsvoll und schüttelte kräftig die kleine Hand.
Sie standen noch eine Weile nebeneinander. Schrill und verdrießlich verkündete die Dampfpfeife, daß das Endziel erreicht [28] sei. Der Dampfer machte eine hastige unelegante Schwenkung, wie eine korpulente bäuerliche Tänzerin, und legte, merklich sanfter geworden, beim massiven Annenburgschen Brettersteg an. Ein unsanfter Ruck – da hielt er; eine Tauschlinge flog über den eingerammten Pfosten.
Ernst Philippis Blicke schweiften suchend über die zusammengedrängten Fuhrwerke am Landungsplatz. „Ah!“ sagte er befriedigt, „ich sehe schon meinen Wagen. Es sind übrigens nur zwei herrschaftliche Equipagen da.“
„Ist ... ist Frau Pastorin Berger wirklich ihre Cousine?“ fragte Claire plötzlich.
Er sah sie lächelnd an. „So ungefähr, wie Sie meine Cousine sind, gnädiges Fräulein. Ich wollte nur der guten Klatschbase das Lästermaul stopfen.“
„Das ist Ihnen prächtig gelungen!“ rief Claire herzlich. „Also leben Sie recht, recht wohl!“ Sie ergriff ihr Handgepäck und schritt leichten Ganges über den Steg, er folgte mit seinem Koffer.
„Ich bringe Ihnen Ihren Koffer nach!“ rief er und kehrte wieder auf das Dampfboot zurück.
Ratlos sah Claire sich um, dann eilte sie auf eine Equipage zu. Sie war mit zwei flinken Füchsen bespannt. Der jugendliche Kutscher trug keine Livree, aber eine neue blaue Mütze.
„Pastorat Kronenthal?“ fragte Claire.
[29] „Ja, ja.“ Der Kutscher zog grüßend die Mütze und zeigte zwei Reihen gesunder Zähne.
„Ich kann nicht Lettisch,“ sagte Claire freundlich. „Noch einen Koffer hab’ ich, der Herr dort bringt ihn.“
Sie stieg in den Wagen, der Kutscher sprang vom Bock und eilte ihrem Reisegefährten entgegen.
„Ei, Granting,“ sagte Ernst Philippi vergnügt, „Euch scheint’s ja gut zu gehen. Ihr seid ja ordentlich breit geworden. Wie steht’s denn im Pastorat? Alle gesund – was?“
„Alle sind gesund und lassen schön grüßen,“ grinste Granting erfreut. „Haben der Herr eine gute Fahrt gehabt?“
„Alle Wetter, gnädiges Fräulein!“ rief Ernst Philippi. „Das ist ja mein Wagen! Wo fahren Sie denn hin?“
„Nach Kronenthal, wenn Sie nichts dagegen haben.“
„Na, da hört aber verschiedenes auf!“ platzte Ernst Philippi lachend los. „Erst nehmen wir da feierlichen Abschied von einander auf Lebenszeit, um nachher in derselben Equipage an denselben Bestimmungsort zu fahren. Das ist ja ausgezeichnet! Oder fahren Sie etwa aufs Gut Kronenthal?“
„Ich fahre ins Pastorat zu Pastor Berger,“ erwiderte Claire belustigt, „und Sie vermutlich auch. Das ist aber komisch!“
„Das ist mehr als komisch, das ist Bestimmung!“ sagte Ernst Philippi ernsthaft. „Schiffe, die nachts sich begegnen – kennen Sie vielleicht zufällig dieses Büchlein?“
[30] Sie wurde glühend rot. „Es war heute meine Reiselektüre,“ sagte sie ohne einen Versuch, auszuweichen.
Das freute ihn. Er reichte ihr vergnügt die Hand und stieg ein. „Also auf gute Weiterfahrt!“ sagte er herzlich.
Die stattlichen Pferde zogen an. Claire bemerkte noch, wie sich eine schwielige Bauernfaust drohend erhob, und wie ein paar verwilderte Köpfe grimmig nach ihnen hinblickten.
„Man scheint uns Deutschen auch hier nicht sehr gewogen,“ sagte sie ernsthaft.
Er zuckte die Achseln. „Das ist das Werk der professionellen Hetzer und Wühler,“ sagte er. „Wir gehen einer schweren Krise entgegen. Das Deutschtum, das sich nach einer siebenhundertjährigen Kulturarbeit hier festgesetzt hat, wird sich seines alten Rechts noch zu wehren haben, und sei es mit den Waffen.“
„Sollte es soweit kommen?“ flüsterte sie.
„Es ist schon zum Teil soweit gekommen. Die Unsicherheit in den Städten nimmt täglich zu, auf dem flachen Lande rotten sich in den Krügen und bei den Gemeindeschullehrern junge unreife Köpfe zusammen, halten sozialdemokratische Brandreden und versprechen dem mißleiteten Volk goldene Berge, sobald sie die Deutschenherrschaft abgeschüttelt haben. Einen Prügelknaben für soziale Mißstände muß man haben, folglich ist der Deutsche das gesuchte Objekt. Direkt gegen die Regierung sich auflehnen, ist ein allzu gefährliches Experiment, das ist Landesverrat; da müssen denn die baltischen Barone und Pastoren herhalten. Auf [31] Wahrheit kommt es diesen Hetzern nicht an, die wird beliebig gebogen und gebrochen, und so erfinden sie die schauerlichsten Geschichten, die nur allzugern geglaubt und nachgesprochen werden. Liest man die lettischen Hetzblätter, so sollte man meinen, unser Bauer seufze unter einem unerträglichen Joch, und dennoch ist er erwiesenermaßen unvergleichlich besser gestellt als der russische Bauer mit seinem Parzellensystem. Aus meiner Knaben- und Studentenzeit – – ich war damals oft auf dem Lande – weiß ich noch recht gut, wie freundschaftlich, ja geradezu patriarchalisch oft das Verhältnis zwischen dem baltischen Adel und der Bauernschaft war. Aber es gärt ja in ganz Rußland, der unglückselige Krieg hat das übrige getan, die Bestechlichkeit der russischen Beamtenwirtschaft ist geradezu sprichwörtlich, und es ist so einfach und bequem, die Deutschen, die ja nie in Rußland ganz heimisch geworden sind, wenigstens hierzulande für die allgemeinen Mißstände verantwortlich zu machen. Der Deutsche steht zwischen Russen und Letten isoliert und hilflos da, folglich heißt es: Nieder mit dem Deutschen!“
Claire hatte aufmerksam zugehört. „Ja, aber verzeihen Sie,“ warf sie ein, „die baltischen Deutschen sind aber auch von einer unerträglichen Arroganz. Ich darf das ja sagen, da mein Vater Livländer ist. Wenn man in Petersburg eine hochmütige Person bezeichnen wollte, so sagte man kurz und bündig: so hochmütig wie eine baltische Baronin. Das ging selbst bis in die Hofkreise hinauf. Ich habe ja auch viel mit russischen Aristokraten [32] verkehrt. Da hieß es niemals: Wer oder was war Ihr Vater? Hier aber in den Ostseeprovinzen ruhen die Leute nicht eher, als bis sie Sie um ihr Pedigree befragt haben, die Persönlichkeit genügt ihnen nicht; und haben sie das festgestellt, dann richten sie ihr Benehmen danach ein. Das ist doch empörend, und die Russen sind darin viel großzügiger, viel menschlicher, möchte ich sagen.“
„Sie vergessen, daß wir Balten allesamt Kleinstädter sind. Eine gewisse konservative Engherzigkeit liegt in dem Wesen des Kleinstädters.“
„Es gibt auch russische Kleinstädter.“
„Nun, die sind auch danach! Übrigens bin ich weit entfernt, die Fehler der Balten zu leugnen,“
„Das freut mich!“ rief Claire mit glänzenden Augen. „Sehen Sie, in meiner vorigen Stellung – es war bei einem kurländischen Baron bei Libau – sah ich einen gebildeten jungen Mann, einen Letten, wieder, den ich bei meinen russischen Freunden auf dem Lande getroffen hatte. Er war Verwalter und ein sehr tüchtiger Mensch. Wie höflich und rücksichtsvoll behandelten ihn die Russen, wie hochmütig und von oben herab die deutsche aristokratische Familie! So etwas muß doch erbittern. Man sprach von ihm nicht anders als „der Kerl“ oder „der Bauernjunge“, während die russische Familie ihn in seiner Abwesenheit immer höflich Peter Petrowitsch nannte.“
[33] „Das sind Einzelfalle,“ sagte Ernst Philippi. „Bedauerliche Einzelfalle gibt es überall.“
„Ich muß Ihnen widersprechen,“ fuhr das junge Mädchen fort. „Der betreffende junge Mann hat aus einer Reihe von Erfahrungen das gleiche Fazit gezogen wie ich, und er ist doch hierin kompetent.“
„Gewiß, er ist kompetent, und ich will Ihnen zugeben, daß wir hartnäckige eingewurzelte Fehler haben. Wer hat sie nicht? Auf die Schwächen des Gegners gründet sich ja jede Politik. Und auch einen andern Vorwurf kann ich uns Balten nicht ersparen: wir hätten vor Jahrhunderten bereits die Letten germanisieren sollen, dann hätten wir jetzt eine Schutzwehr, ein Volk hinter uns. Nun aber warteten wir human und lässig, bis die Regierung sie uns russifizierte. Die jungen Streber sogen in russischen Schulen antigermanische Ideen ein, die Söhne lettischer Bauern und Wirte trugen sozialistische, ja regierungsfeindliche Pläne in den unreifen Köpfen mit heim und wurden in ihrer traurigen Halbbildung von ihren Vätern als Wunder der Gelehrsamkeit angestaunt. Die russischen Lehrer sympathisierten selbst zum großen Teil mit diesen sogenannten „Freiheitsbestrebungen“, und so wuchs eine halt- und marklose Generation heran, hin und her geschleudert zwischen altruistischem Volksbeglückungswahn und frecher Insubordination. Das Vertrauen zwischen Lehrern und Schülern existiert nur noch als Mythus, und Frechheit und Halbheit regieren die Welt! O, wie weit, wie [34] unendlich weit sind wir von der maßvollen Freiheit der alten Griechen und Römer! Nur der, der gehorchen gelernt hatte, durfte zu befehlen wagen!“
Ernst Phlippi hatte sich in Eifer geredet. Gespannt hörte Claire zu.
„Ich habe mich bisher wenig um Politik gekümmert,“ sagte sie. „Wir Balten sind eigentlich keine Politiker.“
„Aber treue Untertanen und ehrenwerte Männer,“ sagte er. „Haben Sie jemals gehört, daß sich in Dorpat, solange man uns unsre deutsche Sprache ließ, Nihilisten oder Sozialdemokraten breit machten?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Und jetzt!“ sprach er bitter weiter. „Was ist aus dem blühenden Städtchen geworden? Unsre Aula ein Versammlungsort für politische Brandredner, unsre stillen Straßen voll verwilderter, halb verhungerter russischer Studenten! Die medizinische Fakultät, früher eine Blüte der Wissenschaft, gilt jetzt nichts mehr. Unsre Mediziner der siebziger und achtziger Jahre brauchten in England kein neues medizinisches Examen zu bestehen; jetzt genügt das „Jurjewsche“ Examen nicht mehr, sie müssen es in England noch einmal machen. Unsre tüchtigen deutschen Professoren – wo sind sie hin?“ Er seufzte und blickte schwermütig in die friedliche dämmernde Landschaft hinein.
Eine Windmühle mit riesigen Flügeln erhob sich wie ein dunkles Gespenst auf der Wiese. Schattenhaft glitten die gewaltigen [35] Flügel im Kreise herum wie eine gespenstische unentrinnbare Notwendigkeit. Die Ruhe der Umgebung hatte etwas Furchteinflößendes. Weit, weit, wohin das Auge reichte, bläuliche Waldzüge und stille schlummernde Stoppelfelder.
Der Kutscher wandte sich um. „Bitte, Herr, muß man die Wagenlaterne anzünden?“ fragte er in lettischer Sprache.
„Ich meine, es ist noch hell genug; aber ganz, wie Ihr wollt, Granting. Es wird empfindlich kühl.“
Claire hatte sich erhoben und schnallte ihren Plaidriemen auf. Ernst Philippi wollte ihr dabei behilflich sein, aber ehe er sich’s versah, hatte sie den Plaid um seine Schultern gehängt.
„Aber nein,“ wehrte er, „das geht nicht an!“
„Seien Sie hübsch artig,“ lachte sie, „einer Gouvernante muß man gehorchen.“
„Für mich sind Sie etwas andres,“ sagte er warm. „Aber Ihren Plaid nehme ich doch nicht. Das wäre ja allerliebst – und Sie sollte ich frieren lassen!“
„Aber mich friert durchaus nicht,“ versicherte sie, „fühlen Sie nur meine Hand, sie ist ganz warm.“
Er nahm die kleine nervige Hand und drückte einen Kuß darauf.
Sie zog sie hastig zurück und wurde über und über rot.
„Wissen Sie, daß ich heute auf dem Dampfschiff im Begriff stand, Ihnen eine Liebeserklärung zu machen?“ sagte er unvermittelt.
[36] Ihr Herz schlug heftig. „Warum taten Sie es nicht?“ sagte sie äußerlich ruhig.
Er zuckte zusammen. „Mein Gott, Claire – durfte ich denn? Nach dreistündiger Bekanntschaft – und ich eine unfertige Existenz – ein Krüppel ... ich hab’ zu viel Achtung vor Ihnen.“
Sie lächelte leise und schwieg.
Immer dunkler wurde die Dämmerung. Über den fernen Waldrand glitt langsam ein großer kupferroter Mond. Schnell rollten die Räder über die glatte Fahrstraße.
Er faßte ihre Hand. „Sie waren nicht ermutigend, Claire.“
„Sie kommt, und sie ist da,“ flüsterte sie.
„Claire!“ jauchzte er ungläubig. „Claire?“
Es kam keine Antwort. Langsam rannen zwei Tränen über ihre Wangen.
Und wieder stand er auf der schwebenden Brücke, und unter ihm rauschte der blinkende Strom. Nahe, ganz nahe, in greifbarer, fühlbarer Nahe. Mein, mein das Glück! jubelte es und wogte es in ihm. Er schlang seinen Arm um sie; sie widerstrebte einen Moment, dann sank sie an seine Brust.
Beide wurden von einem heißen Glücksgefühl durchrieselt.
Das Mädchen ermannte sich zuerst. Sie richtete sich wieder auf und strich mit der Hand über ihre Augen. „Es ist wie ein Traum,“ murmelte sie; „aber wir dürfen nicht träumen. Ja, ich bin Ihnen gut,“ fuhr sie mit erstickter Stimme fort. „Großer [37] Gott, wie schnell ist das gekommen! Das ist meine ehrliche Antwort, aber ich bitte, sprechen Sie mir nicht mehr davon, bis ... bis ... Ich gehe einem neuen schweren Beruf entgegen, und ich muß meine ganze Kraft zusammenhalten.“
„Claire!“ rief er in ehrlicher Bewunderung, „Sie sind ein herrliches Mädchen!“
„Ich bin nüchtern und vernünftig,“ erwiderte sie, „so werden wir Gouvernanten.“
Nun beugte er sich wieder über ihre Hand und küßte sie. „Mein tapferer Freund!“ sagte er leise. „Dank! Dank!“
Sie saßen in wortlosem seligem Schweigen. Das Glück war ihnen beiden zu groß und plötzlich gekommen, und sie waren des Glücks nicht gewöhnt. Wie ein stilles, unberührtes Wasserbecken, in das sich plötzlich eine Sturzwelle ergossen hat, Zeit braucht, um die wirbelnden Wasser entströmen zu lassen und zu seiner ursprünglichen Klarheit und Stille zu kommen, so mußten diese beiden Seelen, die sich bis auf den Grund erschüttert fühlten, harren, schweigen und sich klären.
Nach einer langen Pause fragte er: „Was war Ihnen heute, Claire, als ich sagte, daß Ehrlichsein zu den Selbstverständlichkeiten eines anständigen Menschen gehöre? Sie wurden plötzlich kalt und fremd gegen mich.“
„Was mir war?“ fragte sie mit verändertem Ton. „Muß ich Ihnen das sagen?“
„Nur, wenn Sie wollen, Claire.“
[38] „Es fällt mir schwer, aber Sie sollen’s wissen. Ich bin einmal unehrlich gegen einen Menschen gewesen, und da fragte ich mich, ob ich mich ohne weiteres zu den anständigen Menschen zählen dürfe, denen Ehrlichsein so selbstverständlich ist.“
„Und was antworteten Sie sich?“ fragte er mit leisem Lächeln.
„Ich sagte mir, daß ich damals noch sehr jung war, und daß ich seitdem ehrlicher geworden bin.“
Jetzt lastete ein andres Schweigen auf ihnen. Es war bleiern und schwer. Claire fühlte ihr Herz pochen. Trapp, trapp, liefen die Pferde in gleichmäßigem Schritt.
„Betraf es jenen lettischen Verwalter?“ fragte Ernst Philippi plötzlich.
„Ja,“ flüsterte sie. „Er liebte mich, und – das machte mir Spaß. Ich quälte und neckte ihn, und als er mir seine Liebe gestand, lachte ich ihn aus und gab ihm einen Korb. ‚Ich bin ja nur ein Lette‘ sagte er mir da, ‚mit einem Herrensohn hätten Sie nicht zu spielen gewagt.‘ Ich weinte und bat ihn um Vergebung. An Rassen- oder Standesunterschiede hätte ich nie gedacht, ich war ja noch ein halbes Kind. Er aber ging von mir in bitterem Groll und vergab mir nicht. Seitdem bin ich ernst und ehrlich geworden und erlaube auch niemandem, mit mir zu spielen.
„Claire!“ rief er bittend.
[39] Sie lächelte und lehnte sich in den Wagen zurück. Sie war sehr bleich. Leise stahl sie ihre Hand in die seine und drückte sie.
Hastig und schnell atmend sprach sie weiter: „Sollte es jemals – anders zwischen uns werden, so – das sollen Sie ein für allemal wissen – so habe ich Ihnen nichts zu vergeben. Wir gehen dann still und einfach ohne Brücken auseinander, wie wir zusammengekommen sind. Versprechen Sie mir das?“
Er preßte die kleinen warmen Hände immer wieder an seine Lippen. „Und das Stübchen im Katharineninstitut?“ fragte er mit einem jähen Umschwung seiner Stimmung und lächelte übermütig.
Sie schüttelte langsam den Kopf. „Das mag ruhig auf mich warten,“ sagte sie, „vielleicht lande ich doch noch einmal in seinem sichern Altjungfernheim.“
„Jetzt muß ich noch etwas sagen,“ murmelte Ernst Philippi, „sonst wird mir nicht ganz wohl.“
„Was denn?“
„Geliebte ... ich liebe dich!“ flüsterte er.
„Sst!“ machte sie und legte ihm zwei Finger auf den Mund. „Wir sprechen vorderhand nicht mehr davon.“
Ein hoher ernster Föhrenwald schlug über den Reisenden zusammen. Weich und warm duftere ihnen die würzige Waldluft entgegen. Es war dunkel, und nur ein Streif des besternten Nachthimmels zwischen den stolzen Bäumen folgte den Windungen [40] des schmalen Weges. Über knorrige Wurzeln und durch tiefe Regenlachen ächzte der Wagen, stolperten die müden Pferde. Granting ließ sie ruhig im Schritt gehen, und das flackernde Licht der Wagenlaterne malte rötliche flirrende Lichter auf die Föhrenstämme, sie schienen sich zu bewegen und umeinander zu drehen wie im langsamen gespensterhaften Reigen.
Claire atmete tief auf. „Allein würd’ ich mich fürchten,“ murmelte sie.
„Und jetzt?“
Sie lächelte. „Jetzt ist’s schaurig süß, so wie wenn die alte russische Bábuschka uns Kindern eine schöne Gespenstergeschichte erzählte. In der russischen Familie hatten die Kinder solch eine alte Großmutter. Ich liebte sie sehr.“
„Ihre Kindheit ist doch reicher als die meine, trotzdem Sie elternlos waren ... ich habe niemanden so recht geliebt, aber jetzt will ich’s nachholen!“
Wieder schwiegen sie. Ihre Herzen waren zu voll. Allmählich lichtete sich der Wald, die Straße führte an einem Staketzaun vorüber, die Torflügel des Parkes waren geschlossen. Durch Bäume und Buschwerk hindurch schimmerte Licht. Ein heiserer Hund schlug an.
„Das ist die Forstei Marienhof,“ sagte Ernst Philippi. „Jetzt sind wir nur noch eine halbe Stunde vom Pastorat.“
„Schon!“ rief Claire bedauernd.
[41] In schlankem Trabe fuhren sie an dem ausgedehnten Park vorüber in eine weite Ebene hinein. Da liefen drei Gesellen mit geschwärzten Gesichtern quer über den Weg; die Pferde scheuten und sprangen jäh zur Seite.
„Hallo – he!“ rief Granting zornig. „Wer da?“
„Halt’s Maul, du Herrenknecht!“ war die heisere Antwort. Ein Stein flog um Handbreite an Grantings Kopf vorüber.
„Ruppiger Teufel!“ schimpfte der Kutscher und faßte die Zügel fester. Die Peitsche sauste auf die Füchse nieder, da flog der Wagen in die nächtige Waldesstille hinein.
„Das war ja ein Überfall!“ murmelte Claire scheu.
Ernst Philippi saß mit düster gerunzelten Brauen. „O Claire, wie soll ich Sie hier auf dem Lande zurücklassen?“
„Ich bin ja keine Vollblutdeutsche,“ tröstete sie lächelnd, „mir wird man am wenigsten etwas anhaben. Meine Mutter war griechisch-orthodoxer Konfession, obgleich sonst gut deutsch gesinnt, denn meine Großmutter mütterlicherseits war Russin.“
Ernst Philippi fuhr auf. „Wie?“ rief er. „Sind Sie also auch griechischer Konfession?“
„Den Landesgesetzen nach – ja,“ sagte sie einfach, „der Überzeugung nach – nein. Ich fürchte, ich war längere Zeit ziemlich religionslos“, fügte sie traurig hinzu, „erst die letzten Jahre haben mich in ein persönliches Verhältnis zu Gott geführt.“
[42] Widersprechende Gefühle und Gedanken stürmten auf Ernst Philippi ein. Ein halbes Jahr früher, vor dem kaiserlichen Aprilmanifest 1905, wäre ihm, dem Protestanten, eine Verbindung mit einer Braut griechisch-orthodoxer Konfession eine Unmöglichkeit gewesen, oder er hätte seiner geliebten kurländischen Heimat auf immer Lebewohl sagen müssen. Heute, Gott sei’s gelobt, lagen die Dinge anders. Ihrem Übertritt lag ja nichts mehr im Wege, und formale Schwierigkeiten waren zu überwinden.
„O Claire,“ rief er bewegt, „wir sind einer großen Gefahr entronnen!“
Sie sah ihn staunend an. Dann verstand sie. Ein schönes freies Lächeln beseelte ihr klares Gesicht. „Daran hatte ich nicht gedacht“, sagte sie. „Es ist selbstverständlich, daß ich auch äußerlich die Konfession annehme, mit der ich von Kindheit an verwachsen und vertraut bin, aber,“ fuhr sie nachdenklich fort, „ob ich dadurch eine bessere Christin werde, weiß ich nicht. Ich habe mich auch von den Fesseln der griechisch-orthodoxen Konfession niemals innerlich fesseln lassen. Auch in die sprödeste Form läßt sich ein lebendiger Inhalt gießen.“
„Der Inhalt ist’s aber zumeist, der die Form bildet oder beseelt!“ rief er.
„Von Theologie verstehe ich nichts,“ sagte sie freimütig. „Religion aber scheint mir so weit entfernt von Theologie wie Praxis von Theorie, und Religion ist für mich ein freies Kindesverhältnis zum Schöpfer der Welten.“
[43] Er drückte ihre Hände. „Ist das dieselbe Claire,“ fragte er staunend, „die mit dem wohlerzogenen Lächeln einer konventionellen jungen Dame Tante Griseldis um ihre Meinung befragen konnte?“
Sie lachte hell auf. „O,“ sagte sie, „ich bin eine verschlossene Natur, wie eine Schmetterlingspuppe stecke ich in Gespinsten und Hüllen, und erst nach und nach wagt sich meine Seele scheu und frierend ans helle Sonnenlicht.“
„Claire,“ bat er zärtlich, „wir sind gleich da; sagen Sie mir ein gutes Wort. Was meinen Sie mit dem Sonnenlicht?“
Da wandte sie sich zu ihm und flüsterte kaum hörbar: „Deine Liebe!“
Der Wagen war aus dem Waldesdunkel in eine freie Lichtung gerollt. Durch eine Allee junger Lindenbäume zwischen Stoppelfeldern führte der Weg zum Pastorat. Die Silhouette einer uralten halbentblätterten Linde mit einem Storchennest hob sich dunkel gegen den sternbesäten Himmel.
Granting knallte mit der Peitsche. In eleganter Kurve bogen die Füchse um ein von Akaziengebüsch umhegtes Rasenrund. Der Wagen hielt vor der Haustreppe.
Mit einem Windlicht in der Hand trat die hohe biegsame Gestalt eines Mannes vor die Tür. Ein paar Kinder in kurzen Kleidern schoben sich an ihm vorüber.
[44] „Willkommen, willkommen in Kronenthal, alter Freund! Gott segne Ihren Einzug, Fräulein Schenkendorff, meine Frau erwartet Sie schon sehnsüchtig.“
Die Männer umarmten sich. „Hier das kleine Kroppzeug, Else und Marthchen – na, nur herein meine Herrschaften!“
Die kleinen Mädchen knixten immerfort und griffen zutraulich nach Claires Händen. Es waren zartgebaute, feingliedrige Kinder mit langen blonden offenen Haaren, etwa acht und zehn Jahre alt.
Claire streichelte und küßte sie. Man trat in das wohnliche erleuchtete Vorhaus. An die Saaltür trat eine große, schön gewachsene Frau, sie hielt eine Lampe in der Hand.
„Willkommen in Kronenthal!“ sagte sie freundlich. „Ich hoffe, die Herrschaften hat nicht gefroren!“ Ein forschender Blick aus den dunklen braunen Augen ruhte voll auf dem jungen Mädchen. Sie schüttelte Claire die Hand.
Ernst Philippi beugte sich über die weiße große Hand. „Fräulein Schenkendorff hat mit Selbstaufopferung für meine Wärme gesorgt. Ich mußte mich durchaus in ihren Plaid hüllen.“
„Ich hoffe, Sie werden sich bei uns wohl fühlen, Fräulein Schenkendorff,“ sagte die Pastorin, und reichte Claire wieder die Hand. „Ich mache nie Phrasen, müssen Sie wissen,“ fügte sie lächelnd hinzu.
Gefesselt blickte Claire die Hausfrau an. Sie hatte einen eigentümlichen Kopf. Kurz gehaltene dunkle Haare fielen wellig [45] in ein klares sympathisches Gesicht hinein. Die Augen hatte einen suchenden, forschenden Ausdruck und glänzten zuweilen strahlend auf, als hätten sie ein Rätsel erraten. Um den weichen Mund lag ein schmerzlicher Zug, doch konnte er oft kinderfroh und gewinnend lächeln. Der ganze Ausdruck war der eines verdorbenen, ahnungsvollen Kindes.
Der Pastor sah seine Frau an und strahlte. „Sie macht nie Phrasen, das kann ich bezeugen, mein Fräulein,“ sagte er lachend, „sie sagt aber zuweilen unbequeme Wahrheiten.“
„Aber du!“ schmollte die Pastorin. „Was soll denn Fräulein Schenkendorff von mir denken nach solcher Einführung? – Kommen Sie liebes Fräulein, und Sie, Herr Kandidat, das Abendessen ist bereit. Kinder bringt einen Schal für Fräulein Schenkendorff!“
Wie die Pfeile schnellten die kleinen Mädchen davon.
Man trat in den geräumigen Saal. Neugierig blieben Ernst Philippis Augen an den dekorativ geschmückten Türflügeln und an dem mächtigen altmodischen Ofen hängen, auf dem in glühenden Farben eine Pyramide in einer ägyptischen Palmenlandschaft gemalt war.
„Ein Winkelchen aus dem Sonnenlande!“ sagte die Pastorin lächelnd. „Es ist das ein Anziehungspunkt für die ganze Nachbarschaft geworden. Kommt man nicht zu den Menschen, so kommt man wenigstens zum Ofen. Jedem das Seine.“
[46] „Ja, Isa ist wieder fleißig gewesen,“ sagte der Pastor stolz. „Der eine exzelliert im Brotbacken, der andre malt, jeder wie er kann. Das Brotbacken wird aber hierzulande mehr geschätzt.“
Ein drolliger Blick Ernst Philippis suchte Claire. „Fast wörtlich ebenso haben wir heute von deiner Frau Gemahlin reden hören.“
„Ach, wirklich?“ rief die Pastorin amüsiert. „Erzählen Sie doch!“
Ernst Philippi erzählte mit Behagen. Das Ehepaar sah sich glücklich und liebevoll an. Hier herrschte vollste Harmonie, das fühlte man. Man hatte sich um den ovalen Eßtisch gesetzt. Von einem rundlichen blonden Landmädchen wurde die warme Speise herumgereicht.
„Zum Schluß wäre unsre Fahrt beinahe tragisch verlaufen,“ erzählte Ernst Philippi, „dramatisch war sie jedenfalls. Dein Kutscher Granting ist noch glücklich einem Steinwurf entgangen.“
„Wo? Wie war das?“ fragte der Pastor lebhaft.
Ernst Philippi berichtete ausführlich, und Claire hatte Muße, den Pastor zu betrachten.
Sein bedeutender wohlwollender Kopf war von kurzem ergrauendem Haar gekrönt, das er sorgfältig gebürstet aufwärts trug. Ein paar kurzsichtige dunkelblaue Augen blickten scharf und freundlich durch eine goldene Brille. Ein mühselig gezogener Stoppelbart, der den nervösen Mund kaum beschattete, bedeckte die untere Gesichtshälfte. Man hätte ihn eher für einen Aristokraten [47] oder weltmännischen Gelehrten halten können als für einen Landgeistlichen.
Ein ungewöhnliches, sympathisches Ehepaar! schloß Claire ihre Beobachtungen. Ich glaube, ich werde mich hier heimisch fühlen.
Die Herren vertieften sich in ein eifriges Gespräch über die politische Lage des Landes. Interessiert folgte die Pastorin ihren Auseinandersetzungen und warf hier und da ein verständnisvolles Wort dazwischen. Ein Blick auf Claires blasses abgespanntes Gesicht bewog sie jedoch, die Tafel aufzuheben. Liebenswürdig sagte sie: „Die Herren mögen noch beim Glase Bier weiter politisieren, ich zeige Ihnen indessen Ihr Zimmer, Fräulein Schenkendorff. Sie sehen müde aus und wollen gewiß zu Bett.“ Sie schob Claires Hand in ihren Arm und führte sie durch den Saal und das Vorzimmer auf die andre Hausseite. „Ich muß Ihnen noch besonders dafür danken, liebes Fräulein,“ sagte sie herzlich, „daß Sie sich trotz der unruhigen und gefährlichen Zeiten entschlossen haben, zu uns aufs Land zu kommen. Uns speziell, hoffe ich, droht keine ernste Gefahr, mein Mann ist beim Landvolk allgemein beliebt, aber ernst genug sieht es rings um uns her aus. Das läßt sich nicht leugnen. Morgen machen wir noch Feiertag, Sie müssen zuvor Ihre Schulkinder als kleine werdende Menschen ein wenig kennen lernen. Ich habe Vertrauen zu Ihnen und hoffe, wir werden gute Freunde.“
[48] Durch die ernste Freundlichkeit dieser Worte getroffen, sagte Claire ehrlich: „Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Frau Pastorin, Sie sind sehr gütig zu mir.“
Ihr seelenvoller Ausdruck war beredter als ihre Worte. Als die Tür sich hinter der Pastorin schloß, fiel Claire erschöpft auf einen Stuhl und stützte ihren Kopf gedankenvoll in die Hand. Wie unendlich viel hatte ihr dieser eine reiche Tag gebracht! Ein ganzes Leben, Hoffen, Fürchten, Lieben, und Vertrauen lag von diesem Tag umschlossen, und fern, unendlich fern dünkte ihr die Vergangenheit! – –
Der folgende Tag war ein Sonnabend.
Am frühen Morgen bereits saß der Pastor in seiner Arbeitsstube und nahm Meldungen zur bevorstehenden Abendmahlsfeier entgegen.
Das Wartezimmer nebenan war voll besetzt; alle paar Minuten öffnete sich die Tür und ließ einen Bauer herein. Dem Scharfblick des Pastors war es nicht entgangen, daß die Haltung der Leute reservierter war als noch vor vierzehn Tagen. Eine gewisse lauernde Gespanntheit lag in den harten Zügen und zuckte um die Mundwinkel. Für jeden von ihnen hatte Robert Berger ein gutes Wort, manchmal auch einen freundlichen Scherz, und es erfüllte ihn mit Genugtuung, daß die Kraft seiner Persönlichkeit auch diesmal ihre Wirkung nicht verfehlte. Düstere, sorgenharte Gesichter klärten sich auf, und mit offeneren Mienen schoben die Leute zu zweien und dreien an seinem Fenster vorüber. [49] Endlich war auch der letzte Mann gegangen. Pastor Berger öffnete die Tür zum Saal und begrüßte Ernst Philippi, der, eine Zeitung lesend, im Schaukelstuhl saß. „Morgen, alter Freund,“ sagte er, „gut geschlafen?“
„Ausgezeichnet!“ rief Ernst Philippi und dehnte sich behaglich. „Über Pastoratsbetten und Pastoratsgastfreundschaft geht doch nichts.“
„Das freut mich zu hören, lieber Junge, und darum hoffe ich auch jetzt keine Fehlbitte zu tun.“ Der Pastor dämpfte seine Stimme und sah sich vorsichtig um. „Es liegt etwas in der Luft, hier in unsrer Gegend müssen sich unangenehme Dinge vorbereiten, und da du, soviel ich weiß, nichts versäumst, tätest du mir einen großen Gefallen, einige Wochen, na sagen wir gleich Monate, hierzubleiben. Meine Frau ist ängstlich und nervös, ihr wäre das sicher ein großer Trost und mir eine rechte Freude.“
Erfreut schlug Ernst Philippi in die dargebotene Hand. Claire war sein Hauptgedanke.
„Wenn es dir recht ist, gehen wir ein wenig in unsern Garten. Hast du unsere neue Hausgenossin schon gesehen? Sie scheint ja zu der schweigsamen Sorte zu gehören.“
„Stille Wasser!“ sagte die Pastorin, die die letzten Worte vernommen hatte, und trat in den Saal. „Ich müßte mich sehr irren, wenn wir nicht in Fräulein Schenkendorff eine echte Perle gefunden hätten. Ich ging heute früh an dem Flüßchen [50] spazieren, da hörte ich es in den Büschen zwitschern und lachen. Unser ernstes Fräulein war da mit unsern Kleinen zum Kinde geworden, haschte sich mit ihnen herum, und alle drei waren seelenvergnügt. Übrigens, Robert, weißt du, daß sie griechisch-orthodoxer Konfession ist?“
„So?“ meinte der Pastor erstaunt. „Nun, da ich selbst den Religionsunterricht gebe, macht das ja weiter nichts, wußtest du etwas davon, Ernst?“
„Fräulein Schenkendorff hat mir gestern davon gesprochen. Übrigens schließe ich mich Ihrem Urteil durchaus an, gnädige Frau. Fräulein Schenkendorff hat auf mich in den wenigen Stunden unsers Zusammenseins einen vortrefflichen Eindruck gemacht, sie ist eine ebenso stolze wie zurückhaltende Natur.“
„Das wußte ich, Robert,“ jauchzte Isa Berger, „das wußte ich in dem Augenblick, als ich ihr in die Augen sah!“
„Meine Frau ist nämlich ein großer Hellseher, mußt du wissen,“ neckte der Pastor. „Wehe dem, gegen den sie eine Antipathie hat; an dem gibt’s sicher einen faulen Fleck.“
„Und mein Mann ist ein großer ‚Seelensorger‘, wie unser Küster Kruhming sagt. Wehe dem, an dem er keinen faulen Fleck zum Behandeln findet, der hat schon das halbe Interesse für ihn verloren!“
Die Freunde lachten, griffen nach Hüten und Mänteln und schritten in den großen Obstgarten hinaus. Es war ein kühler Septembertag. Welk und verschrumpft zitterte das zerzauste Laub [51] an den Apfel- und Birnbäumen. Vereinzelt hing noch hier und da ein rotbäckiger Apfel in den Zweigen. Leuchtend vergoldete die Herbstsonne das gelbe Laub in einer mächtigen Roßkastanie, ihre gewaltigen Äste wie Riesenarme ausbreitete und mahnend auf die kleine Dorfkirche hinzuweisen schien. Vierhundert Schritt weit stand sie neben dem Kruge auf einer Anhöhe.
Der Pastor sah über den Zaun hinüber. „Mein Kirchlein!“ sagte er leise.
Ernst Philippi schien mit einem Entschluß zu ringen. „Du,“ sagte er mit halbem Lächeln, „ich knüpfe an die Worte deiner verehrten Gemahlin an und will dir als meinem Freunde und Seelsorger einen faulen Fleck in mir zum Behandeln preisgeben.“
Überrascht sah der Pastor auf. „Los, alter Junge!“ sagte er und zündete sich gemächlich eine Zigarre an.
„Ich will umsatteln!“
„Das hab’ ich erwartet,“ sagte der Pastor.
„Das ist aber nur die eine Hälfte meiner Beichte, die Begründung meiner Absicht liegt darin, daß ich ohne innern Beruf zum Studium der Theologie gezwungen wurde und die Kanzel nicht mißbrauchen mag.“
„Vollkommen richtig.“ Der Pastor nickte. „Was willst du nun aber werden?“
„Ich will Schauspieler werden; ich kann wahrscheinlich aber nur Rezitator werden, und ich werde vielleicht Bankbeamter werden müssen.“
[52] „Du wirst Bankbeamter werden müssen ...“ Der Pastor dachte angestrengt nach. „Warum müssen?“ fragte er.
„Weil ich seit gestern verlobt bin.“
Robert Berger trat einen Schritt zurück. „Mensch!“ rief er, „doch nicht mit ... mit Fräulein Schenkendorff?“
„Durchaus.“
„Aber das ist ja etwas Großartiges! Gratuliere, gratuliere von Herzen!“ Er schüttelte Philippis Hände kräftig und freundschaftlich.
„Sie ist ja griechisch-orthodox, wie du weißt, aber heute ist das ja kein Hindernis mehr.“
„Gottlob nein!“ sprach der Pastor.
Langsam schritten sie nebeneinander her.
Heftig zog der Pastor an seiner Zigarre.
„Es fällt mir der Gedanke nicht leicht,“ begann er, „daß durch deinen Austritt aus dem Kreise der Theologen wir Balten um einen gewissenhaften und tüchtigen Menschen ärmer werden sollten. In Zeiten der Gefahr brauchen wir ganze Männer. Anderseits verstehe und billige ich deinen Entschluß vollkommen, daß du in einem Beruf nicht bleiben willst, in den dich nur äußerer Zwang hineintrieb. Es fragt sich nur, ob nicht doch in dem Erben einer dreihundertjährigen Pastorengeneration irgendwo ein lebendes Keimchen schlummert, das sich unter den heutigen abnormen Verhältnissen organisch zur kräftigen Pflanze entwickeln könnte. Wer weiß, ob nicht gerade der Druck deiner häuslichen [53] Verhältnisse es war, der dich von vornherein in einen Widerspruch hineinzwängte, der bei freier Entfaltung deiner Persönlichkeit einfach nicht vorhanden gewesen wäre. Die Labyrinthe unsers Ichs sind oft außerordentlich verschlungen.“ – Nach einer gedankenvollen Pause fuhr er fort: „Du hast unbedingt einen künstlerischen Zug in dir; aber hier liegt wiederum die Frage sehr nahe, ob du in unserm schönen Beruf nicht auch ein rechter Künstler zu werden vermöchtest – Redekünstler, Künstler der Psychologie, Künstler in der Seelsorge, vor allem aber Lebenskünstler! Es liegt an der einzelnen Persönlichkeit, ob man seinen Beruf als Amt, Handwerk, Kunst oder Religion auffaßt.“
Ernst Philippi strich sich mit einer nervösen Bewegung über die Stirn. „Ich danke dir,“ sagte er einfach. „Deine Großzügigkeit wünschte ich unsern meisten Pastoren. Es wäre besser um unser Baltenland bestellt.“
„Noch eins,“ warf Robert Berger hin; „darf ich’s Isa sagen?“
„Selbstverständlich. Ich bitte darum.“
Von einer Last befreit ging Ernst Philippi neben seinem Freunde her. Da nahte sich ihnen geschäftig von der Hinterseite des Hauses eine rundliche Gestalt.
„Mein Küster Kruhming,“ sagte Robert Berger. „Guten Morgen, Kruhming. Was bringen Sie mir Gutes?“
„Guten Morgen, Herr Pastor; guten Morgen, Herr Kandidat. Sind Sie wieder hier? Bringe diesmal böse Nachrichten.“
[54] Beide reichten ihm die Hand.
Die Augen des kleinen runden Mannes funkelten listig vor verhaltenem Vergnügen. „Die Kirche in Birkenhof ist diesen Donnerstag am Kronsfeiertag geschändet worden. Den Pastor haben die Sozialdemokraten gezwungen, die rote Fahne in die Hand zu nehmen und dem Zuge voranzugehen. So sind sie vor das Gutshaus gezogen.“
Robert Berger war bleich geworden, er runzelte die Stirn. „Den Pastor gezwungen? Wie war das möglich?“
„Nu, was sollte der Pastor machen? Man will sich doch nicht totschlagen lassen wie einen räudigen Hund. Mit den Roten ist nicht zu spaßen, Herr Pastor, das können Sie glauben.“ Eine schlecht verhehlte Schadenfreude verzerrte die gedunsenen Züge des Küsters.
„Wissen Sie, was ich glaube?“ sprach der Pastor schwer und tönend und reckte seine hohe Gestalt gebietend empor. „Mit dem heiligen Amt eines Pastors ist noch viel weniger zu spaßen. Das ist meine Überzeugung.“
Der kleine Mann sank in sich zusammen und faltete die roten Hände über dem runden Leib. „Nu ja, nu ja,“ sagte er scheinheilig, „es sind eben harte Zeiten.“
„Es gibt Härteres als den Tod. Als Petrus seinen Herrn dreimal verleugnete, wußte er nicht, was er tat. Als er es aber wußte, da hätte er gewiß gern dreifachen Tod erlitten; da ging er hin und weinte bitterlich. Kruhming, behüte uns beide Gott, [55] Sie und mich, daß wir nicht hinweggehen müssen und bitterlich weinen wie Petrus.“
„Gott verhüte, Gott verhüte!“
„Hören Sie, lieber Kruhming,“ fuhr Berger in gänzlich verändertem Tone fort, „ich bitte Sie dringend, meiner Frau nichts davon zu erzählen. Sie tun mir einen persönlichen Gefallen damit.“ Er reichte dem Küster freundlich die Hand.
Der kleine dicke Mann war nur ein breites Lächeln. Er fühlte sich offenbar durch das Vertrauen sehr geschmeichelt. „Gewiß, gewiß,“ sagte er dienstbeflissen, „warum sollt’ ich denn der gnädigen Frau Sorgen machen?“
„Da erkenne ich doch meinen alten Kruhming wieder!“ rief der Pastor fast fröhlich. „Wenn wir vom Amte nur treu zusammenhalten, da kann uns kein Teufel was anhaben, noch viel weniger eine arme mißleitete Masse. Hören Sie, Kruhming, auf meinem Schreibtisch finden Sie das Verzeichnis der Lieder für morgen.“
Mit tiefen Bücklingen empfahl sich der dicke Küster. Schweigend gingen die Freunde weiter.
„Robert,“ sprach Ernst Philippi in ehrlicher Bewunderung, „du bist der geborene Seelsorger!“
Der Pastor drückte ihm schweigend die Hand. „Was soll daraus werden?“ murmelte er sinnend. Dann blickte er über den Zaun zu seiner Kirche hinüber. Steil erhob sich das grüne Dach auf dem weißen Gemäuer. Die Sonne funkelte friedlich auf dem [56] vergoldeten Kreuz. Halb entblätterte Kastanien standen im Kranz ringsumher. –
Sechs Wochen waren vergangen. Claire fühlte sich im Pastorat Kronenthal merkwürdig heimisch. Ihr ganzes Wesen war leichter und freier geworden. Wie beschwingt ging sie mit leichtem Schritt durch die weiten Räume des alten Hauses, ihre Augen leuchteten, ihre Stimme klang hell und freudig, ihr klares Antlitz mit dem beseelten Ausdruck sah mutig und vertrauend in die Zukunft. Die kleinen Mädchen hingen an ihr wie die Kletten, und auch einen großen Teil ihrer freien Zeit widmete sie den Kleinen.
Von Ernst Philippi sah sie nicht viel. Kaum eine Stunde täglich waren sie zusammen. Er hatte ihr die drohenden Wolken, die sich auch in der Nachbarschaft zusammenzogen, nicht verheimlicht, und sie war es, die ihn veranlaßte, den Pastor auf seinen Amtsfahrten zu begleiten. So kam es, daß Ernst Philippi seinen Freund von einer neuen Seite kennen und schätzen lernte. Keine körperliche Müdigkeit seiner zarten Natur hielt Robert Berger von seinen Pflichten zurück, keine Einförmigkeit in seinem Beruf lähmte seinen Eifer. Mit einem glücklichen Humor wußte er auch der Prüfung von Abcschützen eine interessante Seite abzugewinnen oder bei ehelichen Zwistigkeiten durch eine schlagfertige überraschende Wendung die Streitenden zu verblüffen und allmählich zu versöhnen. Mit bäuerlichen Schlaumeiern verkehrte er scheinbar wie mit seinesgleichen und gewann sie doch wieder [57] durch ein herzliches Vertrauen, das sie beschämte. Der Grobheit und Verbissenheit begegnete er mit Spott und ironischer Höflichkeit, die auch die gröbsten Prahler dämpfte und zähmte. An Kranken- und Sterbelagern hörte Ernst Philippi ihn erhebende trostreiche Worte sprechen, die nicht bloß Worte waren, und allmählich und fast unbewußt begann er sich die Möglichkeit einer Berufstätigkeit unter solcher Leitung als etwas Schönes und Erhebendes vorzustellen.
Gerade das lebendige Wirken von Person zu Person begann sein künstlerisches Naturell zu interessieren. Statt als Schauspieler gedachte Gedanken in vollendeter Form zu verkörpern, neue einfache Gedankenreihen zu wecken, zu lenken und im Rohstoff schöpferisch mitzugestalten und so künstlerisch zu prägen – das erfüllte ihn nach und nach mit einem unbezwinglichen Tätigkeitstriebe. So kam es, daß er zuweilen mit eingriff und in seiner Weise die seelsorgerischen Gespräche zwischen Pfarrer und Bauer beeinflußte. Robert Berger schien ihn mit heimlichem Wohlgefallen immer wieder dazu anzuspornen, und eines Tages geschah es Ernst Philippi, daß er wie aus einem Traum erwachte und der Beruf eines Pfarrers keine Schrecknisse mehr für ihn hatte.
Zwar hütete er sich vor sanguinischer Begeisterung – dazu war seine Natur viel zu grüblerisch und gründlich –, aber er begann in aller Stille die neuen Gedanken in sich zu verarbeiten.
Gründlich, wie er war, hatte er es sich auch in den Kopf gesetzt, sich gegen alle Möglichkeiten einer bösen Zeit zu wappnen [58] und seinem Freunde in der Not wirklich von Nutzen sein. Deshalb hatte er sich in der nahen Kreisstadt einen funkelnagelneuen Revolver gekauft und pflegte sich regelmäßig dreiviertel Stunden im Schießen zu üben. Noch bin ich kein Pastor, sagte er sich, und somit ist mir dieses kriegerische Handwerk nicht versagt.
Die politischen Verhältnisse gestalteten sich indessen immer bedrohlicher. Ein kurländischer Baron war meuchlings erschossen worden, die Pastoren der benachbarten Pfarrämter klagten über anonyme Drohbriefe, die in maßlos erbitterten Ausdrücken gehalten waren. In einigen Kreisen hatten Wirte und Pächter ihre Zahlungen einfach eingestellt, Hofknechte verweigerten den Gehorsam, und nach und nach verbreiteten sich Schreckensgerüchte von Bränden und sengenden, plündernden Banden, die das Land durchzogen, viele Gutsbesitzersfamilien flüchteten in die Städte oder gar ins Ausland, und ihnen folgte das höhnende Triumphgeschrei der Aufwiegler.
In Kronenthal war es bisher ruhig geblieben. Ein erster Schnee hatte sich schmeichelnd wie ein weicher Flaum über die Felder gelegt, und der Föhrenwald leuchtete in glitzerndem Kleide.
Die Pastorin trat an diesem Tage in die Schulstube. „Fräulein Schenkendorff,“ sagte sie freundlich, „erlauben Sie mir, Ihren Unterricht für heute zu unterbrechen. Es ist ein so gottvolles Wetter, machen Sie einen Spaziergang mit Herrn Philippi, Sie sehen ganz müde und abgespannt aus. Ich will inzwischen mit Elschen und Marthchen einen Schneemann bauen.“
[59] Fort flogen Bücher und Hefte. „Ach ja, Mammi, einen Schneemann! Einen Schneemann!“ jauchzten die kleinen Mädchen und hängten sich liebkosend an die Mutter.
Ernst Philippi stand gestiefelt und gespornt im Flur. „Gehen wir?“ fragte er. Seine Augen leuchteten.
Claire lächelte. „Wohin Sie wollen,“ sprach sie fröhlich. Bald war sie bereit, und sie traten ins Freie.
„Da muß ich aber gleich zu Anfang protestieren!“ sagte er.
„Wie? Auch das noch? Ich richte mich vollends nach Ihren Wünschen: Sie können mich führen, wohin Sie wollen – und Sie protestieren! Das nenne ich undankbar!“
„Claire!“ bat er weich. „Hier unter diesen vortrefflichen Menschen, die um unser Verhältnis wissen, die uns ein so zartes Verständnis entgegenbringen – hier ist es nicht mehr angebracht, daß wir ‚Sie‘ zueinander sagen und uns so maßlos vernünftig gegenüberstehen. Du hast mich noch nie bei meinem Namen genannt, hast das Dusagen immer ängstlich vermieden. Wozu nur?“
„Ernst,“ sagte Claire, so recht aus Herzensgrund, „ich bin glücklich, glücklich, glücklich – hörst du, so aus dem vollen heraus, so wie ich es nie für möglich gehalten habe! Bilde dir nur nicht ein, daß du etwas dazu beiträgst!“ spottete sie. „Ich liebe diese Menschen so sehr, unter denen ich lebe, und ich weiß nicht, wen ich mehr verehre, Pastor Berger oder seine Frau.“
„Nun ich hoffe durchaus, die Frau Pastorin,“ sagte er in drolliger Eifersucht.
[60] Sie lachte hell auf. „Sie ist ein ganz eigentümliches Wesen,“ sagte sie nachdenklich, „durch und durch eine künstlerische Natur und von einer fabelhaften Harmlosigkeit, die sich mit einer seltsamen Schärfe der Beobachtung paart. Das Verhältnis zwischen beiden ist erquickend und erhebend zugleich.“
Arm in Arm waren sie durch die entblätterte junge Lindenallee geschritten, jetzt nahm der schneeige keusche Wald sie auf.
„Sieh, wie wunderbar schön!“ rief Claire andächtig.
Er schlang seinen Arm um sie. „Claire,“ fragte er, „könntest du Landpfarrerin sein?“
„Ich wüßte mir nichts Schöneres!“ rief sie enthusiastisch. „Weshalb aber fragst du?“
„Ich habe es all diese Wochen mit mir herumgetragen,“ sprach er bewegt, „und wagte nicht, daran zu glauben; aber ich meine, ich hoffe, auch ich könnte am Ende meinen bescheidenen Platz als Pastor ausfüllen; nicht in der genialen Weise wie Robert Berger .. ich habe an seiner Seite den Beruf lieben gelernt, Claire!“
„Ernst!“ Sie flog ihm jubelnd an die Brust. Lange hielten sie sich umschlungen.
Erschüttert sprach er wieder: „Ich bin innerlich frei geworden! Eine drückende Fessel um die andre ist von mir abgeglitten. Nicht kampflos auf ausgetretenen Pfaden sollen wir wandeln, sondern auf ein tägliches Mitleben und Erleben unsers Berufs kommt es an, auf ein tägliches schöpferisches Neugestalten; [61] und wahrhaftig, um es darin zur Meisterschaft zu bringen, muß man ein tüchtiger Künstler werden.“
Sie sah ihn mit strahlender Freude an. „Und unsre Zeit braucht ganze Männer!“
„Und ganze Frauen!“ fiel er ein. „Unsere Zeit ist hart und böse. Wir gehen alle einher in des Todes Schatten und fragen uns: Hat Gott unser baltisches Deutschtum ganz dem Untergange geweiht? In mir aber lebt noch ein großes Stück Kampfeslust, das ist mir in diesen Wochen klar geworden. Hast du Mut, Claire? Wir brauchen beide Mut.“
„Liebe ist Mut!“ sagte sie einfach.
„Claire!“ sprach er begeistert, „du in deiner heiligen Weibesunschuld, du weißt nicht, welch ein herrliches Wort du aussprachst!“
Sie standen unter einer hohen Föhre eng aneinander geschmiegt, ein Windstoß schüttelte weiße flockige Sterne über zwei glückliche starke Menschen.
Arm in Arm traten sie aus dem Walde. Ihre Augen leuchteten in großer strahlender Freude. An der Wegbiegung holte sie mit lang ausgreifenden Schritten der Gemeindeälteste, der Bauer Krimpe, ein.
Er grüßte kurz. „Finde ich den Herrn Pastor zu Hause?“ fragte er.
„Ja gewiß,“ antworteten beide wie aus einem Munde. „Kann ich vielleicht eine Bestellung für den Pastor ausrichten?“ fragte Philippi.
[62] „Ich muß ihn selbst sprechen,“ sagte der Alte, sah das Brautpaar unter buschigen weißen Brauen durchdringend an und ging an ihnen vorüber.
„Der sieht ja aus wie das leibhaftige böse Wetter!“ flüsterte Claire und sah der mächtigen Gestalt des Bauers nach. Ein wenig gebückt stützte er sich auf seinen Stock und schritt kraftvoll weiter.
„Es ist ein überaus tüchtiger Mann, Robert hält große Stücke auf ihn. Er nennt ihn den alten Nestor.“
„Nestor sah aber greulich unheimlich aus, vielleicht bringt er schlimme Nachrichten,“ sprach Claire besorgt. „Laß uns rasch nach Hause gehen.“
Sie beschleunigten ihre Schritte und kamen leise in den Hausflur, während der Gemeindeälteste von der Rückseite des Hauses in Pastor Bergers Amtsstube trat.
„Sieh da, mein lieber alter Krimpe!“ rief der Pastor erfreut. – „Hör’ mal, Philippi! Bist du da? Komm doch meinen alten Krimpe begrüßen! – Was führt Euch zu mir? Hab’ Euch lange nicht gesehen, nehmt Platz, lieber Freund!“
Zögernd trat Ernst Philippi in die Amtsstube. Gemessen begrüßte ihn der Gemeindeälteste.
Des Alten markiges Gesicht, das wie im Winterfrost erstarrt war, taute allmählich auf, als habe die warme Sonne es berührt. Aus seiner Rocktasche nahm er bedächtig ein geblümtes Tuch, fuhr sich damit über die Stirn und sah den Pastor mit [63] den klugen grauen Augen forschend an. „Gnädiger Herr Pastor,“ begann er langsam, „als Sie hierher nach Kronenthal berufen wurden, da wählten Sie die Gutsherren, wir Bauern hatten bei Ihrer Wahl nichts mitzureden. Ist es so oder spreche ich die Unwahrheit?“
„Ihr sagt die lauterste Wahrheit, Krimpe.“
„Gut.“ Der Alte räusperte sich. „Sie sind nun hier seit zehn Jahren im Amt. Wir haben niemals – schauen Sie meine weißen Haare an, Herr Pastor – niemals einen Prediger gehabt, wie Sie einer sind. Wir Bauern sind mißtrauische Leute, Herr, wir sind mit unserm Urteil nicht heidi und holla fertig wie die vornehmen Herren. Wie wir gewohnt sind, den Kopeken dreimal umzudrehen, ehe wir ihn ausgeben, also sind wir auch vorsichtig mit unserem Urteil.“
„Worauf soll das hinaus, Krimpe?“ fragte der Pastor lächelnd.
„Nur noch ein wenig Geduld. Es hat drei Jahre gedauert, gnädiger Herr Pastor, ehe ich ihnen über den Weg getraut habe. Wem aber der alte Krimpe einmal traut, dem traut er, da nützt kein Rütteln. Ich sehe mit meinen eignen alten Augen und nicht durch fremder Leute Brillen. Nach drei Jahren, da stand es bei mir fest: für den Pastor Berger sind lettische Bauern gleichwertige Menschen wie deutsche Herren, wenn sie nur ordentliche Menschen sind. Hab’ ich recht gesehen oder nicht?“
[64] Robert Berger nickte nur und strich dem Alten fast zärtlich über die braune schwielige Hand.
„Seitdem steht es so,“ fuhr der alte Bauer umständlich fort, „wer dem Pastor Berger ein Haar krümmt, der hat es mit dem alten Krimpe zu tun. In seiner Herde kennt ein guter Schäferhund sich aus, nun aber dringen fremde Böcke in meine Hürde, das Volk ist in Aufruhr, ob mit Recht oder Unrecht, ist eine andre Frage, und nun komme ich zur Hauptsache: predigen Sie morgen nicht, Herr Pastor, meine Macht ist zu Ende. Ein Überfall auf Sie ist geplant.“
Robert Berger war aufgestanden und schritt mit den Händen in der Amtsstube auf und nieder. Dann legte er dem Alten die Hand schwer auf die Schulter. „Ich muß,“ sprach er. „Es ist meine Pflicht.“
„In sein Unglück zu rennen, ist niemandes Pflicht,“ grollte der alte Bauer. „Wozu haben Sie denn den Herrn Kandidaten im Hause? Lassen Sie den für sich eintreten!“
„Lieber Robert,“ sprach Ernst Philippi dringlich, „selbstverständlich ...“
Gebietend hob Robert Berger die Hand. „Krimpe,“ sagte er, „antwortet mir kurz und bündig: Was tätet Ihr, wenn Euer Sohn wider Euch von einer wilden Horde aufgewiegelt wäre und Ihr ihn nicht unter vier Augen vermahnen könntet? Würdet Ihr Euch krank sagen oder vor versammeltem Volk Euren Sohn zurechtweisen?“
[65] Der Alte stand auf. „Ich würde für Bedeckung sorgen und meinem Sohn mit seinen Freunden nicht schutzlos gegenübertreten,“ sprach er mit einem schönen Lächeln. „Leben Sie wohl, Herr Pastor, der alte Krimpe weiß, was er einem echten Seelsorger schuldig ist!“
Da hielt sich Robert Berger nicht langer, er warf sich an die Brust des Greises und küßte ihn.
Verschämt wischte der alte Mann eine widerspenstige Träne aus dem Auge und ging schwerfällig hinaus.
„Ist das nicht ein herrliches Erlebnis?“ fragte Robert Berger tief aufatmend. „Ein Mann wie aus Stahl und Eisen ... ein echter Freund! Gnade über Gnade!“
Bleich und erschüttert stand Ernst Philippi. „Robert,“ sprach er mit tonloser Stimme, „von dir will ich lernen, Menschen fischen. Das ist fortan mein Beruf!“
Eine Reitdroschke, von einem nervigen Fuchs gezogen, riß schwarze Furchen in den frischgefallenen Schnee. Die Beine auf das Trittbrett gestemmt, eine Fellmütze über die Ohren geschoben, saß Ernst Philippi rittlings auf dem schmalen leichten Fuhrwerk und lenkte die Zügel mit fester Hand.
In der Tasche seines grauen Friesrocks steckte der Revolver. Sein bartloser Schauspielerkopf leuchtete von Tatkraft und Entschlossenheit. Nun war er auf der Bühne des Lebens, und er [66] gedachte seine Rolle mit Ehren durchzuführen. Scharf blitzten die blauen Augen über die weite schneebedeckte Ebene und spürten suchend in die Ferne. Mißtrauisch und vorsichtig musterte er jeden Busch und jeden Strauch und unterzog jedes Bäuerlein, das ihm etwa entgegenkam, einer genauen und gründlichen Prüfung.
Durch eine breite Kastanienallee fuhr er auf ein massives zweistöckiges Herrenhaus zu, das sich gewichtig und imposant von einigen umliegenden Hofgebäuden abhob wie ein geborener Fürst inmitten seiner Untertanen.
Ein Hofknecht trat ihm in gebückter Haltung entgegen und küßte ihm devot die Hand.
„Ist der Herr Baron zu Hause?“ fragte Philippi.
„Jawohl, gnädiger Herr.“
Ernst Philippi stieg die breite Freitreppe empor und drückte auf den elektrischen Knopf.
Ein alter Diener öffnete und blickte mißbilligend auf den grauen Friesrock.
„Melden Sie mich bei dem Herrn Baron Reuter – Kandidat Philippi aus Kronenthal.“
„Aus Kronenthal,“ wiederholte der Diener. „Sofort, gnädiger Herr. Bitte treten Sie ein.“
Ernst Philippi entledigte sich seines Überrocks und trat in das komfortable Gemach. Alte Familienbilder in schweren vergoldeten Rahmen blickten in gezierten Stellungen von den Wänden. [67] Ein meisterhaftes Porträt eines strammen alten Herrn mit einer Habichtsnase fesselte Philippis Aufmerksamkeit. Er trat näher heran – in der Tat, es war ein Lenbach.
Schnelle elastische Schritte nahten. Ein hochgewachsener eleganter Mann mit einem Zwicker auf der Nase und einem frischen rötlichen Gesicht in kurzem Smoking trat ein.
Ernst Philippi verbeugte sich. „Ob Sie sich meiner entsinnen, Baron Reuter, weiß ich nicht. Ich hatte die Ehre, Sie vor zwei Jahren in Kronenthal bei meinem Freunde Pastor Berger zu treffen.“
Der Baron musterte ihn scharf und reichte ihm eine schlanke rötliche Hand. „Ah, Herr Kandidat Philippi! Sehr angenehm. Meine Frau ist leider ein wenig unpäßlich. Wie geht’s denn unserm lieben Pastor?“
„Gerade in seinen Angelegenheiten bin ich zu Ihnen gekommen. Darf ich Sie um eine kurze Unterredung unter vier Augen bitten?“
„Sofort.“ Der Baron schloß sorgfältig beide Flügeltüren[WS 4]„Jetzt sind wir ganz ungestört. Bitte nehmen Sie Platz. Sie rauchen?“
Er schob Philippi ein gefülltes Etui mit Zigaretten hin und warf sich lässig in den hohen ledernen Polstersessel. Seine Mienen drückten verhaltene Spannung aus. „Ich bin ganz Ohr,“ sagte er verbindlich.
Ernst Philippi zündete sich eine Zigarette an. „Durch den [68] Gemeindeältesten, einen äußerst zuverlässigen Menschen, den Wirt Krimpe, ist meinem Freunde Berger heute die Warnung zuteil geworden, daß morgen während des Gottesdienstes ein Überfall auf ihn geplant ist. Pastor Berger wurde dringend von dem Manne gebeten, morgen den Gottesdienst abzusagen.“
„So – so!“ sagte der Baron nachdenklich. „Und wie gedenkt sich Pastor Berger zu dieser Warnung zu verhalten?“ Ruhig streifte er die Asche von seiner Zigarette ab. Sein weltmännisches Gesicht war undurchdringlich.
„Er meint sie unberücksichtigt lassen zu müssen.“
„Sehr richtig!“ sagte der Baron mit Nachdruck. „Das ist auch ganz meine Ansicht. Dieser feigen Bande aus dem Wege zu gehen hieße ihr zuviel Ehre antun.“
„Meine Fahrt zu Ihnen, verehrter Baron Reuter, habe ich indessen aus eigner Machtbefugnis unternommen. Mein Freund Berger weiß nichts davon. Ich meine aber, in Rücksicht auf seine Familie und seine zarte Gesundheit ist es richtig, sich in solcher Notlage an die Herren Patrone zu wenden, zumal an Sie als Kirchenvorsteher, und Sie zu bitten – “
„Dem Gottesdienst beizuwohnen“, fiel der Baron lebhaft ein. „Aber das ist ganz selbstverständlich. Ich werde mir erlauben, noch mehrere Herren zur Teilnahme an dieser Expedition zu animieren. Unserm Pastor Berger soll nichts geschehen, verlassen Sie sich darauf!“
Philippi verbeugte sich, auf seinem Stuhle sitzend. „Ich [69] darf Ihnen leider nicht einmal im Namen meines Freundes meinen herzlichsten Dank aussprechen. In seinem Sinne, verehrter Baron Reuter, wäre es gewiß geboten, nur im alleräußersten Falle aktiv einzugreifen?“
„Versteht sich, Herr Kandidat. Die revolutionäre Stimmung durch unnütze Gewaltsamkeiten zu schüren, hieße ja nur Öl ins Feuer gießen. Wir Deutsche sind ja schon sowieso in der Minderzahl.“
Ernst Philippi hatte sich erhoben. „Meinen besten Dank,“ sagte er.
„Der Dank liegt auf meiner Seite, Herr Kandidat. Ich versichere Sie, es ist mir eine aufrichtige Freude, einem allgemein so hochverehrten Manne einen Dienst leisten zu dürfen. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein?“
„Ich danke sehr, Baron Reuter. Die Güter Rausuppen und Finkenhorst liegen auf meinem Rückwege, da will ich noch persönlich vorsprechen.“
„So – so! Nun vielleicht tun Sie gut daran; meinen Schwager und Vetter auf Gnadenfeld will ich selbst benachrichtigen. Also auf eine Schutzwache von fünf bis sechs kräftigen deutschen Männern können Sie sicher rechnen. Verzeihung – tragen Sie Waffen?“
Mit einem halben Lächeln zeigte Philippi seinen Revolver. „Ich bin ja noch nicht im Pfarramt“, sagte er, „und darf mich schon rühmen, ein passabler Schütze zu sein. Gestern schoß ich [70] einer Pikaßkarte mitten ins Herz – Entfernung zwanzig Schritt.“
„Bravo, bravo!“ sagte der Baron lachend. Allmählich war er aus seiner formellen Zurückhaltung getreten, dann zuckte er die Achseln. „Tja, wissen Sie, das ist auch so eine überkommene Tradition, daß ein Pastor sich nicht wehren darf. Selbstverständlich nicht, solange er auf der Kanzel steht, aber das seh’ ich doch wahrhaftig nicht ein, weshalb ein Pastor sich von so einem lettischen Strolch und Raubmörder auf einer Fahrt zum Beispiel oder im Hause sollte wehrlos herunterschießen lassen. Da ist er eben Privatperson wie Sie und ich.“
„Ganz so denke ich auch,“ erwiderte Ernst Philippi. „Dazu kommt aber heute noch etwas Besonderes: außerordentliche Verhältnisse bedingen ein außerordentliches Verhalten.“
„Ganz ausgezeichnet,“ stimmte der Baron zu. „Und zu außerordentlichem Verhalten haben wir wahrhaftig reichliche Gelegenheit. Auf Wiedersehen also morgen, Herr Kandidat, wir sind sicher zur Stelle. Der Gottesdienst beginnt um zehn?“
„Um zehn, Baron Reuter. Bitte, empfehlen Sie mich gütigst Ihrer Frau Gemahlin.“
Die Herren schüttelten einander kräftig die Hände. Sie hatten einander gut gefallen.
„Hätten wir doch mehr Geistliche von der Sorte!“ murmelte der Baron. „Kronenthal hat Glück – das muß man sagen.“
Ernst Philippi saß wieder auf seiner Reitdroschke. „Auf nach Rausuppen!“ sagte er halblaut.
[71] Friedlich und winterselig breitete sich wieder die weite Ebene vor ihm aus, nur ab und zu von niedrigem Buschwerk umstanden, das in der Sonne leuchtete wie weißes Korallengezweig. Ein stiller Wassertümpel hob sich in seiner weißen Umgebung dunkel hervor wie eine zerbrochene Spiegelscherbe. Weißbedachte Gesindehäuser und Bauernhütten guckten aus neugierigen, vom Alter mattgrün gefärbten kleinen Fensterscheiben dem vorüber eilenden Gefährt nach, und ein lichter Himmel spannte sich über das flache Gelände.
Ernst Philippis Gedanken weilten bei Claire. Sein Herz klang und blühte mitten in des Winters Stille und wiegte sich in ferne selige Träume. „Liebe ist Mut“ hatte sie gesagt. Welch vornehmes, feines und doch so selbstverständliches Wort! Wie war sie in ihrer Liebe aufgeblüht, wie hatte sich ihr stilles, ernstes Wesen entfaltet wie eine heitere, seltene Blume! Und wieder mußte er an ihre Begegnung auf dem Dampfschiff denken – „Schiffe, die nachts sich begegnen“.
Das Rollen eines Bauernfuhrwerks schreckte ihn aus seinem Sinnen. Johlende heisere Stimmen klangen mißtönig durch den stillen Winterfrieden. Er sah einen Moment in ein paar rohe betrunkene Gesichter und klirrend zerschellte eine leere Flasche an seinem Wagen. Sie war für seinen Kopf bestimmt gewesen.
„Mit solchen Kleinigkeiten halten wir uns heutzutage nicht mehr auf!“ murmelte er in grimmiger Selbstironie und faßte die Zügel fester.
[72] In scharfem Trabe flog der Fuchs vorwärts. Das Rausuppensche Gutsgebäude mit seinem weithin sichtbaren Turm lag bald vor ihm.
Er fand die Familie des Barons Osterloh beim Mittagessen und mußte sein Anliegen hinausschieben, denn er konnte natürlich die Teilnahme nicht ablehnen. Die Baronin, eine rothaarige schöngewachsene Dame mit wundervollen Händen empfing ihn mit freundlicher Zuvorkommenheit. Zwei junge Mädchen, die Töchter des Hauses, in halblangen Kleidern begrüßten Ernst Philippi mit einem schülerhaften Knix.
„Sie finden Elvire und Gerda wohl recht verändert, nicht wahr, Herr Kandidat?“ sagte die Mutter mit wohlgefälligem Lächeln.
Ernst Philippi blickte mit Behagen in die blütenreinen, jungen Gesichter. „Vor zwei Jahren spielten wir noch Blindekuh miteinander“, sagte er lächelnd, „heute sind die jungen Damen schon fast erwachsen.“
„Ich würde aber wieder sehr gern Blindekuh mit Ihnen spielen,“ sagte die Jüngere, „Sie waren ja so leicht zu fangen. Jetzt ist es so traurig, man hört nichts als schreckliche Sachen.“
„Ja, das ist nun mal so!“ sagte Baron Osterloh, eine mächtige breite Reckengestalt mit einem Wallensteinkopf. „Der Größenwahn ist in unser verblendetes Lettenvolk gefahren. Und das Schlimmste ist: die Sache nimmt so bald kein Ende. ,Nationale Erhebung’ nennen sie ihr wahnwitziges Treiben! Ein Volk, das so mit [73] Feuer und Schwert sengend und plündernd das Land durchzieht, das hat doch einmal klar seine nationale Unfähigkeit dokumentiert. Diese Mörderbande! Sehen Sie, Herr Kandidat, die Proklamation hier wurde dem Pastor von Birkenhof zugeschickt: ,Aus den Arbeiterliedern, herausgegeben von der lettisch sozialdemokratischen Partei!“ Mit dröhnender Stimme las er: „Dein Ende ist da, du groschenlüsterner Gutsbesitzer! Mit Feuer und Schwert hast du unser Land beraubt, siebenhundert Jahre lang hast du uns unsäglich gequält, den Schweiß unserer Väter hast du mit Blut gemischt getrunken und das Volk ausgehungert, bis es verreckte. Unsre Väter zeigen aus ihren Gräbern mit blutigen Fingern auf dich. Erst heute aber können wir rufen: Weh dir Deutschen! Wir wollen das Brot unsers Landes, die Früchte unsrer Arbeit nicht länger Schmarotzern geben. Und du, schwarzer Lügenbrauer, den wir in unsrer Einfalt für einen Gottesmann gehalten haben, du bist kein gerechter Gottesknecht, sondern lüstern nach dem Geld in der Hand der Reichen und lehrst mit unerhörter Schamlosigkeit das Evangelium, das die Reichen schon vor Jahrhunderten zur Bedrückung der Armen erdacht haben. Mit deinen saubern Lügen von den Himmelsfreuden, die uns für alles irdische Leid entschädigen sollen, hast du unsre Väter wie Schafe zu den Füßen der Räuber gehütet. Weh dir, Bösewicht! Flieht eilends, ihr verfluchten Volksaussauger! Zur Befreiung der gequälten Heimat sind die Werkzeuge schon unterwegs: Dolche, Kugeln, Bomben, Dynamit!“
[74] Während des Lesens schwoll eine mächtige Zornesader an der Stirn des Barons. „Ich denke, das genügt!“ sprach er, und mit der Gebärde des Ekels faltete er das saubere Schriftstück wieder zusammen und schob es in seine Rocktasche. „Eins vor allem ist mir klar: Sollen wir uns in dieser unerhörten Weise ruhig weiter beschimpfen lassen, ohne nur einen Finger zu rühren? Nein! sage ich. Zusammenhalten sollen wir, alle miteinander, Adel, Geistlichkeit und Bürgerschaft! Aufhören sollen die kleinlichen Sonderinteressen, soll das beständige Gekniffensein! Zusammenstehen sollen wir Deutsche alle, denn wir haben die gleichen Heiligtümer zu wahren. Und eine Lehre sollen wir uns ziehen aus dieser dunklen Zeit: aufgeben sollten wir unsern Adels- und Literatenhochmut! Habe ich nicht recht, Herr Kandidat?“
„Sie haben mir aus der Seele gesprochen, Baron Osterloh,“ sagte Ernst Philippi warm. „Jeder an seinem Teil sollte vor seiner Tür kehren und sich des Guten erinnern, das jeder Stand von dem andern empfangen hat.“
„Das ist ein gutes Manneswort!“ rief der alte Herr und schüttelte seinem Gast die Hand.
Man stand vom Tische auf, und Ernst Philippi fand Gelegenheit, Baron Osterloh seine Bitte vorzutragen. Sie wurde in der ehrlichen warmen Weise, die dem alten Herrn eigen war, genehmigt, und erleichterten Herzens fand sich der junge Mann unterwegs nach Finkenhorst.
[75] Baron Fink von Finkenhorst war ein ästhetischer Sonderling, Kunstkenner und Sammler. Vor allem interessierte er sich für Musik und besaß eine Sammlung aller möglichen und unmöglichen Instrumente. Für ein Spinett aus der Zeit Mozarts konnte er enorme Summen verschwenden. Sein Haus war geradezu ein Museum aller nur denkbaren Streich- und Blaßinstrumente, Harfen, Pauken, Trommeln und Zimbeln. Baron Fink war aber auch Musiker und Komponist und steckte beständig in irgend einer Melodie, die er harmonisieren mußte, oder viel mehr, beständig steckte eine Melodie in ihm.
Als Ernst Philippi ihm gemeldet wurde, trat der hagere pockennarbige Junggeselle, ein Motiv pfeifend, auf ihn zu, erkannte ihn zunächst nicht und reichte ihm zerstreut die lange Musikerhand. Wie von einer Tarantel gestochen sprang er aber sofort auf und rief mit überseligem Ausdruck: „Pardon, pardon! Ich hab’s, ich hab’s!“ Er griff ein paar Akkorde auf seinem Blüthner und ging auf eine kriegerische fanfarenartige Melodie über. „Aus den lettischen Kampfliedern und Kriegsgesängen!“ sagte er strahlend.
Ernst Philippi wußte nicht, was er aus dem wunderlichen Kauz machen sollt. Sein schauspielerisches Talent kam ihm, vereint mit einem glücklichen Humor, zu Hilfe. Mit einer Fingerbewegung strich er sich seinen blonden Haarschopf ins Gesicht, zog die Schultern hoch, runzelte die Brauen, nahm eine düster versunkene [76] Beethovenmiene an und sprach die Lormschen Verse:
Solang die Sterne kreisen
Am Himmelszelt,
Vernimmt manch Ohr den leisen
Gesang der Welt.
Dem seligen Nichts entstiegen,
Der ewigen Ruh,
Um ruhelos zu fliegen –
Wozu? Wozu?
Fassungslos, entgeistert starrte Baron Fink ihn an.
Allmählich glätteten sich Philippis Mienen, das düstere Beethovengesicht verschwand, die Haare flogen zurück. Mit ernsthaftem Lächeln saß wieder Kandidat Philippi vor dem verblüfften Junggesellen.
„Aber das ist ja ausgezeichnet!“ jappte der Baron. „Sie sind ja der geborene Schauspieler,“ fuhr er entzückt fort, „und so was nennt sich Kandidat der Theologie! Herr Philippi, Sie – Sie gehören ja auf eine große Bühne!“
„Ich stehe schon auf der Bühne des Lebens,“ sagte Philippi, „und zwar mit beiden Füßen. Und nun hören Sie, Baron Fink: Meinem Freunde, Pastor Berger, droht morgen von den Sängern der Kampfes- und Kriegslieder Gefahr. Sie wollen ihn während des Gottesdienstes überfallen. Dürfen wir das dulden, wir deutschen Männer? Ihre Nachbarn, der Rausuppensche Herr und Baron Reuter, haben mir ihre Hilfe bereits zugesagt. Darf ich morgen um zehn auch auf Ihre Anwesenheit rechnen, Baron? Pastor Berger weiß nichts davon.“
[77] „Aber ja, natürlich!“ rief der Baron, noch ganz verblüfft. „Nein, nein, sind Sie ein Künstler, ein echter Künstler!“ Es wurde ihm ordentlich schwer, sich von Philippi zu trennen. „Daß ich Sie nicht meiner Schwester Claudine vorstellen kann!“ sagte er betrübt. „Sie ist leider ausgefahren.“
Es dunkelte bereits, als der Kandidat seinen Heimweg antrat. Ein leiser Abendwind hatte sich erhoben. Die Tannenbäume hatten den Winter wieder abgeschüttelt und standen ernst und feierlich in ihrem dunkelgrünen Kleide. Leise senkte die Dunkelheit ihren düstern Mantel über den schweigenden Forst und öffnete weit und fragend ihre schwarzen Augen. Eine tiefe Wehmut von schmerzlicher Süßigkeit füllte des einsamen Mannes Seele, und gläubig dehnte sie sich empor zu dem Lenker aller Dinge. Schon kroch die Flamme des Aufruhrs leise glimmend immer näher und näher. Wie lange noch, und das Häuflein Deutscher stand wehrlos auf brennendem Boden.
„Schütze unser armes Land, großer Gott!“ flüsterten seine Lippen. Halb unbewußt und aus der Tiefe seines Herzens seufzte er: „Und schütze Claire!“
So, als hatte ein magnetischer Rapport Claire in seine Nähe gezaubert, stand ihre leichte biegsame Gestalt plötzlich im Waldesdunkel vor ihm und breitete ihre Arme nach ihm aus.
Er schrak zusammen. „Kind, was suchst du hier allein im Walde?“ fragte er mit bebender Zärtlichkeit im Ton.
Sie schwang sich auf die Reitdroschke hinter ihn und barg [78] ihr Gesicht an seiner Schulter. „Du bliebst so lange fort,“ murmelte sie, „ich ... ich war so bange nach dir. Wo warst du nur?“
„Ich habe einige alte Bekanntschaften erneuert,“ sagte er leichthin.
„Und weiter nichts?“ fragte sie ernsthaft.
Er zögerte einen Augenblick. „Doch,“ gestand er. „Ich habe einige Gutsherren um ihren persönlichen Schutz für Robert Berger gebeten. Ihm droht ein Überfall während des Gottesdienstes.“
Sie atmete tief. „Mir ahnte nichts Gutes,“ sagte sie. „Er war so sonderbar zärtlich gegen die Kleinen heute und ließ seine Frau den ganzen Tag nicht aus den Augen.“ Sie brach in ein heftiges Schluchzen aus. „Die arme, arme Frau!“ stöhnte sie.
„Ob sie etwas ahnt?“
„Eine allgemeine Gefahr vielleicht, doch ist sie zu fest von der Liebe und Anhänglichkeit der Gemeinde zu Pastor Berger überzeugt. Ach, Ernst ...“
„Liebe ist Mut!“ sagte er. „Dein schönes Wort hat mir auf der ganzen Fahrt das Geleit gegeben.“
Sie trocknete ihre Tränen und lächelte wieder. „Und dir ist nichts passiert?“ fragte sie.
„Wie du siehst, bin ich heil und ganz. Ein paar betrunkene Kerle johlten mich an.“
Sie streichelte seinen Arm. „Und du bist derselbe schwächliche [79] Bub, der in Bewußtlosigkeit versank, als er hörte, daß es nichts sei mit dem Schauspielern. Wenn Dein Vater dich jetzt sähe!“
„Ob er viel Freude an mir hätte?“
„Und ob!“ sagte sie mit leuchtendem Blick. „Stolz wär’ er auf dich!“
„Das ist mir denn doch durchaus nicht gewiß,“ meinte er mit skeptischem Lächeln. „Mein Vater war ein praktischer Mann, durch und durch Realist, unter den gegenwärtigen Verhältnissen würde er es für geratener halten, Schauspieler als Pastor zu sein.“
„Aber nein!“ rief sie entrüstet. „Du, ich hab’ übrigens einen Brief von Tante Griseldis.“
„Nun was schreibt sie?“
„Du sollst ihn selbst lesen. Sie gratuliert mir in höchst feierlichem Ton zu unserer Verlobung, zu ,der Wendung meines Geschicks’, wie sie sagt, aber eine verhaltene Trauer über das Stübchen im Katharinenstift, das nun leer bleiben soll, blickt noch durch. Die gute Tante Griseldis!“
Er drehte sich lachend um und sah sie zärtlich an. „Die armen Alten!“ sagte er mitleidig. „Claire, sind wir nicht glückliche Menschen?“
Sie schlug ihre Arme um seinen Nacken. „Ja!“ rief sie aus vollster Seele.
Sie schwiegen eine Weile. Die Reitdroschke rasselte langsam vorwärts und holperte stöhnend über Wurzelknorren.
[80] „Du,“ begann sie wieder, „ich hab’ die Frau Pastorin doch bedeutend lieber als deinen Freund.“
„Hast du dir’s überlegt?“ Er lachte.
„Nein, ich verehre Pastor Berger nach wie vor, aber ich glaube, er mag mich nicht recht; so was fühlt sich.“
„So? Woraus schließt du denn das?“
„Er neckt mich ein bischen viel und stellt mir in jeder Beziehung seine Frau zum Vorbild.“
„Ja, mein Herz, das ist doch sehr nett von ihm. Seine Isa ist für ihn der höchste Maßstab.“
„Gut, gut,“ lachte Claire, „aber von der Unterrichtsmethode weiß ich doch mehr als sie. Der Pastor ist nicht ganz objektiv[WS 5]“
Nun mußte Ernst Philippi herzlich lachen. „So wenig objektiv bin ich mit vollem Bewußtsein. Über meine Claire geht mir nichts und niemand.“
Sie schloß ihm den Mund mit einem Kuß. Der Fuchs bog jetzt in die Lindenallee, stieß ein fröhliches Wiehern aus und setzte sich in Trab.
„Er wittert seinen Stall,“ sagte Claire und rückte sich zurecht. „Nun ist’s auch für uns höchste Zeit, auf die Erde zurückzukehren und gesittet und vernünftig zu sein!“ – – – – – – – –
Robert Berger stand im Sonntagsornat. Isa hüllte sich in ihren Mantel.
„Du siehst blaß aus, Liebling,“ sagte er zu seiner Frau, „tu mir den Gefallen und komme heute nicht in die Kirche.“
[81] „Aber warum nicht?“ fragte die Pastorin und riß ihre großen Kinderaugen weit auf. „Gerade heute wollte ich gehen. Ich habe freilich ein wenig Kopfschmerz.“
„Eben darum sollst du zu Hause bleiben. Lebe wohl, Lieb!“ Er küßte sie.
Warum nur hatte seine Stimme gezittert? Eine seltsame Unruhe ergriff die Frau.
Sie stand am Fenster und blickte der hohen gebietenden Gestalt ihres Mannes nach, wie sie langsam über die Wiese der Kirche zuschritt.
Der Glockenläuter hatte den Pastor schon gesehen, denn soeben begann er andauernd zu läuten. Es schienen ungewöhnlich viele Menschen auf dem Kirchenplatz vor dem Kruge versammelt, Isa Berger begann mechanisch die Fuhrwerke zu zählen, immer wieder mußte sie von vorn beginnen, es wimmelte auf dem Platz wie in einem Ameisenhaufen. Kein Wunder, daß die Leute von nah und fern herbeieilen, um meinen Mann zu hören, dachte sie stolz, wer ist denn auch wie Robert!
In diesem Augenblick trat Claire in die Stube. „Darf ich Sie bitten, Frau Pastorin,“ sagte sie schüchtern, „mir eine Stelle aus dem Englischen übersetzen zu helfen? Sie ist mir nicht recht verständlich.“
„Gern, liebes Fräulein, geben Sie nur her.“
„Sie sehen angegriffen aus, Frau Pastorin,“ sagte Claire teilnehmend. „Kommen Sie auf Ihr Zimmer, da legen Sie sich [82] ein wenig aufs Sofa, ich mache es Ihnen recht bequem, und wenn Sie erlauben, bleibe ich ein wenig bei Ihnen.“
Was ist nur heute in alle Menschen gefahren? grübelte Isa Berger, und laut sagte sie: „Sie behandeln mich ja wie eine Schwerkranke. Mein Mann, jetzt Sie – zuerst soll ich durchaus nicht in die Kirche, und ich bin doch einmal keine Kirchenläuferin, dann soll ich mich von Ihnen verziehen lassen. Ich habe doch nur Kopfweh, das passiert mir öfters. Seien Sie nicht so gut zu mir, Fräulein Schenkendorff, man hat seine Tage, wo man alles andre verträgt, nur nicht Güte.“
„Liebe Frau Pastorin,“ sagte Claire weich, „nennen Sie mich Claire.“
Isa Berger sah in die ehrlichen grauen Augen des jungen Mädchens, zog ihren Kopf zu sich heran und küßte sie. „Gern, aber nur, wenn Sie mich Isa nennen wollen.“ Sie drückte ihren schmerzenden Kopf in das Sofakissen, wendete Claire den Rücken zu und lag ganz still. „Lesen Sie mir ein wenig vor, Claire,“ bat sie, „und seien Sie mir nicht gram, wenn ich darüber einschlafe.“
Claire begann mit hochklopfendem Herzen zu lesen, so einförmig und monoton, wie sie vermochte. Wie ein Plätschern von Regentropfen fielen die Worte von ihren Lippen, und von Minute zu Minute stieg ihre Bangigkeit, und sie drohte ihr die Kehle zuzuschnüren. Isa Berger lag ganz still, aber an [83] dem krampfhaften Zucken ihrer Schultern sah Claire, daß sie leise vor sich hin weinte. – –
Die kleine Kirche war gedrängt voll. Kopf an Kopf saßen die Bauern auf den Bänken, Kopf an Kopf standen sie um den Altar und im Mittelgange. Auf der vordersten Bank saß der alte Krimpe, neben ihm seine drei Söhne und Ernst Philippi, vor ihnen stand eine Reihe lettischer Frauen. Die sechs Barone hatten sich rund um die Kanzel gruppiert.
Der Pastor trat auf die Kanzel und beugte sein Haupt zum stillen Gebet. Dann sah er auf und blickte ruhig in die versammelte Menge hinein. Laut und deutlich verlas er den heutigen Text vom verlorenen Sohn.
Ernst Philippis nervöse Züge zuckten, er wartete in äußerster Spannung.
Die Predigt begann. In lichten, klaren Worten legte Robert Berger die Stimmung des heimkehrenden verlorenen Sohnes dar. Furcht und Hoffnung, Heimweh und Sehnsucht zittern in des Jünglings Seele, dann aber bei den liebenden Worten des Vaters überbraust jubelnde Freude alle kleinmütigen Gedanken. In gottbeflügelten gewaltigen Tönen schilderte der Redner die verzeihende Liebe des Vaters, und seine Worte fanden in der horchenden Gemeinde einen wunderbaren Widerhall. Erhaben mutig stand der Mann da, hoch aufgerichtet, und Ernst Philippi wußte, sein Freund hatte sich die Seele freigeredet und war dem Schicksal gewachsen, in welcher Form es ihm auch nahen sollte.
[84] In atemloser Spannung lauschte die Gemeinde. Ein unterdrücktes Schluchzen seufzte durch die Kirche. Wie mit lichter Geisterhand hatte die große steinfeste Gesinnung Robert Bergers sich der versammelten Menge zauberkräftig mitgeteilt und hielt sie fest unter dem Bann seiner starken Persönlichkeit.
Nach dem kurzen Kanzelvers neigte sich der Pastor zum allgemeinen Kirchengebet ... „Laß’ deine Gnade groß werden über dem Kaiser, unserm Landesherrn, Nikolai Alexandrowitsch ...“
Da entstand[WS 6] eine plötzliche Bewegung im Hauptgange – – „Du Lügner!“ brüllte eine heisere Stimme. „Herunter von der Kanzel, du schwarzer Gottesknecht!“
Acht bis zehn unbekannte Männer drängten gewaltsam nach der Kanzel hin. Wie eine Mauer hatten sich der alte Krimpe, seine drei Söhne und Ernst Philippi erhoben und stellten sich in den Mittelgang vor die heranstürmende Schar.
„Ihr seid hier vor die unrechte Schmiede gekommen,“ sprach der Alte gebietend und hob seine Hand, „geht zurück, woher ihr gekommen seid!“
„Nieder, nieder mit dem Pfaffenknecht!“ Ein Faustschlag traf den Alten, daß er taumelte.
Hoch empor hielt der Vorderste der Bande, ein Riesenkerl, einen roten Sack. „Jetzt geht’s eurem Liebling an Hals und Kragen!“ brüllte er höhnisch, „vor allem soll er in den Sack!“
„Hinein in den Sack!“ johlte und zeterte die Bande und drängte wieder vorwärts.
[85] Ein stummes Ringen begann. Ernst Philippi stürzte sich geschmeidig wie eine Katze von rückwärts auf den Anführer und hing sich an seinen Kragen fest, der alte Krimpe packte den Riesen bei den Schultern und hielt sie wie mit eisernen Schrauben umklammert. Seine Söhne und die Schar der Weiber warfen sich den übrigen Aufrührern entgegen.
Kreischend drängte die Masse der Ausgangstür zu.
„Feiglinge!“ ertönte die gewaltige Stimme des Rausuppenschen Barons „Steht! Verlaßt ihr so euren Pastor in der Not?“
„So seid ihr auch hier, ihr deutschen Barone? Landaussauger! Leuteschinder! Deutsche Hunde!“ brüllte der Riese und schlug schäumend vor Wut um sich. Ins Gesicht getroffen sank der alte Krimpe nieder.
„Ruhe im Hause Gottes!“ hallte groß und feierlich die Stimme Bergers. „Schieß, wenn du kannst!“ Er sah die Mündung einer Pistole vor sich schwanken.
Sechs blanke Revolver hoben sich gleichzeitig gegen den Anführer.
„Wag’ es, und du bist ein toter Mann! Nieder mit der Waffe!“ donnerte der Rausuppensche.
Ein feiges Flirren in den Augen des Bandenführers – die Waffe senkte sich.
„Hinaus dort durch die Sakristei!“ kommandierte der alte Baron. Die sechs Revolver folgten drohend und unerbittlich den Bewegungen der Aufrührer.
[86] Schweigend drückte sich die Bande beiseite. Die Sakristeitür schloß sich hinter dem letzten Mann.
Einen Augenblick herrschte Totenstille.
„Kommen Sie, Herr Pastor. Weg frei, ihr Leute!“ Und unter der Bedeckung der Barone schritt der Pastor in den Mittelgang.
„Ich dank’ Euch, alter Krimpe; ich dank’ euch, ihr Frauen!“ sprach er. „Gott lohne euch eure Treue!“
Erhobenen Hauptes, mit seltsam glänzenden Augen trat Robert Berger ins Freie.
Ein schneidender Windstoß fuhr ihm entgegen, es war ein böses Wetter geworden.
Scheu wichen die Leute zur Seite. „Da fahren sie hin!“ sagte ein alter Bauer und wies auf den Weg.
Acht Radfahrer – der vorderste schwenkte einen roten Sack wie eine Fahne vor sich her – sausten an dem Kirchenkruge vorüber die Landstraße entlang.
„Daß wir sie entkommen ließen, die Halunken!“ murmelte Baron Osterloh zwischen den Zähnen.
Da stieg der alte Rausuppensche auf einen Prellstein und rief: „Ihr Leute von Kronenthal! Hört mich! Eine Schmach ist heute eurer Kirche angetan, eine Schmach eurem Seelsorger, der seit zehn Jahren wie ein Freund zu euch gewesen ist. Wollt ihr diese Schmach auf euch sitzen lassen? Seht,“ – mit einer [87] zornigen Gebärde streckte er den Arm aus – „da ziehen sie hin wie erbärmliche Hasen, die in die Flucht gejagt sind, eure Volksbeglücker und Vorkämpfer. Wenn sie nur ihr Fell in Sicherheit bringen! Wollt ihr solchen Männern trauen? So haltet doch eure Augen offen und fragt euch: Ist das Wahrheit, was sie euch lehren? Werdet ihr wirklich so geknechtet und bedrückt, wie sie sagen? Gebt Antwort, ihr Männer von Kronenthal!“
Eine tiefe Stille. Erregte, erhitzte Gesichter ringsum. „Er ist ein Rungs!“ schrie eine Stimme. „Hört nicht auf den Rungs!“
Alles schwieg. Furchtlos, mit Falkenblicken sah der alte Rausuppensche sich um. „Männer von Kronenthal,“ rief er wieder, „kommt zur Besinnung! Seht hier, meine grauen Haare haben viel erlebt, und das weiß ich: wer seine Kirche und seinen Kaiser verachtet, der ist ein elender Mann! Dem blüht kein Glück, einem rechtschaffenen Manne aber folgt Achtung und Segen. Geht nach Hause, ihr Leute, und fragt euch auf’s Gewissen, ob der alte Rausuppensche Herr die Wahrheit spricht oder nicht.“
„Er spricht die Wahrheit!“ rief schrill und freudig die Stimme eines alten Mütterchens. „Schon als kleiner Jungherrchen hat er immer die Wahrheit gesprochen. Ich kenn’ ihn von klein auf, war seine Amme!“
„Alte Lihbing!“ rief der Baron bewegt. „Alte Lihbing, wo kommst du her?“ Er sprang vom Prellstein und drängte zu der Alten hin.
Strahlend vor Freude küßte sie ihm die Hand.
[88] „Hurra! Der Rausuppensche Herr! Hurra!“ schrien einige Stimmen.
Ein paar Mützen flogen in die Luft, die Stimmung war umgeschlagen – aufgehellte Mienen, freudige Gesichter.
„Ich dank’ euch, Kinder,“ rief der alte Herr, „die Ehre des Lettenvolkes ist noch nicht ganz danieder, es gibt gottlob noch echte Männer unter euch!“
Da flog eine hellgekleidete Frauengestalt ohne Hut und Mantel unter die Menge. Ihre Augen leuchteten fieberhaft. Isa Berger war’s. „Was geht hier vor?“ schrie sie. „Hier geht etwas vor! Ich fühl’s, ich weiß es ... Robert, lebst du?“ Schwer atmend lag sie an seiner Brust.
Erregte Gruppen bildeten sich um sie her. Unbehelligt geleiteten die Barone den Pastor und seine Frau bis vor ihr Heim.
Robert Berger schwamm es vor den Augen. Eine nachträgliche Schwäche drohte ihn zu übermannen. „Wie kam es, daß die Herren alle so rechtzeitig da waren?“ fragte er und blickte wie ein Kind von einem zum andern.
„Lassen’s nur gut sein, lieber Pastor,“ lachte der Rausuppensche gemütlich und klopfte ihn auf die Schulter. „Sie haben einen ganz tüchtigen Kandidaten!“
Robert Berger begriff noch immer nicht. Rasch kam seine Frau ihm zu Hilfe. „Darum also waren Sie so lange fort gestern abend, Herr Kandidat!“ rief sie mit leuchtenden Augen und reichte ihm beide Hände. „Sieh, Robert, dein Freund ist bei all den [89] Herren persönlich gewesen. O, wie danke ich Ihnen, Ihnen allen.“
„Aber das war doch selbstverständlich, gnädige Frau.“
„Treten Sie ein, meine Herren,“ bat sie, „und trinken Sie eine Tasse Tee oder einen Kognak, es ist bitter kalt heute.“
„Verzeihung, gnädige Frau, wir müssen heim, da kommen auch schon unsre Equipagen.“
Baron Fink von Finkenhorst trat zögernd näher. „Wenn Sie erlauben, Frau Pastor,“ sagte er, „komme ich mit herein, ich muß Herrn Kandidaten Philippi noch einen Moment sprechen.“
Grüßend und ihre Hüte schwenkend rollten die übrigen Herren in drei Wagen davon.
Ängstlich zog Isa Berger ihren Mann in das Haus. „Und du hast die ganze Zeit in der Kälte gestanden!“ klagte sie. „Mein Gott, wenn das nur gut abläuft!“
Sie traten in das Haus.
„Hören Sie, Herr Kandidat,“ begann Baron Fink und zog Philippi in eine Ecke, „ich kenne Possart persönlich, hier ist ein Brief an ihn. Lesen Sie – er wird Ihnen die nötigen Schritte ebnen. Sie müssen zur Bühne!“
Mit einem klaren Lächeln sah Ernst Philippi den sonderbaren Gesellen an. „Vor vier Wochen noch hätte ich Ihr Anerbieten mit Dank und Freude angenommen, Baron Fink,“ sagte er fest, „heute weiß ich, daß meine Pflicht wo anders liegt, und [90] sehen Sie doch nur mein steifes Bein, ich bin kein Bühnenheld, Baron.“
„Das – das hab’ ich ja gar nicht bemerkt,“ sagte Baron Fink betrübt. „Das tut mir aber wirklich leid! – Hören Sie,“ fuhr er, von einer neuen glänzenden Idee erfaßt, fort, „meinen lettischen Kriegsgesang habe ich für Orchester gesetzt, den muß ich Ihnen unbedingt noch einmal vorspielen. Besuchen sie mich doch bald.“
Isa Berger kredenzte dem Baron ein Gläschen Kognak, und auf einem Tablett brachte das Dienstmädchen heißen Tee herein. „Trink, Robert, trink!“ bat Isa Berger, „und dann gleich ins Bett. Sie entschuldigen, Baron Fink.“
Drei Tage waren vergangen. Ein unheimlicher Druck lastete auf dem Pastorat.
Robert Berger war schwer krank und wälzte sich ruhelos auf seinem Lager. „Ich trage die rote Fahne nicht! Nein, nein, ich trage sie nicht! Schieß!“ schrie er wild und machte Miene, aus seinem Bett zu springen.
Ernst Philippi und Isa Berger hatten Mühe, den fiebernden Kranken zu bändigen.
„Um Gottes willen, einen Arzt, Herr Kandidat!“ stöhnte Isa. Ihre tränenlosen, weit aufgerissenen Augen, ihr angstverzerrtes Gesicht schnitten Ernst Philippi ins Herz.
„Ich fahre sofort in die Stadt, liebe verehrte Frau Pastorin,“ sagte er, „und kehre nicht ohne Doktor wieder. Lassen Sie sich [91] von Claire bei der Pflege helfen und schicken Sie den Kutscher nach dem alten Krimpe, auf den können Sie sich verlassen.“
Es war zehn Uhr abends, als Ernst Philippi in einem kleinen einspännigen Schlitten in den Wald hineinsauste. In den letzten Tagen war tiefer Schnee gefallen, jetzt knirschte der Frost unter den Kufen des Schlittens. Eine klare kalte Winternacht voll glänzender Sterne hing über den schweigenden weißen Bäumen. Hoch in unendlicher Ferne stand der blasse Mond mit seinem runden Silbergesicht und wunderte sich über den einsamen Mann, der in so unvernünftiger Eile durch den Forst jagte. Ernst Philippi nickte ihm zu. „Ja du,“ murmelte er, „du hängst da in deiner kühlen luftigen Höhe und weißt nicht, wie bang und heiß uns Menschenkindern zumute sein kann!“
An der Forstei vorüber flog der kleine Schlitten, wieder schlug der Hund an, und wieder leuchtete es wie vor zwei Monaten durch die jetzt verschneiten Büsche. „Hussa, Presto, vorwärts!“ rief Ernst Philippi und schwang die Peitsche. Er war wie im Fieber. „Hier war’s,“ sagte er halblaut, „wo man eine Strecke abschneiden konnte, wenn man quer über’s Feld ging.“
Rasch bog er von der Hauptstraße ab und fuhr über den verschneiten Graben auf die Wiese. Eine baufällige Heuscheune stand melancholisch einsam mitten auf der silberglänzenden Fläche. An der Scheune vorüber mußte er – ja, so war’s. Durch flockige vorüberfliegende Wolken lugte der Mond, und eine große einsame Stille schärfte die wachsamen Sinne des jungen Mannes. Sein [92] nervöses, scharf angespanntes Ohr vernahm deutlich Schritte, als sei ein ganzer Trupp Männer unterwegs. Das bedeutete zu dieser Stunde nichts Gutes. Wohin nur mit dem Gefährt? Hier auf der unbedeckten Fläche war es jedem Blick ausgesetzt. Ein seltsamer Instinkt schien Ernst Philippi zu beseelen: er überlegte nicht mehr, er handelte. Entschlossen sprang er aus dem Schlitten, führte das Tier am Zügel hinter die Scheune und band es fest. Dann zog er einen gestrickten Schal aus der Tasche, schlang ihn in Bauernart zweimal um den Hals, riß das Futter aus der Fellmütze des Pastors, wandte sich um und schlich sich zu Fuß an die Hauptstraße zurück. Hier warf er sich in den Schnee und horchte. Immer näher kamen die Schritte, immer näher. Ein paar schneebedeckte Tännlinge am Grabenrand trennten ihn von der Landstraße. Sein Herz klopfte in starken dumpfen Stößen. „Zur Not kann ich ja auch einen betrunkenen Landstreicher abgeben.“ Steif und starr blieb er liegen.
„Morgen setzen wir den Kronenthalschen Pastor ab,“ sprach ein langer Kerl mit dumpfer Stimme, „lange genug hat er seiner Gemeinde von der Kanzel gute Lehren verkündet. Nun ist die Reihe an uns!“
„Nun ist die Reihe an uns!“ wiederholten zwei, drei Stimmen.
„Den hat schon ein anderer abgesetzt – der ist ja todkrank, ich weiß es vom Küster!“ rief jemand.
„Um so besser, dann brauchen wir uns mit dem da nicht [93] weiter aufzuhalten, wir haben wichtigere Dinge vor,“ sprach der Anführer wieder.
„’s wird sich schön wärmen lassen an den Flammen der schwelenden Gutshöfe – ha ha ha!“ brüllte eine trunkene Stimme.
„Stille! Wer untersteht sich da, so laut zu reden?“ Lautlos huschten einige wilde Kerle hin und wieder. „Dem Finkenhorstschen werdet ihr aber doch nichts tun?“ sagte eine ängstliche Stimme, und ein kleiner krummbeiniger Mann drängte sich an den Langen. „Das gnädige Fräulein, die Schwester des Rungs, ist gut zu mir gewesen, als ich krank lag, hat mir Wein gebracht und Suppe.“
„Ruhe! Wir kämpfen nicht gegen Weiber, und „gnädige Fräuleins“ gibt’s nicht mehr, merk’ dir das, Dumpje Marting. Seid ihr bereit?“
Im Schatten der Tannenbäume verschwanden die finstren Gesellen.
In Schweiß gebadet lag Ernst Philippi auf dem festgefrorenen Schnee. Er richtete sich auf und spähte die Straße hinauf, hinab. War das alles Wirklichkeit gewesen oder ein spukhafter unbegreiflicher Traum? In der Richtung nach Finkenhorst quer über den Weg, auf welchem er gekommen war, hörte er die Schritte fortstampfen.
So schnell ihn sein steifes Bein trug, lief er zur Scheune zurück, band das Pferd los und warf sich ächzend in den Schlitten. Sein Plan war gefaßt. „Gott sei uns gnädig!“ stöhnte er, und [94] fort sauste das Gefährt in wilder Jagd wie ein nächtiges Gespenst über die blanke Schneefläche, als habe es den Satan im Rücken.
Da war keine Zeit zum Denken. Und Ernst Philippi dachte nichts mehr, er schrie zu seinem Gott in seiner Angst und Qual, an ihm vorüber flogen Bäume, Telegraphenstangen und Gelände, und wie aus schwerem dumpfem Traum erwachend, sah er sich in der kleinen schlummernden Stadt. –
Dreiviertel Stunden später sprengte ein Pikett berittener russischer Kosaken in geschlossenem Trabe dieselbe Landstraße zurück. Vor ihnen her wie ein winziger Punkt sauste ein kleiner Schlitten über die Schneefläche.
„Der Gaul hat den Teufel im Leibe! Das muß man sagen!“ rief der Leutnant lachend. „Sollen wir uns von dem Gaul eines deutschen Pfarrers beschämen lassen? Vorwärts, Kinder!“
Gegen den sternenklaren Himmel schlug eine feurige Lohe.
Mit den Zähnen knirschend schwang Ernst Philippi die Peitsche. „Finkenhorst brennt, Doktor!“ sprach er heiser. „Die Kosaken kommen zu spät.“
„Wie gewöhnlich!“ nickte der kleine Mann im Biberpelz. „Wann kommen jemals Kosaken in Kurland zur Zeit?“
Ein vielstimmiges Rindergebrüll tönte dumpf und klagend durch die stille Winternacht.
„Sie haben die Ställe in Brand gesetzt, die Banditen! [95] Das Herrenhaus steht noch, wie mir scheint.“ Philippi sprach mit zusammengebissenen Zähnen.
„Daß so ein Jammer über unser Gottesländchen kommen mußte! Womit haben wir das verschuldet?“ murmelte Doktor Sartorius. Auch ihm wurden die Augen feucht.
Es wurde eine schweigsame Fahrt. Keiner der beiden Männer sprach mehr ein Wort. An der verhängnisvollen Stelle vorüber flog der Schlitten, wo Ernst Philippi, von ein paar jungen Tannen notdürftig verdeckt, auf dem Schnee gelegen und den ganzen düstern Zug hatte vorüberschreiten sehen. Eisig kalt kroch es ihm über den Rücken. Unwillkürlich lockerte er die Zügel und ließ den schweißtriefenden Gaul eine Weile Schritt gehen. Hinter ihm her jagten die Kosaken heran und bogen links vom Hauptwege in der Richtung nach Finkenhorst ab. Schweigend fuhren die beiden Männer in den weißen Tannenwald hinein, ein jeder von ihnen war mit seinen trüben schweren Gedanken allein. Das qualvolle Blöken und Brüllen der Kinder tönte noch immer in ihren Ohren.
Was ist aus unserm Gottesländchen geworden? – Jetzt knatterte eine Salve von Flintenschüssen; sie kamen aus der Richtung von Finkenhorst.
Die Männer drückten einander stillschweigend die Hand.
Es war ein Uhr nachts, als das dampfende Tier vor dem Pastorat hielt.
Auf der Schwelle stand im Winterpelz eine zarte Mädchengestalt. [96] „Gott sei Dank, du bist da!“ rief Claire. „Der Pastor hat ein paar Stunden geschlafen!“
„Doktor Sartorius – meine Braut, Fräulein Schenkendorff!“ stellte Ernst Philippi vor.
„Bitte treten Sie einen Augenblick in den Saal, Herr Doktor, und erwärmen Sie sich durch ein Glas Kognak!“
Der Doktor stürzte hastig zwei Glas Kognak herunter und wärmte seine Hände am Ofen.
Übernächtig und blaß trat Isa Berger zu ihnen. „Guten Abend, Herr Doktor!“ sagte sie tonlos. „Ich habe für Sie das Zimmer neben dem Herrn Kandidaten herrichten lassen, Sie bleiben doch natürlich die Nacht hier.“
Der kleine Mann verbeugte sich. Sein spitzes Maulwurfsgesicht lächelte scharfsinnig und aufmerksam. „Wenn es Ihnen recht ist, komme ich gleich mit zu dem Herrn Pastor, hm!“
Auf den Zehenspitzen trippelte der kleine Mann hinter der schlanken Gestalt Isas aus der Tür.
Claire flog an Ernst’s Brust.
„Claire, mein Lieb, ich habe Furchtbares erlebt!“ stöhnte er erschöpft und preßte sie leidenschaftlich an sich; dann drängte er sie sanft fort: „Geh, geh, vielleicht bist du dort nötig.“
Die Untersuchung war zu Ende. Apathisch lag Robert Berger da. Atemlos hing Isa an den Lippen des Arztes. Er reichte ihr die Hand und sah sie fest an. „Eine schwere Lungenentzündung, [97] gnädige Frau. Nicht hoffnungslos –“ fügte er rasch hinzu.
Claire stand neben der unglücklichen Frau. „Isa,“ flüsterte sie, „Mut, Mut! Liebe ist Mut!“
Es folgten schwere Tage und furchtbare Nächte, Minuten voll aufflackernder Hoffnung und Stunden zehrender Qual. Drei Menschen rangen unablässig um das teure Leben, und an einem feucht-schweren grauen Wintermorgen war die Krisis vorüber.
Wieder stand Doktor Sartorius vor dem Lager des Kranken. Ein ernstes Lächeln glitt über seine spitzen Züge. „Ich gratuliere Ihnen, gnädige Frau,“ sprach er, „der Pastor ist vorderhand außer Gefahr.“ Damit begaben sie sich in Robert Bergers Arbeitszimmer.
Schmerz läßt sich ertragen, unerwartete Freude aber ist häufig der überquellende Tropfen im Becher des Leides.
Schwer glitt Isa Bergers Haupt vornüber auf den Schreibtisch ihres Mannes. Sie lag in tiefer Bewußtlosigkeit. Als sie wieder zu sich kam, mußte sie weinen wie ein kleines Kind.
Der Doktor ließ sie ruhig ausweinen. „Gnädige Frau,“ sagte er, „ich bin noch nicht zu Ende. Die akute Gefahr ist beseitigt, aber ich darf Ihnen nicht verschweigen, daß Sie jetzt nicht hier im Norden bleiben dürfen. Sie müssen in den Süden, und zwar so bald als möglich. Die Lunge Ihres Gatten ist angegriffen.“
Entgeistert sah Isa Berger den Doktor an. „Ich verstehe [98] Sie nicht,“ murmelte sie. „In den Süden?“ Sie stützte den schmerzenden Kopf in die Hand und versuchte zu denken. Wie eine Woge um die andre brauste es ihr in den Ohren und klang wie von ferne an ihr Bewußtsein: in den Süden! „Mein Gott, womit denn?“ sagte sie hilflos wie ein kleines Kind ...
Die Genesung Robert Bergers schritt stetig vor. Stundenlang lag er ruhig auf dem Bett mit einem seltsamen Lächeln auf den eingefallenen Zügen. Die schrecklichen Bilder jenes Sonntags stiegen nur schattenhaft vor seine noch halb schlummernde Seele, zwei Dinge aber waren ihm klar, gewiß und deutlich: der alte Krimpe hatte ihn lieb, und Ernst Philippi wollte wirklich Pastor werden. Mit einem fast zärtlichen Ausdruck folgte er den Bewegungen seines Freundes, ja er begann auch wieder Claire zu necken. Nie aber wäre es so gut vorwärtsgegangen, wenn es Isa nicht gelungen wäre, ihre heimlichen Sorgen vor ihm zu verbergen.
Das Auge des erfahrenen Arztes jedoch ließ sich nicht täuschen. Besorgt sagte er einmal zu Ernst Philippi: „Die Frau Pastorin gefällt mir gar nicht, ich meine, sie macht sich pekuniäre Sorgen. Ihre sensitive Natur ist durch die letzten Wochen aufs äußerste überspannt worden. Ich will mit dem Pastor reden.“ Er schloß die Tür des Krankenzimmers hinter sich, und Ernst Philippi und Claire traten zu Frau Berger.
„Verehrte liebe Frau Pastorin,“ begann Ernst Philippi weich, „warum grämen Sie sich jetzt? Bin ich nicht Ihr Freund? [99] Und ist es nicht selbstverständlich, daß Freunde dazu da sind, um einander zu helfen? Ich bin nicht ohne Vermögen, wie Sie wissen. Wie könnte ich es besser verwenden, als indem ich es meinem Freunde zur Verfügung stelle! Da ist doch kein Wort darüber zu verlieren!“
Die großen Kinderaugen sahen ihn trostlos an. „Robert wird Kronenthal nie verlassen!“
„Um hierher zurückzukehren, wird er es, und Ihnen zuliebe wird er es erst recht,“ beharrte Ernst Philippi, und seine Augen leuchteten zuversichtlich. „Sehen Sie, da kommt ja schon Doktor Sartorius. Nun, war unser Kranker ebenso schwierig wie seine Frau Gemahlin?“
„Unglaublich hartnäckig!“ polterte der kleine Mann mit dem Maulwurfsgesicht. „versuchen Sie Ihr Heil, Herr Kandidat!“
Mit heiter-zuversichtlicher Miene ging Ernst Philippi zu seinem Freunde. „Höre, mein lieber Robert,“ sagte er, „was sind das für Sachen? Ich komme, um dir einen netten kleinen Vorschlag zu machen: Du gehst mit Frau und Kindern auf einen, eventuell zwei Winter in den Süden und überläßt mir inzwischen als deinem Adjunkten dein Amt. Was sagst du zu dem Plänchen?“
Robert Berger schüttelte den Kopf und wollte eben den Mund zu einer Erwiderung auftun. Kurz und gelassen schnitt Ernst Philippi ihm das Wort ab. „Mein lieber guter Junge,“ sagte er, und sein zweiter und sein kleiner Finger begannen einen bedächtigen Triller auf der Bettdecke, „allen Respekt vor dir als [100] Seelsorger, aber wenn du jetzt nicht tun willst, was notwendig ist, bist du ein ganz gewöhnlicher Egoist. Sieh doch deine Frau an; mit ihrer Nervenkraft ist’s zu Ende. Sieht sie nicht aus wie ihr eigner Schatten? Hast du denn keine Pflichten gegen deine Familie, nur Pflichten gegenüber dem Amt? Geld? Darüber verlieren wir kein Wort weiter. Es ist da, sobald du es brauchst und wieviel du brauchst, und jetzt ziehst du sofort ein freundliches Gesicht und machst deiner verehrten Frau Gemahlin nach all den schweren Tagen auch eine ordentliche Freude!“
Robert Berger schwieg noch immer. Endlich streckte er seinem Freunde eine arme abgemagerte Hand hin und sprach. „Du hast gesiegt!“
Ernst Philippi öffnete die Tür weit, sein Gesicht strahlte: „Nur herein, Frau Pastorin!“ rief er übermütig. „Der Adjunkt von Kronenthal hat seine erste Seelsorge mit Erfolg und Glück durchgeführt.“
Isa kniete schluchzend an dem Bett ihres Mannes nieder, die Gatten hielten sich fest umschlungen.
Im Nebenzimmer aber lag Claire lachend und weinend in den Armen des Geliebten.
Doktor Sartorius rieb sich schmunzelnd die Hände. „So weit hätten wir sie glücklich!“ brummte er. Dann ging er ins Kinderzimmer, zog die kleinen Mädchen beide auf den Schoß und gab jedem einen herzhaften Kuß. „Nun reisen wir allesamt nach Italien!“ sagte er vergnügt, „und Elschen und Marthchen [101] werden große Guckaugen machen und dem Onkel Doktor Sartorius alle Monat eine hübsche Postkarte schicken. Ja, werdet ihr das?“
„Mit Tieren drauf oder mit Menschen?“ fragte Elschen, die Ältere, besinnlich.
„Nein, mit Häusern und Städten!“ rief Marthchen lebhaft. „Ich schick’ Onkel Doktor bunte Postkarten mit Häusern.“
„Und ich schwarze mit Menschen und Tieren,“ entschied Elschen.
Und somit war die Sache vollständig und endgültig erledigt. Bergers hatten wirklich und wahrhaftig beschlossen, nach Italien zu reisen. Die Kunde verbreitete sich mit Windeseile in der Nachbarschaft.
Der Rausuppensche Herr erschien eines Vormittags und wünschte Robert Berger zu sprechen. Der starke Mann erschrak, als er die abgezehrte Gestalt des Kranken sah. „Das nenn’ ich aber vernünftig, daß Sie reisen wollen, lieber Herr Pastor,“ sagte er und setzte sich. „Wir werden Sie alle mit Sehnsucht und Freude zurückerwarten. Aber einen Vertreter haben Sie auch! Wer hätte dem kleinen blassen Kerl mit dem Schauspielergesicht solch eine Mordscourage zugetraut?“
Robert Berger öffnete die Augen weit. „Ich weiß ja von gar nichts,“ sagte er.
„Wie?“ ereiferte sich der alte Herr, „daß der Herr Kandidat dem Finkenhorstschen sein Gut und Leben gerettet hat – das wissen Sie nicht?“
[102] „Aber keine Silbe.“
„Na, hören Sie mal! Mitten bei nachtschlafender Zeit, als er den Doktor – schockschwerenot! wie heißt er doch? – Doktor Sartorius für Sie aus der Stadt holte, da hat er, der lahme kleine Kerl, wie so’n Indianer sich in ’nen Graben gelegt, hat die Mordsbande mit all ihren saubern Plänen belauscht und ist dann plaine carrière in die Stadt gejagt, hat richtig ein Pikett Kosaken aufgestöbert und sie – wohl zum erstenmal rechtzeitig in Kurland – nach Finkenhorst spediert. Den Viehstall hatte die Halunkenbande schon in Brand gesetzt, ein Teil der Tiere ist auch in den Flammen umgekommen, aber das Wohnhaus steht noch unversehrt auf zwei Beinen, und die Spinetts und all der musikalische Plunder ist auch heil und ganz geblieben.“
„Aber – kein Wort davon hat mir Philippi gesagt!“ Robert Bergers Augen leuchteten und strahlten.
„Gefällt mir von dem jungen Mann, gefällt mir ganz außerordentlich!“ schmunzelte der alte Herr. „Und wissen Sie noch etwas? Daß es Rausuppen nicht ähnlich gegangen ist, hab’ ich ihm gleichfalls zu danken. Es war eben ein richtiger Mord- und Raubzug geplant worden, und der ist mal rechtzeitig im Keime erstickt!“
„Gott sei Dank!“ seufzte Robert Berger. Er sah ganz verklärt aus.
„Ja – ja, Ihr Freund – einen besseren Vertreter ... Na, ich mag keine Komplimente machen, aber Sie beide sind [103] einander wert!“ sagte der alte Herr und verkniff sich mühsam eine heftig aufsteigende Rührung, – „Hören Sie also, lieber Freund und Pastor, ich muß Ihnen da noch etwas mitteilen: Wenn man auf Reisen geht und so weiter, braucht man so’n bißchen Klimbim und dergleichen. Ich kenne das. Also machen Sie mir die Freude und stecken Sie dies Kuvertchen hübsch[WS 7] unter die Decke – ja? Und nein – keine Worte machen! Und kommen Sie uns hübsch kräftig und gesund wieder. Auf unserm brennenden Boden brauchen wir tüchtige Männer!“
Sie schüttelten einander warm die Hände, immer wieder und wieder.
Robert Berger war ganz überwältigt. Der Rausuppensche wischte sich hastig eine Träne aus dem grauen Schnurrbart und fuhr eilends davon.
„Isa, Ernst, Fräulein Claire!“ rief Robert Berger mit schwacher Stimme, „kommt alle, alle herein.“ Er richtete sich auf und sah seinem Freunde lange ins Gesicht, als sähe er ihn zum erstenmal. „Pastor Philippi,“ sagte er mit strahlendem Lächeln, „ich danke dir, daß du mir mein Amt abnimmst! Kehre ich wieder, so ist’s gut, kehre ich nicht wieder – nein, ruhig! es kann einem doch alles mögliche passieren –, so weiß ich’s in den besten, treuesten, tapfersten Händen geborgen, und ich kann ebenso ruhig nach Grönland wie nach Italien reisen. Mensch, Freund, Goldjunge, warum hast du mir von nichts erzählt? Die Bescheidenheit geht denn doch über die Bäume!“
[104] Die Freunde umarmten und küßten einander. Claires blasses Gesicht strahlte wie eine helle Blume.
Erschöpft sank der Kranke auf seine Kissen zurück.
Eine Stunde später ließ Robert Berger seinen Freund zu sich bitten. „Mein Herzensjunge, ich hab’ mir die Sache reiflich überlegt. Ich bin doch erst in ein paar Wochen reisefähig. Wozu aber sollt ihr beide Zeit verlieren? Da, meine ich, wäre es das Rechte, wenn du mit deiner Braut nach Mitau abreistest und dich dort ordinieren und möglichst bald trauen ließest! Was meinst du dazu?“
Der zweite und der kleine Finger Ernst Philippis setzten sich sofort in eine rasende Trillerbewegung. Mit einem freudigen Lächeln blickte der Kandidat auf. „Das ist mir sehr recht. Ja, was kann ich mir denn Schöneres wünschen?“ sagte er. „Du bist nun, Gott sei’s gelobt, überm Berg, alter Junge, und kannst uns entbehren.“
Robert Berger drückte ihm die Hand. „Noch eins,“ sprach er – „nehmt die Kinder mit, meine Frau sorgt sich um ihre kleinen Mädchen, und die sind doch völlig unnütz sozusagen auf brennendem Boden.“
„Aber selbstverständlich ...“
„Mir armen Krüppel wird ja die wilde Horde nichts anhaben,“ fuhr Robert Berger gedankenvoll fort. „Ich habe ja auch schon mein Teil weg; aber die Kinder möcht’ ich so bald [105] als möglich aus dieser Stätte der Überfälle und der Brände entfernt haben. Besprich das mit deiner Braut.“
„Da ist nichts zu besprechen,“ sagte Ernst Philippi warm.
„Die Sache ist in Ordnung. Wir reisen morgen.“ – –
Ein großer schwerbepackter Reiseschlitten fuhr über das flache Land in der Richtung zum Annenburgschen Kruge. Ein zweiter Schlitten folgte. Die Barone der benachbarten Güter, bis an die Zähne bewaffnet, hatten es sich nicht nehmen lassen, ihrem stellvertretenden Pastor das Geleit zu geben.
Fünf Wochen später zog das junge neuvermählte Paar in das ihnen so liebgewordene leere Pastorat Kronenthal, und wieder geleiteten es die Barone.
Diese einfache Handlung schloß symbolisch den Kern eines kraftvollen ferneren Zusammenhaltens von Adel, Geistlichkeit und Bürgerschaft in sich, in dem Sinne, wie der alte Rausuppensche und Ernst Philippi es empfunden und ausgesprochen hatten. Das Deutschtum sollte und mußte sich gegenseitig Halt und Stütze bieten, denn es stand und steht noch immer „auf brennendem Boden.“
[109] Über dem kleinen kurländischen Flecken hingen schwere Gewitterwolken. Der schlecht gepflasterte Marktplatz war heute schneller geräumt worden wie sonst. Heftige Windstöße wirbelten den Staub in mächtigen Massen aufwärts und trugen ihn nach allen Richtungen auseinander. Die Läden der kleinen jüdischen Handlungen wurden vorsorglich geschlossen und manch ängstliches Hebräergesicht schaute besorgt auf den düsteren schwarzgrauen Himmel.
Im Zickzackfluge zuckte ein greller Blitz und erleuchtete die lutherische Kirche. Ein jäher Windstoß zauste die Bäume, die sie umstanden, und bog sie hin und her, als wären die alten Linden Rutenbündel. Und nun ertönte das erste schwere Donnergrollen.
Eilig schritten zwei Gestalten über die Brücke, die aus dem Flecken hinausführte. Das Flüßchen, das sich um den Ort im Halbkreise herumwindet, strömte schwarz und düster dahin und auf seiner Oberfläche kräuselten sich kleine unruhige Schaumkämme.
„Stepan Nikolaitsch, ich fürcht’ mich –“ sagte eine ängstliche [110] Kinderstimme. Der elfjährige Knabe drängte sich dicht an seinen Begleiter, als wolle er bei ihm Schutz suchen vor dem drohenden Unwetter.
Der Volksschullehrer legte seine Hand beschwichtigend auf die Schulter des Knaben. In diesem Augenblick flammte der Himmel grell auf, als sei er mit einem gelbleuchtenden Tuche bedeckt und ein Donnerschlag, so jäh, so gewaltig und vernichtend brüllte durch die Luft, daß die Erde erzitterte und das All wie verschlungen war vor der grandiosen Majestät der Naturgewalt.
Schreckensbleich waren die Beiden stehen geblieben und starrten einander hilflos an, der kleine, blasse, hagere Mann mit den unruhigen und unausgearbeiteten weichen Zügen, und der Knabe mit dem eckigen frühreifen Gesicht. Stepan Nikolaitschs knochige bleiche Rechte machte hastig ein Zeichen des Kreuzes und seine Lippen murmelten: „Behüte uns, Jesus Christus und heilige Mutter Gottes“. – – Der Knabe wiederholte mechanisch dieselbe Geberde, aber seine Lippen blieben stumm.
Wortlos gingen sie wieder nebeneinander her. Da hob der Knabe den Arm und deutete auf die Anhöhe. „Vater Nikiphor!“ sagte er schüchtern.
Jenseits des Flusses auf dem Kamm eines ziemlich schroff aufsteigenden Hügels schritt eine gewaltige schwarze Gestalt in wehenden Priestergewändern daher. Den Hut trug Vater Nikiphor in der Hand, das markige, massive Antlitz mit dem lang herabwallenden dunklen Priesterhaar, die breite kraftvolle [111] Stirn durstig aufwärts gerichtet, als sehne sie sich nach einem kühlenden Tropfen von oben.
Stepan Nikolaitsch war zusammengezuckt, eine seltsame Unruhe kroch prickelnd durch seine Glieder.
„Er kommt wohl zu deiner Mutter, Krisch“ – murmelte er leise – „da ... da bin ich ja eigentlich überflüssig.“
Der Knabe mochte die Unschlüssigkeit in der Haltung des Volksschullehrers herausgefühlt haben. Mit neugierigem Blinzeln blickte er Stepan Nikolaitsch ins Gesicht und fragte unvermittelt: „Fürchten Sie sich vor Vater Nikiphor?“
Der kleine Mann zuckte unwirsch die Achseln. „Fürchten! Weshalb sollt ich mich dem fürchten! Frag nicht so dumm, Krisch.“
Aber mit dem Instinkt des Kindes hatte Krisch das Richtige getroffen. Stepan Nikolaitsch fürchtete sich in der Tat vor dem gewaltsamen Manne. Seine sensitive Natur empfand jedesmal einen Choc, wenn er ihm gegenübertrat. Er hatte es bisher nur nicht eingestanden.
Nachdenklich hefteten sich seine Augen auf den Boden. Er hatte in seinen Büchern, die er aus seiner Heimatstadt Brjansk mitgebracht hatte, etwas über Medien, persönlichen Magnetismus und suggestive Gewalt gelesen – daran mußte er jetzt denken, und es fiel ihm ein, daß er in der Gesellschaft gewisser Menschen sich leichter und freier und klüger fühlte, – anderen gegenüber empfand er einen gewissen Druck, der sein ganzes Selbst lähmte und gleichsam mit Klammern umfing. Noch nie aber hatte er [112] vor irgend Jemandem eine solche matte Willenlosigkeit empfunden, noch nie war sein Selbst zu einem so farblosen Ding zusammengeschrumpft, wie vor den mächtigen strahlenden dunklen Augen des Vater Nikiphor.
Eine kleine Hütte stand vor den beiden Wanderern. Es war eine Schmiede. Darin lag die schwerkranke Mutter des Knaben und wartete auf den Tod. Vater Nikiphor richtete seine Schritte dahin und abermals blieb Stepan Nikolaitsch stehen.
„Lassen wir Vater Nikiphor zuerst hineingehen,“ sagte er dumpf, „geh, begrüß ihn, ich komme dann später.“
Krisch lief eilig voraus und traf mit dem Popen vor der Tür zusammen. Mit einer raschen Handbewegung bedeutete Vater Nikophor dem Schullehrer, daß er ihn gesehen habe und ihn sprechen wolle. Unschlüssig blieb Stepan Nikolaitsch vor dem Häuschen stehen und trat hastig von einem Fuß auf den andern. Ihm war die Begegnung fatal und doch wußte er nicht, wie er sich ihr entziehen sollte. Nach der Art schwacher Naturen spürte er plötzlich das Bedürfnis, etwas Eigenmächtiges, ganz Willensstarkes zu tun, hineinzugehen und zu Vater Nikiphor zu sagen: Hören Sie, ich habe keine Zeit auf Sie zu warten, wenn Sie mich sprechen wollen, Sie wissen ja, wo Sie mich zu finden haben. Aber als er sich die zwingenden Augen und das behagliche spöttische Lächeln des Priesters vergegenwärtigte, warf er den Gedanken weit fort und murmelte halblaut vor sich hin: „Stepan Nikolaitsch, du bist ein Hase – was ist dabei zu machen?“
[113] Was wollte nur der Pope von ihm? Hatte er, der kleine Schullehrer, dem Vater Nikiphor nicht gesagt, daß er seine religiösen Anschauungen nicht teile, daß er an nichts, durchaus an gar nichts glaube, als an die Atome? Ja, das hatte er ihm klar und deutlich gesagt – er erinnerte sich noch heute daran mit einem gewissen Stolze; dann aber hatte Vater Nikiphor mit einem breiten jovisartigen Lächeln und einer gleichsam wegwischenden Handbewegung gesagt: „So! Also Sie glauben noch an die Atome! Ausgezeichnet, immer besser an die Atome zu glauben, als an das leere Nichts. Jedenfalls glauben Sie dann aber auch, daß man am Montag nicht auf Reisen gehen und am Freitag nichts Neues unternehmen solle". Und da das auf ein Haar stimmte, hatte Stepan Nikolaitsch verlegen geschwiegen. Seitdem war es ihm in Vater Nikiphors Gegenwart nicht recht geheuer. Und dennoch – waren sie Beide mit dem Küster und seiner dicken Frau Matriona Fadejewna und ein paar Postbeamten nicht die einzigen Russen in dem kurländischen Flecken, der von Deutschen, Juden und Letten wimmelte? Sie hatten doch allen Grund, schon als Landsleute zusammenzuhalten. Von Vater Nikophors verstorbener schwindsüchtigen Frau erzählte man sich, daß sie grausam von ihm mißhandelt worden sei, und somit war das Sprichwort: „Sie hat es so gut wie eine Popenfrau“ – diesmal zu Schanden geworden.
Aufgeregt ging Stepan Nikolaitsch vor dem Häuschen auf und nieder. Immer dräuender und dunkler umzog sich der [114] Himmel und jetzt fielen einzelne schwere Tropfen auf die Landstraße und malten kreisrunde dunkle Flecken in den grauen Staub. Aus der Hütte hörte der Volksschullehrer die sonore Stimme des Popen Gebete murmeln und wie fasziniert von dem Klange, blieb er jedesmal einige Sekunden vor der geschlossenen Fensterlade stehen. Die fallenden Tropfen wurden heftiger und dichter und endlich strömte und goß es in zornigen Fäden prasselnd von der dunklen Himmelsdecke nieder.
Der Volksschullehrer drückte die Tür auf und trat tastend in den dunklen Flur. Seine Kleider waren naß und er strich sich die Tropfen aus dem Gesicht. Aus der halboffenen Tür des Nebenraumes leuchtete ein roter Lichtschein, vor dem Krankenlager standen mit offenem Munde der lettische Schmied Kruhming und Krisch, sein Sohn, und folgten gespannt den Bewegungen Vater Nikiphors.
Der Pope sprach die Sterbegebete, bückte sich dreimal tiefer und machte das Zeichen des Kreuzes. Dann trat er von dem Bette zurück. Seine mächtige Gestalt schien den ganzen Raum auszufüllen. In ihre Kissen versunken mit wächsernen spitzen Gesichtszügen lag die Kranke regungslos wie ein totes Etwas und nur ihre sterbenden Hände auf der Bettdecke zuckten leise und krampfhaft als wollten sie sagen: Noch sind wir.
In demütiger Haltung trat der Schmied auf den Priester zu und küßte ihm die Hand. Krisch Kruhming war erst seit zwei Jahren griechisch-orthodoxer Konfession und hatte seinem [115] Pastor durch seinen Übertritt zur griechischen Kirche einen Streich spielen wollen, denn die geistliche Vermahnung wegen seiner Trunksucht war ein wenig derb ausgefallen. Überhaupt war das Verhältnis zwischen Letten und Deutschen schon seit Jahren ein mißliebiges, und Vater Nikiphor hatte redlich das Seine getan, um die Kluft zu vergrößern. Es war sein Ehrgeiz, Pastor Brenner, „diesem feinen Herrensöhnchen“, wie er sich spottend ausdrückte, möglichst viele Schäfchen abspenstig zu machen. Bei Krisch Kruhming, dem Schmied, war das Spiel leicht gewesen; der willenlose Trunkenbold war nicht der Mann, sich dem zwingenden Einfluß Vater Nikiphors zu entziehen, und so war es denn auch selbstverständlich, daß der kleine Krisch aus der lettischen Volksschule in die russische Kirchenschule trat.
Der schwerfällige Bube mit dem altklugen Gesicht wurde der Liebling des jungen Volkschullehrers. Sein weiches schüchternes Gemüt zog ihn zu dem Kinde des Trinkers, hatte er doch auch als Knabe unter ähnlichen Verhältnissen gelitten. Mit nachsichtiger Geduld nahm er sich des neuen lettischen Schülers an.
Stepan Nikolaitschs Blicke gingen ruhelos zwischen der sterbenden Frau und der wuchtigen Gestalt des Popen hin und her – da trat Vater Nikiphor in den Rahmen der Tür zwischen ihn und das Licht und sprach zum Schmiede: „Gebt uns ein paar Pferdedecken mit – für Stepan Nikolaitsch Goruschkin und mich, sonst bringen wir bei dem Regen keinen trockenen Faden heim“.
[116] „Jawohl, jawohl Vater Nikiphor“, stotterte der Schmied und sprang eilig davon. Der kleine Krisch drängte sich inzwischen leise an den Volksschullehrer, faßte seine Hand und flüsterte heiser: „Mutter wird sterben“.
In einer zärtlichen Regung faßte Stepan Nikolaitsch den Kopf des Kindes, seufzte und preßte ihn an seine Brust. Ein tröstendes Wort fand er nicht.
Der Schmied kam mit den Decken. Die beiden Männer hüllten sich hinein, der Pope machte eine Geberde des Segnens und Beide schritten ins Freie.
Das Gewitter hatte seinen Zorn ausgetobt. Nur in der Ferne grollte noch ein wuchtiges Donnern und eintönig prasselte der Regen nieder. Glänzend und frisch stand das Grün des Bergrückens gegen das schwere Grauviolett der Wolken, blank und gewaschen leuchteten die Dächer des Fleckens, das Flüßchen strömte mit leisem Gurgeln vorüber und links am Ende des Ortes hob sich in großen Linien das freiherrliche Schloß.
Wuchtig schritt Pater Nikiphor dahin, an seiner Seite in nervöser Gangart hastete Stepan Nikolaitsch. Sie sprachen kein Wort.
Vor der Brücke blieb Pater Nikiphor stehen und erhob seinen Arm. Er deutete auf das Schloß. „Da hausen unsere Widersacher“ – sprach er mit grollendem Ton, „diese sogenannten deutschen Kulturträger mit ihrem Lutheranerglauben.
Warme Nesterchen haben sie sich hier zu bauen verstanden, [117] das muß man sagen, und auf uns Russen, denen das weite große Zarenreich gehört, sehen sie mit demselben Hochmut herab, wie auf die Letten und Juden. Ich sage dir, Brüderchen, Slaventum und Germanentum – das sind zweierlei Pferde, – die ziehen nicht am selben Gespann“.
„Schon wahr“, murmelte der Volksschullehrer, und um etwas zu sagen fügte er hinzu: „Das Zarenreich ist doch aber weit genug für alle“.
Zornig lachte Pater Nikiphor auf. „Weit genug – – meinst Du? Vielerlei Völker hausen im Reich des weißen Zaren, Tataren und Mongolen, Tschuktschen und Tungusen – ’gut; gastfreundlich und geduldig ist unser Volk, – es wehrt ihnen weder Wohnung noch Weide, und sie beugen sich unserem Väterchen – gesegnet sei der Zar Nikolai Alexandrowisch, – aber hier, mit diesen deutschen Baronen und Literaten, ist ’s eine andere Sache. Hochmütig sind sie, alles besser wissen wollen sie, in den Staatsdienst drängen sie sich und Orden und Ämter bekommen sie, und unser Russe steht sehnsüchtig daneben. Drängen etwa die Tataren und Mongolen, die Tschuktschen und Tungusen unseren Bruder von seinem ihm zukommenden Platz des erstgeborenen Sohnes fort – he? Antworte mir, Brüderchen, Stepan Nikolaitsch Goruschkin, Wohlgeboren antworten Sie mir doch!“
Verwirrt blickte der kleine Mann auf. Ein seltsamer Trotz stieg in ihm empor. „Peter der Große, der große Zar, hat die [118] Ausländer nun aber doch selbst in unser Reich geführt,“ sagte er.
„Schön. Und wir, die neue Zeit, das zwanzigste Jahrhundert werfen sie wieder hinaus! Brauchen wir etwa Ausländer, um zu leben und zu herrschen, wie? Kann sein, daß wir sie einstmals brauchten. Aber jetzt? Lächerlich! Bauen wir nicht selber Fabriken? Spinnen und weben wir nicht? Einen Wodka, wie wir ihn brauen, den kann man in ganz Germanien suchen!“
„Der Wodka, der unser Volk zu Tode peitscht – –“ murmelte der Volksschullehrer bitter, – „besser, er wäre nie erfunden worden.“
Vater Nikiphor überhörte den Einwurf. „Die Deutschen mit ihrer ganzen Kultur“ – fuhr er grimmig fort, „die haben ihre Rolle ausgespielt, sag’ ich Ihnen, Stepan Nikolaitsch – ausgespielt! Wir können ohne sie fertig werden. Und weißt du, Brüderchen, wer uns helfen wird unser russisches Zarenland reinfegen? Diese Letten und Littauer und Esten mit ihren harten Schädeln ... ja und auch die Juden. Lange genug haben sie das Joch der Barone getragen. Nun mögen sie sehen, wie sie mit einander fertig werden! Wir schauen zu und waschen unsere Hände in Unschuld – – mögen sie sich gegenseitig aufreiben! Die Parole geben wir aus und lachen uns ins Fäustchen .... ja – das nennt man Politik!“
Er lachte aus vollem Halse.
Nachdenklich hatte der Volksschullehrer den Kopf gesenkt. „Ich meine, der Wohlstand der hiesigen Bauern ist ein größerer, [119] als bei uns im Orelschen. Hier hört man von keiner Hungersnot und bei uns – ach du lieber Gott – in jedem Jahre hungert unser Bauer in einem anderen Gouvernement.“
Wieder überhörte der Pope diesen Einwurf. „Ich hatte gestern einen sonderbaren Traum,“ fuhr er fort. „Unsere heilige Kirche stand vor dem Himmelstor und ihre Kuppeln strahlten von Silber und Gold, – – rings um sie her standen diese lutheranischen und polnischen Kirchen, Synagogen, Moscheen und Tempel, und alle die anderen beugten sich nieder vor unserer rechtgläubigen Kathedrale, und ihre Kuppeln mit ihren lutheranischen Hähnen und mohamedanischen Halbmonden berührten den Staub. Und eine große Stimme sprach: Nur durch die rechtgläubige Kuppelkirche führt der Weg zu Mir.“
Vater Nikiphor hatte sich hoch aufgerichtet. Seine Augen glühten fanatisch, die Pferdedecke war von seiner Schulter geglitten. Beschwörend hob er den Arm.
Ein eisiger Schauer kroch über den Rücken des kleinen Schullehrers. Fasziniert hing sein Blick an dem Priester. „Ich glaube ja an nichts,“ wiederholte er sich im Innern, „an nichts außer den Atomen.“ Aber während seine Lippen diese Worte flüsternd formten, fühlte er, daß er sie nur mechanisch vor sich hinplapperte – ich glaube ... ich glaube an die Kraft dieses starken und doch beschränkten Mannes – fuhr es ihm wie ein Blitz durch den Kopf. „Kommen Sie, Vater Nikiphor,“ sagte er endlich mit stockender Stimme – „Sie werden ganz naß.“
[120] Der Priester rührte sich nicht. „Wissen Sie, Stepan Nikolaitsch, wer es ist, der unsere rechtgläubige Kirche hemmt und hindert? Die Letten und Littauer und Esten, die beginnen sich unserem heiligen Glauben zuzuwenden, – wer uns aber in unserer Bekehrungsarbeit aufhält – das sind diese deutschen Barone und deutschen Pastoren, und darum müssen sie uns die Bahn freigeben: wir oder sie! ... Wir oder sie!“ wiederholte Vater Nikiphor mit gerunzelten Brauen und schritt mit gewaltigen Tritten ins Städtchen hinein. „Wir oder sie!“
Und wieder formten sich diese kurz hervorgestoßenen drei Worte in der Seele des Volksschullehrers zu einer neuen Bedeutung um. Ich oder du – klang es mit schreckhafter Deutlichkeit in ihm wieder ... ich oder du ... und eine angstvolle Gewißheit legte sich ihm lähmend auf die Seele: Du – – du! Wie könnte es anders sein? Er seufzte tief und wehrlos fragte er: „Was ist dabei zu machen?“
Sie waren über den verödeten Marktplatz getreten. Die Fensterläden der hebräischen Handlungen hatten sich wieder geöffnet, hier und da hastete unter einem mächtigem Regenschirm ein eiliger Fleckenbewohner vorüber, wie ein triefender wandelnder Pilz. In der langen Straße wurden hastig in einem niedrigen gelbgestrichen Hause die Fensterläden aufgestoßen. Zwei Mädchenköpfe, ein blonder und ein brauner, beugten sich heraus.
„Da geht die russische Geistlichkeit – in einer Pferdedecke, [121] nein, wie komisch!“ kicherte eine Stimme, „du, Wally, der Pope ist übrigens ein schöner Mann!“
„Der Schullehrer gefällt mir viel besser, er hat ein sanftes gutes Gesicht, vor dem Popen würd’ ich mich fürchten,“ war die rasche Antwort – „es wär’ eigentlich ein christliches Werk, wenn wir den beiden Russen unsere Regenschirme anböten.“
„Nun, so tun wir’s doch!“
„Ach nein, lassen wir’s, Wally, das sähe aufdringlich aus!“
„Aber nun erst recht – kommst du mit, Mietze, – sonst geh ich allein!“
Die Braune stand ein paar Sekunden später auf der Straße, zwei Schirme in den Händen. Sie war ein schönes Mädchen mit kurzgeschnittenem Haar und kecken feurigen Augen. Schüchtern war ihr die blonde Mietze gefolgt.
„Erlauben Sie, daß wir Ihnen unsere Schirme anbieten!“ sagte Wally in fließendem Russisch.
„Sie sind sehr liebenswürdig,“ sprach Vater Nikiphor, „und ich weiß diese Liebenswürdigkeit um so mehr zu schätzen, da sie uns von deutschen Dame geboten wird.“ Seine machtvollen Augen überflogen die kraftvolle Gestalt der Brünetten und bohrten sich in das zarte Gesicht der blonden Mietze.
Stepan Nikolaitsch sagte nichts, er riskierte eine ungeschickte Verbeugung und sah erstaunt zu der Brünetten hinüber, deren Antlitz sich mit warmem Rot Übergossen hatte. Dann gingen die Männer weiter.
[122] „Die Blonde ist die Schwägerin des Veterinärarztes Schulz,“ flüsterte er aufgeregt, – „ein hübsches Mädchen, die andere ist ihre Nichte oder Kusine aus Libau, zum Besuch hier.“
„So, so ... Sie scheinen ja außerordentlich gut Bescheid zu wissen!“ sagte Vater Nikiphor lachend. „Nun, so will ich Ihnen denn auch großmütig überlassen die Schirme wieder abzuliefern.“
Vor der Apotheke stand der Wagen des deutschen Pastors Brenner. „Da sitzt Hochwohlehrwürden, das Herrensöhnchen“ – murmelte der Priester höhnisch – „wart, Brüderchen, wir haben noch eine lange Rechnung miteinander auszugleichen.“
Der Pastor, ein kräftiger Mann mit einem ruhigen, diskreten Gesicht grüßte gemessen, während Vater Nikiphor den Hut schwungvoll zog und seinen deutschen Kollegen mit herausfordernder Miene anstarrte.
„Ich oder Du!“ sagte Vater Nikiphor mit harter höhnischer Stimme. Dann lachte er ein breites zorniges Lachen. „So ists – – Ich oder Du!“
Und in dem Klang seiner Stimme stand das Ich so mächtig, breit und protzend da, daß der Volksschullehrer aus einer Art von betrachtungsvoller Betäubung erwachte und es schien, als trete das „Du“ von vornherein wie ein wesenloser Schatten in den Hintergrund.
„Natürlich!“ murmelte er in seiner Versunkenheit und mühte sich durch den zerschlissenen Regenschirm ein Streifchen des grauen weinenden Himmels zu erspähen, „Natürlich.“
[123] Sie schritten am Friedhof vorüber. Durch das tropfende Grün der Birken und Syringenbüsche leuchtete hier und da ein blasses Marmorkreuz unter den dunklen triefenden Holzkreuzen freundlich hervor. Bald standen die Landsleute vor der neuerbauten russischen Kirche mit ihren grünen Kuppeln.
„Auf Wiedersehen, Stepan Nikolaitsch“ – sagte der Priester kurz und schritt dröhnend in den Hausflur der Kirchenschule hinein. Die Popenwohnung lag zu ebener Erde wie die Schule, während der Volksschullehrer seine zwei Stübchen eine Treppe hoch hatte, gegenüber den Zimmern des Küsters und Psalmensängers Terenti Kusmitsch Skworzoff.
Erschöpft trat der kleine Mann in seine Wohnung und setzte sich nachdenklich an seinen Tisch. Er stützte den Kopf in die Hand und seufzte schwermütig. Draußen der graue bewölkte Regenhimmel über dem Gewirr von roten feuchtglänzenden Dächern, von denen die Tropfen langsam herabrieselten – nein er wußte – er war ein Fremdling hier und würde sich nie heimisch fühlen unter der kurländischen Bevölkerung. Hier drinnen die leere, unwohnliche Stube, der Boden mit angerauchten Zigarettenenden bestreut, auf Kommode und Stühlen einige halbaufgeschnittene russische Zeitschriften mit schlechten Illustrationen. In der Ecke das eiserne Bettgestell mit der roten verblaßten Flanelldecke, an der Wand die farbigen billigen Abdrucke des szeptertragenden Zaren und der Zarin. Über ein vergessenes Stückchen Zucker auf dem Tisch hatte sich ein Schwarm gieriger [124] Fliegen hergemacht, und klebte in lüsterner Versunkenheit daran. Verstohlen hob Stepan Nikolaitsch die Hand, um sie mit einem Schlage zu zerschmettern. Dann überkam ihn ein grenzenloses Gefühl des Ekels und mutlos ließ er die Hand wieder sinken. Was nutzte die Gewalt? Waren diese Fliegen vernichtet, so sammelten sich wieder neue, so lange der Sommer währte, oder ein Gegenstand vorhanden war, der ihr Interesse erweckte, war es nicht so mit allen Dingen? Er öffnete das Fenster, ergriff das Stückchen Zucker – summend stoben die Fliegen auseinander – und schleuderte es weit hinab auf die Gasse. Leise und zierlich kam eine gelbe Katze geschlichen, hob die weißen Pfötchen wie ein Dämchen über die nassen unregelmäßigen Pflastersteine, und beroch das Zuckerstück. Mit den grünlichen funkelnden Augen blickte sie um sich, schielte zu dem einsamen Manne am Fenster empor und stieß ein klägliches Miau aus. Dann sprang sie auf einen Prellstein, setzte sich graziös zurecht und begann ihre Pfötchen zu belecken. Schwerfällig, mit breit ausladendem Schritt kam ein lettischer Bauer gegangen, einen gestrickten Shawl um den Hals, die Mütze tief über das struppige Haar gezogen; er trieb mit einer Peitsche ein Schwein vor sich her. Widerwillig grunzend lief das Tier mit kleinen eiligen Schritten, bewegte das geringelte Schwänzchen und schob den schnüffelnden Rüssel am Boden entlang. Jetzt hatte es das Zuckerstück erwischt und verspeiste es mit schmatzendem Behagen. „Nu, nu –vorwärts!“ bellte der Bauer und ein Peitschenhieb fiel auf den feisten Rücken [125] des Tieres nieder. Erschreckt sprang das Kätzchen vom Prellstein, tschirp, tschirp machten die Spatzen auf den Dächern und mit melancholischem Lächeln trat Stepan Nikolaitsch vom Fenster zurück.
Er warf sich auf das Bett und starrte zur Decke empor, war das ein Leben, das er hier führte? Vor seiner Seele lag das heimatliche Städtchen Brjansk und die Erinnerung überzog es mit leuchtenden sonnigen Farben. Der polternde, stets betrunkene Vater, die schüchterne verängstete Mutter, die ihren mageren Rücken in gleicher Weise vor den Heiligenbildern und über ihr Nähzeug krümmte, die kleine flachshaarige Schwester Katiuscha, deren Zöpfchen am Sonntag naß und frisch geflochten, steif und artig von dem dünnen Hälschen abstand, die raufenden Gassenjungen mit ihrem Geschrei und ihrem Knöchelspiel – in der Erinnerung war ihm Alles lieb und heimatlich.
Dann die mühseligen Schuljahre, das staunende Entzücken, als er zum erstenmal mit etlichen Kameraden auf der Eisenbahn ins freie Land hinausgefahren war, aus der Enge rauchender Fabrikschlöte hinaus in grüne Walder, auflachende Wiesen, unter armselige gutmütige Bauern, die ihr Leben dahinfristeten in schwerer Feldarbeit bei ungenügendem Einkommen und es nicht besser kannten. Da war der Entschluß in ihm entstanden[WS 8], Volksschullehrer zu werden und die aufklärende Sonne der Bildung hineinzutragen in die kümmerlichen Hütten der Landbewohner. Und was war daraus geworden? Jahrelang hatte er in seiner passiven stillen Weise gegen die dumpfe mißtrauische Unwissenheit [126] in seinem Volke angekämpft, angekämpft gegen Trägheit, Aberglaube und Gleichgültigkeit ... und was hatte er geerntet? Spott und Feindseligkeit von den Bauern, die den Städter in ihm mißachteten, Mißtrauen und Verständnislosigkeit von den Seinen. Die kleine Schwester war groß und hübsch geworden und man hatte sie gegen seinen Willen mit einem ärmlichen kranken Gemüsehändler verkuppelt. Seinen einzigen Freund, einen jungen Schreiber aus Brjansk, einen Hitzkopf voll sozialistischer Ideen, hatte die Polizei aufgestöbert und auf administrativem Wege nach Sibirien verschickt – da war eine große Hoffnungslosigkeit über Stepan Nikolaitsch gekommen und er hatte sich nach den baltischen Provinzen versetzen lassen.
Müde und teilnahmlos hatte er sein hiesiges Amt angetreten, müde und teilnahmslos war er seither geblieben. Nur ein zehrendes Heimweh nagte an seiner Seele und wuchs von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Dazu gesellte sich ein bitterer Vorwurf: warum war er nicht daheim geblieben? Da hätte er doch wenigstens Jemanden gefunden, dem er in seiner eigenen Sprache sein Leid hätte klagen können und der ihn verstanden hätte. Er hatte die traurige Wahrheit noch nicht erkannt, daß er zu jenen Einsamen gehörte, die überall und unter allen Umständen Einsame bleiben, weil sie es nicht vermögen, aus sich herauszutreten, weil es ihnen an der zuversichtlichen Kraft und dem Selbstbewußtsein gebricht, die allein dem Schicksal gewachsen sind.
Stepan Nikolaitsch strich sich über die Stirn und stöhnte. [127] Ein qualvolles Bedürfnis zu reden, von den Seinigen daheim, von seinem Freunde dem verschickten Kameraden, ein Bedürfnis zu renommieren, sich groß zu tun in seiner Kleinheit, sein heimwehkrankes Selbst zu übertäuben, wurde in ihm wach und trieb ihn von seinem Lager empor. Er öffnete die Tür und spähte die Treppe hinab. Nur den Pater Nikiphor nicht sehen, nur dem gewaltigen Manne nicht begegnen, neben dem er sich vorkam wie eine zappelnde wehrlose Fliege im Netz, gegenüber der siegessicheren Spinne! Mit zögernden kleinen Schritten ging er über den Flur und klopfte an die Tür seines Nachbars, des Küsters Skworzoff.
„Herein!“ rief eine fette Stimme.
Unwillkürlich nahm Stepan Nikolaitsch eine selbstgefällige nachlässige Haltung an und drückte die Tür auf.
An einem großen ungestrichenen Tisch saß eine dicke Frau in mittleren Jahren, vor sich eine Schüssel mit Erbsen. Emsig war sie dabei, sie aus den Schoten zu streifen; die hellgrünen saftigen Dinger sprangen klirrend in eine Tonschüssel.
„Guten Tag, Stepan Nikolaitsch, nur immer herein!“ sagte die Frau gutmütig. „Es ist recht, daß Sie kommen, da können Sie mir gleich ein wenig behilflich sein. Nehmen Sie nur Platz, Väterchen und erzählen Sie mir etwas. Gott, – ist das ein böses Wetter heute!“
„Ganz abscheulich, Matriona Fadejewna,“ sagte Stepan Nikolaitsch mit einem Seufzer und setzte sich. „Also erzählen [128] soll ich Ihnen? Ja, was soll ich Ihnen denn nur erzählen?“
„Wo waren Sie denn heute? Sie sollen ja zwei hübschen jungen Damen begegnet sein, die Sie mit Regenschirmen versehen haben.“
Stepan Nikolaitsch wurde ein wenig rot. „Also das wissen Sie auch schon – was bleibt mir da zu erzählen übrig? Warten Sie,“ sagte er, als wolle er sich besinnen, und zog die Erbsenschüssel näher zu sich heran. Umständlich öffnete er eine Schote um die andere. „In der Heimat, im Seminar hatte ich einen Freund, – ein prachtvoller Mensch, nur ein wenig rot, wie das schon so geht. Ich liebte ihn sehr, und auch er bevorzugte mich vor allen Kameraden. ,Laßt mir den Stiopka in Ruhe!’ sagte er –, ,In dem steckt was – stille Wasser sind tief’ –Ja ... ja ... Sein Kopf sank ihm tief auf die Brust, während er sprach, und er seufzte schwer. „Hm!“ räusperte er sich, um seiner Stimme mehr Festigkeit zu geben – „Wladimir Gruschewskv war ein hübscher Bursch - - er konnte sich überall sehen lassen, und die Mädchen waren auf ihn rein wie versessen, – meine Schwester Katiuscha natürlich mit, und Augen machte sie ihm - so große! Sein Vater war Kaufmann, hatte Geld, hielt es aber ungemein zusammen wie so ein Knicker, – nu und Wolodjka wurde ziemlich kurz gehalten. Eines Tages – es war vor Schulanfang in unserem letzten Seminarjahr, kommt Wolodjka zu mir – bleich, mit zerzaustem Haar und glühenden Augen. ,Stepan’, sagte er und packt mich bei den Schultern – ,bist Du mein [129] Freund oder bist Du’s nicht?’ – ,Wozu die Worte?’ sag ich –, ,Du weißt es!’ – – Da setzt er sich auf die Ofenbank, streckt die Beine lang von sich, steckt die Hände in die Rocktaschen und kehrt sie um. ,Ich hab mein Schulgeld verspielt’, sagt er einfach, – ,Alles bis auf die letzte Kopeke. Morgen werd ich aus dem Seminar gejagt, und dann schieß ich mir eine Kugel vor den Kopf!“ – Ich sehe ihn an, er mich, und ich fühle, daß er die Wahrheit spricht. Kalt kriecht es mir über den Rücken. Ohne ein Wort zu sagen, kehre ich mich zur Wand, und beginne einen losen Ziegelstein herauszuheben, – dahinter pflegte ich mein Geld vor meinem Vater zu verstecken. Ich gab damals ein paar kleinen Gymnasiasten Nachhilfestunden, und sparte zu einem neuen Anzug und zu einem neuen Osterkleide für Katiuscha. Ich nehme also das Geld heraus, füge den Ziegelstein ordentlich zurück und drücke es ihm in die Hand. Er springt auf, umarmt mich und sagt: „Stiopka, das vergeß ich Dir nie! –“
Aufmerksam hatte die dicke Frau zugehört. Ihr breites gutmütiges Gesicht mit dem glatt anliegenden Scheitel und den kleinen zusammengekniffenen Äuglein drückte eine Welt von Wohlwollen und Bewunderung aus.
„Nu, das war aber schön!“ lobte sie. „Hat er es Ihnen wiedergegeben?“
Stephan Nikolaitsch zögerte einen Moment. „Nach einem Jahr – ja,“ sagte er. „Er wurde Sekretär bei einem Advokaten, war ein gescheiter Kopf – und findig. Reden konnte [130] er halten, besser wie der Advokat selber, und in die Katiuscha verliebte er sich sterblich. Ich war damals auf dem Lande in meiner Schule, – da hörte ich, daß er nach Sibirien verschickt worden sei. Solch ein Mensch nach Sibirien verschickt – stellen Sie sich vor! Man hatte verbotene Schriften bei ihm gefunden, und eins, zwei, drei packt man ihn auf und zieht ihm die gelben Stiefeln an!“
Schmerzlich starrte der junge Mann vor sich nieder.
„Ja, ja,“ sagte Matriona Fadejewna bedeutsam „ins kalte Land, dahin kommt unsereins schnell genug. Gott bewahre uns!“ Sie schlug ein Kreuz und fragte nach einer Pause: „Und haben Sie seitdem von ihm gehört?“
„Kein Sterbenswörtchen. Und darum sehen Sie, liegt es mir wie ein Stein auf dem Herzen! Ich kann mir’s nicht von der Seele reden, was mich drückt. Sind wir denn nicht auch wie in der Verbannung hier unter diesen fremden Völkern?“
„Ja, ja,“ ... nickte Matriona Fadejewna trübselig – „ja, ... ja, ja. Der Vater Nikiphor, sehen Sie, der ist aus anderem Holze geschnitzt. Der lebt durch den Haß. Wie ein Feuer brennt der Haß in ihm fort und erhält ihn bei Kraft und Gesundheit, aber Traurigkeit frißt Einem an der Seele wie ein Wurm und macht schwach und hinfällig. Stepan Nikolaitsch –“ sie beugte sich über den Tisch zu ihm vor und flüsterte: „Nehmen Sie sich vor Vater Nikiphor in Acht – er ist kein guter Mensch. Er tragt böse Gedanken mit sich umher.“
[131] „Böse Gedanken ... wieso denn?“ fragte Stepan Nikolaitsch.
„Nu, ich will nichts gesagt haben, aber ich weiß, was ich weiß!“ sagte die dicke Frau geheimnisvoll. „Seine arme Frau ... hab ich auch noch gekannt. Gott, war das ein Kreuz!“
In diesem Augenblick ertönte ein wuchtiger Schritt auf dem Flur, die Tür wurde aufgerissen und in seiner ganzen Größe stand die breite Gestalt des Popen vor den Beiden.
„Eh, Matriona Fadejewna, meine Gute, können Sie mir nicht sagen, wo Ihr Mann steckt?“ fragte der Geistliche laut, „So so, Erbsen bolstern wir? Eine nützliche und angenehme Beschäftigung!“
Ungeniert fuhr er mit der breiten Faust in die Schüssel und nahm sich eine Hand voll heraus.
Eilig war die Küstersfrau aufgesprungen und strich ihre Schürze zurecht. „Kusmitsch wird in die Kirche gegangen sein, um alles zum morgenden Festtag vorzubereiten,“ sagte sie. „Befehlen Sie etwas, Vater Nikiphor?“
„Er soll nachher zu mir herunterkommen, ich muß ihn notwendig sprechen. Nun und Sie, Stepan Nikolaitsch, – waren Sie noch nicht mit den Regenschirmen bei den beiden Schönheiten – wie? Nein bewahre – das Männchen macht sich’s bequem und schält Erbsen wie ein artiges Muttersöhnchen, – ist auch die rechte Beschäftigung für Sie!“
Spottend strich er dem Volksschullehrer über die Haare.
Im Innersten gestachelt, saß Stepan Nikolaitsch da und öffnete [132] den Mund zu einer heftigen Antwort. Aber die lähmende Gegenwart des gewaltsamen Mannes begann wieder ihre geheimnisvolle Wirkung zu üben und er schwieg.
Am anderen Morgen war klares lichtes Sonntagswetter. In seinem neuen Anzuge, frisch gebürstet und rasiert begab sich Stepan Nikolaitsch sofort nach dem russischen Gottesdienst mit den beiden Regenschirmen zu den jungen hilfsbereiten Damen.
Er schellte an der Tür des Veterinärarztes. Sein Herz klopfte in starken unruhigen Schlägen. Er hatte sich eine wohlklingende Phrase zurechtgelegt.
Fräulein Wally Grundmann öffnete ihm selbst, vor ihrer dunklen, ein wenig herausgeputzten Schönheit blieb ihm das Wort im Halse stecken. Er machte eine ungeschickte Verbeugung.
„Ich dachte schon, daß Sie kommen würden“, sagte das junge Mädchen fröhlich, – „deshalb bin ich nicht mit meiner Kusine und den anderen Verwandten zur Kirche gegangen.“
Sie lachte, wie über einen recht gelungenen Streich und ihre weißen Zähne blitzten. „Bitte, treten Sie nur näher.“
Sie führte ihn in einen kleinen spießbürgerlich eingerichteten Salon. Auf den verschlissenen roten Möbeln waren gehäkelte Schutzdeckchen sorgfältig angesteckt.
„Es war außerordentlich liebenswürdig von Ihnen, uns die Schirme ... wie darf ich Sie anreden, Fräulein?“ stotterte Stepan Nikolaitsch und nahm verlegen Platz.
„Ich heiße Wally Oswaldowna, – da das aber für russische [133] Zungen sehr unbequem ist, lasse ich mich von meinen russischen Bekannten in Libau Wally Iwanowna nennen. Und wie ist Ihr Name?“
„Ganz leicht und bequem auch für deutsche Zungen“, lächelte der Volksschullehrer – „Stepan Nikolaitsch. Sie haben viele russische Bekannte, Wally Iwanowa?“
„Eine Menge. Hier freilich, in diesem trübseligen Nest fehlt es uns ganz an Bekanntschaften. Das find ich höchst langweilig!“
„Sie sprechen ein erstaunlich gutes Russisch für eine Deutsche!“
Sie lachte vergnügt. „O das ist kein Wunder, – ich habe ja das russische Mädchengymnasium in Libau absolviert, außerdem war meine Großmutter väterlicherseits Russin. Da sie zu Zeiten Kaisers Alexander des Zweiten ohne Reversal heiratete, konnten ihre Nachkommen lutherisch sein. Wir sind alle Protestanten.“
„Auf die Konfession kommt es ja nicht an“, sprach Stepan Nikolaitsch in der Absicht etwas Bedeutendes zu sagen.
Die dunklen Augen der jungen Dame funkelten. „So? Sind Sie wirklich so freisinnig? Das setzt mich in Erstaunen. Ich hielt Sie für einen ausgesprochenen Orthodoxen. Sind Sie nicht mit dem russischen Geistlichen befreundet?“
„Ich war niemals mit Vater Nikiphor befreundet“, sagte Stepan Nikolaitsch mit Nachdruck.
„Man sieht Sie aber doch häufig zusammen gehen.“
Er zuckte die Achseln. „Ja was wollen Sie, Wally Iwanowna – wenn man unter lauter Fremden sozusagen aufeinander [134] angewiesen ist und unter einem Dache lebt ... außer einigen Postbeamten und dem Küster Skworzoff gibt es ja keine Russen mehr.“
Sie sah ihn mitleidig an. „Da müssen Sie sich aber entsetzlich vereinsamt fühlen!“
„Entsetzlich!“ wiederholte er dumpf.
„Ja, warum verkehren Sie denn nicht in den deutschen besseren Häusern?“
„Will man uns denn empfangen?“ fragte er bitter zurück. „Wir Russen werden ja seit der Russifizierung von der einheimischen Bevölkerung gehaßt!“
„Das ist ein Vorurteil!“ sagte sie leicht hin. – „Ich zum Beispiel, ich hasse Niemanden.“
Bewundernd blickte er ihr in das schöne, ein wenig kokette Gesicht. „Sie sind eben eine Ausnahme – Sie passen ja auch nicht in die hiesigen Kreise hinein!“
„Finden Sie?“ Sie lachte geschmeichelt. „Ja, Sie haben Recht, – in Libau ist man vorurteilsloser. Aber da Sie nun einmal hier leben, sollten Sie sich mit der deutschen Sprache befreunden, verstehen Sie kein Deutsch?“
„Gut Morgen, gut Abend, wie habben Sie geschljafen?“ sagte er auf deutsch – „das ist Alles!“
„Da haben Sie aber einen schlechten Lehrmeister gehabt. Es heißt nicht „gut“ Morgen, sondern guten Morgen und guten Abend, nicht „habben“, sondern haben Sie geschlafen, nicht schljafen.“
[135] „Himmlische Gerechtigkeit! Ist das aber schwer!“ seufzte er in komischer Verzweiflung.
Sie lachte lustig und hell. „Es ist gar nicht schwer“, tröstete sie, – „wissen Sie, ich hab einen guten Einfall: ich will Ihnen deutsche Konversationsstunden geben, – und Sie, nun Sie erteilen mir dagegen einen Kursus, nun sagen wir in slavonischer Sprache.“
Des kleinen Mannes blasses Gesicht leuchtete auf. „Wäre das denn möglich?“ fragte er zweifelnd.
„I – warum denn nicht? Über die Vorurteile eines so lumpigen Fleckens setze ich mich natürlich hinweg.“ Sie warf den hübschen Kopf zurück. „Übrigens um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich langweile mich hier zum Sterben bei meinen Verwandten, und leider soll ich noch ein rundes halbes Jahr hierbleiben. Mein Vater, – er ist Provisor in Libau – gedenkt sich nämlich wieder zu verheiraten, und da soll ich dem jungen Familienglück aus dem Wege.“ Ein kleines bitteres Lächeln zuckte um ihre Mundwinkel.
Er hatte nur die erste Hälfte ihrer Rede beachtet. „Nur noch ein halbes Jahr!“ sprach er bedauernd. „Und Sie wollten, wollten mir einsamen Menschen deutschen Unterricht geben, – – mir Ihre Zeit und Ihre Gegenwart schenken? Das ist ein zu großes Glück für mich! Was kann ich Ihnen denn dagegen bieten?“
„Ach, seien Sie doch nicht sentimental! Muß denn durchaus Alles gegeneinander abgewogen und genau bezahlt werden?“ sagte Fräulein Wally großartig. „Wir sind doch keine Krämerseelen, Stepan Nikolaitsch.“
[136] In stummem Entzücken blickte der Volksschullehrer in das blühende junge Gesicht. Noch nie glaubte er etwas so schönes, so gütiges gesehen zu haben.
„Sie sind so schön, so gut, so außerordentlich ... ich finde keine Worte“ ... murmelte er verwirrt.
Wieder lachte sie ihr helles klingendes Lachen. „Ich will Ihnen etwas sagen, Stepan Nikolaitsch, – ich bin gar nicht gut, ich bin bloß frei – freier als die Anderen.“
Sie wurde ernst und ein kindlicher sehnsüchtiger Ausdruck flog über ihre Züge. „Ich möchte gern gut sein, so im großen, verstehen Sie, – aufopfern möcht’ ich mich, eine große gute Tat tun, für etwas Großes leiden, ja sterben, – aber mich nicht täglich mit all dem kleinlichen Kram herumplagen! Das macht so müde, so ungeduldig, und ich bin eine große Egoistin und hasse das Langweilige.“
Versunken lauschte Stepan Nikolaitsch ihren Worten. Es schien ihm, als spräche seine eigene frühe Jugend zu ihm, als höre er seinen verschickten Freund Wladimir reden. Hatte er nicht selbst ähnliche Anwandlungen gehabt? Sterben für eine große Idee – ja, das ließ sich hören! Aber nach Sibirien verschickt zu werden ohne weiteres Beweismaterial als ein paar verbotene Schriften, – aber ein kleinliches, gleichsam abgestricktes Leben führen ohne großen Inhalt, wo sich Tag an Tag wie Masche an Masche reihte – das tötete langsam und machte stumpf und [137] feige. Das Bewußtsein seines ganzen Jammers kam heiß über ihn. Starr blickte er zu Boden und sein blasses gequältes Gesicht sah anziehend und interessant aus.
So dachte wenigstens Fräulein Wally. Sie hielt ihm die Hand hin. „Wir wollen gute Freunde werden!“ sprach sie herzlich. „Wann beginnen wir unsere Stunden? Ist Ihnen Mittwoch und Sonnabend von 4 bis 5 nachmittags recht?“
„Hier?“ fragte er noch immer zweifelnd.
„Gewiß hier. Um meine Verwandten sorgen Sie sich nicht. Die tun alles, was ich will. Ich verstehe es, mich verwöhnen zu lassen!“ fügte sie mit koketter Schelmerei hinzu.
Sie waren aufgestanden. Das Glücksgefühl machte ihm schwindlig. Ungeschickt stolperte er über die Treppe und fand sich in einem verträumten seligen Zustande auf dem Heimwege.
Im Flur wartete sein Lieblingsschüler Krisch auf ihn. Der Knabe hing den Kopf und sah scheu mit geröteten Augen drein.
„Mutter ist tot,“ sagte er mit stumpfem Ausdruck.
„Wann ist sie gestorben?“
„Heute morgen um 3 Uhr. Übermorgen soll sie beerdigt werden.“
Der Volksschullehrer faßte den Knaben bei der Hand und ging mit ihm die Treppe empor. Er fühlte sich heute so reich beschenkt, so beglückt, daß die ungeschickte Sprödigkeit seiner Natur sich langsam abzulösen begann, wie eine zu eng gewordene Hülse.
„Du hast wohl die ganze Nacht nicht geschlafen, Krisch?“ fragte er weich.
[138] „Bis sieben Uhr nich,“ knurrte Krisch. „Ich graul mich so.“
„Armer Kerl“ sprach Stepan Nikolaitsch mitleidig, „wart, ich will dir eine warme Tasse Tee kochen, und nachher streckst du dich auf mein Bett aus und schläfst.“
Der Junge zögerte. „Ich muß noch zum Vater Nikiphor – anmelden. Vater hat mich geschickt.“
„Das werd ich schon ausrichten, bleib nur ruhig bei mir!“
Geschäftig ging Stepan Nikolaitsch in die Nebenkammer, die ihm als Küche diente, machte Feuer an und kam bald mit einer dampfenden Teemaschine wieder. Dann goß er den Tee auf, stellte Butter Brot und Zucker nebst zwei Tassen auf den Tisch, hieß den Knaben Platz nehmen und schenkte ein.
„So, nun greif zu und trink, Junge!“ sagte er.
Mechanisch schlürfte Krisch seinen Tee und sah den Lehrer mit runden verwunderten Augen an. Wenn er das seinen Kameraden erzählte – die würden neidisch sein! dachte er. Und selbst hat er für mich den Tee gekocht – – ob sie das glauben werden?
Im Gefühl seiner Wichtigkeit trank er noch eine zweite Tasse.
Stepan Nikolaitsch suchte nach dem rechten Wort. Und ungesucht stellte es sich ein, weil er selbst durchwärmt worden war.
„So, das ist recht,“ sagte er, – „jetzt legst du dich hin. Ich bleib bei dir, bis du einschläfst.“
Er glättete ihm die Kissen und zwang den Knaben auf [139] sein Bett. Dann setzte er sich zu ihm und streichelte ihn sanft.
Die runden Bubenaugen waren starr auf Stepan Nikolaitsch gerichtet. Plötzlich barg Krisch den Kopf in die Kissen und brach in ein jämmerliches Schluchzen aus.
„Krisch, mein guter Krisch,“ murmelte der junge Mann, „ja sieh, sein Mütterchen zu verlieren ist eine bittere Sache. Jeden triffts einmal, früher oder später, – da gibts nur eins: ein guter ordentlicher Mensch werden, damit dein Mütterchen droben im Himmel, eine Freude an dir hat.“
Verschämt wandte Krisch das Gesicht ab, aber seine Tränen flossen noch lange. Still saß Stepan Nikolairsch bei dem Knaben, streichelte ihn und sah mit seltsam glänzenden Augen durchs Fenster hinaus ins Weite, in eine lichtere glücklichere Zukunft. Jetzt rührte sich das Kind nicht mehr und leise zog er die Hand zurück und stand auf – da fühlte er sich von zwei mageren Armen umfaßt und Krisch preßte ihm einen tränennassen Kuß auf die Hand.
„Sie sind gut, ich hab Sie lieb, Stepan Nikolaitsch.“
Als hätten die beiden, der Volksschullehrer und sein Schüler, einen Orden bekommen, so trugen sie seither die Köpfe. Etwas war in ihnen beiden frei geworden, eine neue Entwicklungsphase hatte für beide begonnen – und somit trug jeder seinen Orden.
Fräulein Wally hatte Recht gehabt: sie verstand es mit ihren Verwandten umzugehen und setzte alles durch, was sie wollte. Jetzt wollte sie, daß man im Hause des Veterinärarztes [140] dem Volksschullehrer liebenswürdig begegnete, und sie erreichte es. Die biederen Fleckenbewohner waren viel zu tief von Fräulein Wallys großstädtischer Welt- und Lebenskenntnis durchdrungen, als daß sie sich ihrem Willen widersetzt hätten. Dazu war der kleine bescheidene Mann ihnen persönlich sympathisch und selbst die blonde zurückhaltende Mietze faßte ein freundschaftliches Zutrauen zu dem Russen.
In der eingeschüchterten vereinsamten Seele Stepan Nikolaitschs sprang eine Fessel um die andere. Mit den Fortschritten in der deutschen Sprache, die er emsig betrieb, machte sich auch eine gewisse muntere geistige Regsamkeit geltend. Er konnte unterhaltend, scherzhaft und liebenswürdig sein, und jemehr er Fräulein Wallys fröhlichem Einfluß unterlag, desto mehr entzog er sich halb unbewußt dem dämonischen Zwange, den Vater Nikiphor auf ihn auszuüben gewohnt war.
Alle herrschsüchtigen Menschen suchen sich denjenigen zu nähern, die sich ihnen zu entziehen drohen. Ihre Eitelkeit klammert sich zäh und beharrlich an ihre Opfer, die die Macht ihrer Herrschsucht an sich erprobten oder stillschweigend anerkannten. Auch Vater Nikiphor in seiner rauhen lärmenden Art begann sich auffallend um Stepan Nikolaitsch zu kümmern. Man sah ihn jetzt öfters wegen einer geringfügigen Ursache die Stiege zum Lehrer emporstampfen. Manchmal suchte er ohne eigentlichen Grund Matriona Fadejewna auf und saß schwatzend ein Viertelstündchen bei ihr. War sie beim Erbsen- und Bohnenreinmachen, [141] so empfand sie seine Besuche ganz besonders unangenehm, denn vor ihren Augen verzehrte Vater Nikiphor in seiner Unverfrorenheit mächtige Portionen des rohen Gemüses und keine Stunde war sie vor seinem Eindringen sicher.
„Ach du grundbarmherzige Güte!“ klagte sie dann wohl ihrem Manne. „Ich muß ja alles im Hause vor dem Hamster, Vater Nikiphor, verbergen und verstecken. Einen Magen hat er wie ein Pferd und gerade das Beste weiß er immer für sich zu ergattern! Gott, ist das ein Kreuz!“
Kusmitsch, der Psalmensänger, ein kleines vertrocknetes Männchen mit einem Fuchsgesicht und einer rosenroten Schnapsnase, zwinkerte dazu listig mit den trüben Äuglein und sagte: „Ja, ja, er ist ein gefährlicher Mensch, – darum muß man sich gut mit ihm stehen, Matrioscha.“
Nach besten Kräften versuchte die brave Frau sich gut mit dem Popen zu stehen, aber es wurde ihr sauer und kam nicht von Herzen.
„Unser Stepan Nikolaitsch läuft jetzt all Augenblick zu den Deutschen!“ wetterte Vater Nikiphor verdrossen, als er ihn wieder einmal vergeblich gesucht hatte. „Deutsch lernen – das ist jetzt seine Passion. Ich aber sage Ihnen, Matriona Fadejewna – das sind alles Dummheiten. Verliebt ist er, wie so ein junger Täuberich – in die schöne Wally. Daraus aber wird nichts!“
Er griff in den Korb mit unreifen Stachelbeeren, die Matriona Fadejewna zum Einmachen reinigte, und biß knackend eine Beere um die andere auf.
[142] Vorsichtigerweise ging die Frau auf das Thema nicht ein.
„Er ist jetzt viel heiterer und umgänglicher,“ sagte sie – „ist doch auch ein junges Blut und hat viel Schweres erlebt.“
„Schweres erlebt!“ höhnte Vater Nikiphor. – „Wer von uns hat nicht schon Schweres erlebt? War das etwa leicht für mich, meine Frau begraben zu müssen – und als Pope ein einsames Witwerleben weiter zu führen?“
Die Frau schwieg und seufzte. Ihre Teilnahme galt der unglücklichen Verstorbenen, aber das brauchte Vater Nikiphor nicht zu wissen.
„Und so ein grasgrüner Bursch mit seinem Herzchen voll Liebe!“ fuhr der Pope fort. „Kennt er das Leben – wie? Wir stehen jetzt in schweren Zeiten – da braucht man tatkräftige Männer, keine verliebten Schwärmer.“
Matriona Fadejewna wagte einen Widerspruch: „Stepan Nikolaitsch tut doch aber redlich seine Pflicht. In der Schule lieben ihn die Kinder sehr.“
„Ist das möglich?“ spottete der Pope. „Ja, weil er eine geradezu stumpfsinnnige Geduld mit ihnen hat und ihnen lieber drei Mal eine Sache erklärt, als daß er einen von den Rangen abstraft. Ist überhaupt eine charakterlose Persönlichkeit - - wie so eine Wasserpfütze, die alles wiederspiegelt. Ist der Himmel blau, dann glänzt auch die Pfütze in blauer Farbe, – ist er trübe und bewölkt, so treiben auch Wolken über die Wasserpfütze [143] Niemals wird aus so einem Menschen ein kräftiger Baum mit einem eigenen Willen: dahin und dorthin breite ich meine Äste aus.“
„Es muß eben verschiedene Menschen geben,“ sagte Matriona Fadejewna philosophisch.
„Und dann ist er ein Freigeist!“ eiferte grimmig Vater Nikiphor. – „Glaubt an die Atome – ha ha! Unsere orthodoxe Kirche ist wohl nicht gut genug für diesen tiefen Denker. Jawohl. Wird sich noch nächstens von seiner deutschen Liebsten den Lutheranerglauben beibringen lassen. Fängt schon an, das Germanentum zu verteidigen und wagt gar eine eigene Meinung zu haben. Wie ich gestern über diese verfluchten deutschen Barone und deutschen Pastoren rede, sagt er ganz unverfroren: „Sie übertreiben, Vater Nikiphor. Auch unter den Deutschen gibt es vortreffliche Menschen, ich lerne sie jetzt besser kennen!’ Jawohl – er wird sie kennen lernen!“
Jetzt riß der gutmütigen Matriona Fadejewna doch die Geduld. Resolut schob sie ihren Korb mit Stachelbeeren von sich, sah den Geistlichen groß an und sagte: „Mit Verlaub, Vater Nikiphor, ich bin eine einfache, ungeschulte Frau, aber Stepan Nikolaitsch kann ich ganz gut verstehen. Er ist ein ängstlicher Mensch und nimmt alles schwer. Darum ist er ja auch aus seiner Heimat fortgezogen. Aber er ist ein guter stiller Mensch und tut niemandem Unrecht. Und wenn die Deutschen ihm gut gefallen, so lassen Sie ihn doch. Es hat jeder seine Art – Sie wollen, daß er mit ihren Augen sieht, – das kann er nicht, und darum [144] ist er kein Mensch ohne Charakter, – er hat nur einen anderen Charakter als Sie.“
So! Jetzt hatte sie’s ihm gründlich gegeben! Nachträglich erschrak sie vor ihrer eigenen Kühnheit, ließ den Kopf sinken und wurde blaurot.
Vater Nikiphor verstummte. In ihrer Einfalt hatte Matriona Fadejewna den Nagel auf den Kopf getroffen. Der kleine Lehrer schlüpfte ihm wie ein Aal unter den Fingern durch, langsam und sicher entglitt er ihm und auf einmal wurde er für Vater Nikiphor eine beachtenswerte Persönlichkeit. Er beschloß, ihn sich zurück zu erobern und seinen Zwecken dienstbar zu machen. In finsterem Brüten saß er schweigend da.
Stepan Nikolaitsch war verliebt – das stand bei ihm fest. Daß es aber eine tiefe und reine und todesstarke Liebe war, die dem Lehrer Licht und Sonne und neues Leben gab, das vermochte der Geistliche in seinem brutalen Egoismus nicht einmal zu fassen.
Stepan Nikolaitsch liebte, wie unverdorbene, einmal gebrochene Menschen lieben. Er liebte über sich selbst hinaus, liebte sich zur Freiheit durch und wuchs an seiner Liebe empor. Die Liebe hatte ihn, nicht er sie gepackt.
Auch Fräulein Wally war ihm in der Seele gut. Zu jung, zu beweglich, zu egoistisch um die Tragweite seiner Liebe zu fassen, war sie doch ehrlich genug, sie zu fühlen und sich mit der freudigen Eitelkeit eines schönen Mädchens darin zu sonnen. Ein [145] bindendes Wort hatte Stepan Nikolaitsch noch nicht zu sprechen gewagt.
So war der Herbst ins Land gezogen. Schwere dräuende Wolken lagerten über den baltischen Provinzen. Wie ein unter dem Boden fortglimmendes Feuer flackerten sorgsam geschürter Deutschenhaß und gewaltsam aufgepeitschte Unzufriedenheit in der bäuerlichen Bevölkerung fort. Dazu gesellte sich eine offenkundige Auflehnung gegen alle bestehende Ordnung. Regierungsfeindliche Proklamationen gingen insgeheim von Hand zu Hand, Hetzreden wurden gehalten, sozialdemokratische Versammlungen mit anarchistischer Färbung fanden in der unteren Volksschicht bereitwillige Aufnahme. Unter dem Deckmantel einer agrarpolitischen Bewegung, die sich gegen die deutschen Besitzer richtete, erhob an allen Enden das Schreckgespenst einer drohenden anarchistischen Revolution sein lauerndes Haupt. Wilde verdüsterte Mienen, drohende Geberden, schamlose Worte regten sich der loyalen deutschen Bevölkerung gegenüber. Überall im Lande brütete eine gespannte Schwüle, wie vor dem Losbruch eines entsetzlichen Sturmes.
Vater Nikiphors Haltung hatte sich verändert. Immer offener, rücksichtsloser und brutaler trat er mit seinem Deutschenhaß hervor. Unter den Letten war er eine beliebte Persönlichkeit, da er ihrem nationalen Bewußtsein schmeichelte und alle Mißgriffe der Regierung, ja selbst die bekannte Bestechlichkeit der russischen Beamtenschaft den Deutschen zur Last legte. Das [146] Unlogische dieser unsinnigen Beschuldigung konnte oder wollte niemand einsehen. Er begann nun öffentlich die Regierungsmaßnahmen zu kritisieren, sich ablehnend dazu zu äußern, die bestehenden schweren Zustände einzelnen Personen aufzubürden, die er mit Namen nannte. In Wahrheit war Vater Nikiphor ein Umstürzler gefährlichster Art und schon längst mit einer anarchistischen Bande heimlich im Bunde. Seine brutale Natur verlangte nach Umsturz, – Umsturz des Bestehenden um jeden Preis. Er geriet in einen Rausch, ja einen Taumel wilden Entzückens, wenn er sich vorstellte, daß seine Herrschsucht auf irgend eine Weise zu wirklicher Macht gelangen könnte. Macht – Macht – das war es, wonach seine Seele lechzte!
Um diese Zeit brachte ein an sich geringfügiger Vorfall die schwelende Flamme in ihm zum Ausbruch. In der russischen Kirchenschule befanden sich auch lettische Kinder lutherischer Konfession, denen Vater Nikiphor gleichzeitig mit den orthodoxen lettischen Kindern den Religionsunterricht erteilte. Als sich diese Kinder dem Pastor Brenner zur Konfirmation vorstellten, weigerte sich der protestantische Geistliche, sie anzunehmen, teils weil sie mit seinen Schülern nicht mithalten konnten, teils um die Eltern der Kirchenschüler zu zwingen, das Verkehrte ihres Vorgehens einzusehen und ihre Kinder der russischen Schule zu entziehen. Die lettischen Eltern, die nur noch äußerlich an der Tradition des Protestantentums festhielten, gerieten darüber in eine wilde Empörung, und Vater Nikiphor wußte diese Stimmung [147] so gut auszunützen, daß tatsächlich eine Reihe von ihnen zum orthodoxen Glauben übertrat. Andere konservativere Elemente hielten an ihrem Lutherglauben fest und verlangten trotzig, der Pastor solle nachgeben. Er blieb natürlich bei seiner Weigerung. Nun aber legte sich Vater Nikiphor in scheinbarer Großmut ins Mittel und erklärte den bestürzten Eltern, er selbst werde mit Pastor Brenner verhandeln.
In siegessicherer Stimmung begab er sich aufs deutsche Pastorat, das von uralten Linden eingehegt, außerhalb des Fleckens lag, und forderte eine Unterredung mit dem Prediger. Er trat in Pastor Brenners Arbeitsstube und fand ihn zu seiner Überraschung nicht allein.
Baron Falkenfels, eine überaus distinguierte Persönlichkeit mit einem eigentümlichen ironischen Zug um die schmalen festzusammengekniffenen Lippen, erhob sich mit sarkastischer Höflichkeit bei seinem Eintritt.
Gemessen trat Pastor Brenner seinem orthodoxen Kollegen entgegen. „Ich habe mit Ihnen zu sprechen, Pastor Brenner“, sagte der Pope ohne Gruß, laut und herausfordernd.[WS 9]
Erstaunt zog der Pastor die Augenbrauen hoch.
„Guten Tag!“ sagte er mit nachdrücklicher Betonung. Vater Nikiphor erbleichte, schoß einen lodernden Blick unter den buschigen Augenbrauen hervor und verbeugte sich mit einem heftigen Ruck. Hart schlugen seine Stiefel zusammen.
[148] „Nehmen Sie gefälligst Platz“, sagte Pastor Brenner und wies auf einen gepolsterten Stuhl.
„Ich ziehe es vor, zu stehen“, grollte Vater Nikiphor. „Es handelt sich um die lutherischen Kirchenschüler in der russischen Schule, denen Sie den Konfirmandenunterricht weigern.
Ich selbst habe meinen Schülern den Religionsunterricht in neutraler Weise erteilt, ohne die konfessionellen Unterschiede hervorzuheben, ich wiederhole es – in gänzlich neutraler Weise. Somit fordere ich die Anerkennung dieses Unterrichts von Ihnen. Meine Religionsstunden sind eine vollständig genügende Grundlage für Ihre Konfirmandenlehre, und nun frage ich Sie: Mit welchem Recht verweigern Sie meinen Schülern den Konfirmationsunterricht?“
Er hatte laut und erregt gesprochen. „Seit wann vertreten Sie meine Rechte, Euer Hochwohlehrwürden?“ fragte der Pastor, der nun auch stehen geblieben war, mit höflicher Gelassenheit.
„Seitdem ich sehe, daß Sie in Ihren Pflichten lässig geworden sind, Pastor Brenner“, stieß Vater Nikiphor wild hervor.
Ein amüsiertes Lächeln spielte um die Mundwinkel der beiden Herren.
„Erlauben Sie mir, Ihnen zu bemerken, daß niemand sich um meine geistlichen Pflichten zu kümmern hat, als das evangelisch-lutherische Konsistorium.“
„Und ist Ihr Konsistorium mit Ihrer Auffassung einverstanden?“ keuchte der Pope.
[149] „Darauf bin ich Ihnen keine Antwort schuldig.“
„Bravo!“ sagte der Baron beifällig. Wie ein gereizter Tiger funkelte Vater Nikiphor den Edelmann an.
„Mit welchem Recht“ ... begann er wieder – „mit welchem Recht nehmen Sie Anteil an unserer Aussprache?“
„Ich verweigere Ihnen jede Antwort auf eine ähnliche Frage“, sprach der Baron mit eisiger Höflichkeit. „Die Antwort daraufhin bin ich jederzeit bereit meinem Landsmanne, Pastor Brenner zu geben. Übrigens nehme ich mir die Freiheit, Sie auf das Deplazierte Ihres Eindringens und Vorgehens aufmerksam zu machen. Wären Sie mir in dieser Weise in meinem Hause begegnet, mein sehr geehrter Herr, ich sähe mich veranlaßt, von meinem Hausrecht Gebrauch zu machen.“
Erstarrt stand Vater Nikiphor. Langsam und mächtig schwollen ihm die Stirnadern an.
„Hausrecht!“ schrie er seiner Sinne nicht mehr mächtig – „Es fragt sich nur, wer das Hausrecht in diesem Lande hat – die eingedrungenen deutschen Herren, die sich das Hausrecht geraubt und gestohlen haben, oder wir Russen und die einheimische Bevölkerung!“
Die Augenlider des Barons zuckten. Er stand in straffer eleganter Haltung da.
„Ich bedaure Sie aufrichtig, lieber Pastor,“ sagte er, „daß [150] Sie sich als Geistlicher gegen die Insulte dieses tollgewordenen Plebejers nicht besser schützen können.“
Darauf nahm er ein Buch zur Hand, wandte beiden Geistlichen den Rücken, setzte sich behaglich in einem Lehnstuhl zurecht und begann leise vor sich hinzupfeifen.
Vater Nikiphor stand da, als habe er einen Schlag ins Gesicht erhalten. Er hob beide Arme, als wolle er sich auf den Edelmann werfen, dann ließ er sie wieder sinken, raffte sich mühsam zusammen und stürzte krachend zur Tür hinaus. „Das sollst Du mir büßen, Du Aristokratenhund!“ murmelte er zwischen den Zähnen.
Bleich vor Wut langte er im Flecken an, schloß sich ein und ließ sich zwei Tage nicht blicken. Er hatte sich krank gemeldet.
In aller Harmlosigkeit übernahm Stepan Nikolaitsch den abgesagten Religionsunterricht des Popen und wanderte am Nachmittag um vier Uhr leichten Herzens zu Fräulein Wally.
Er konnte es gar nicht erwarten, dem schönen geliebten Mädchen in die Augen zu sehen, und heute hatte er eine Überraschung für sie. Nächtelang hatte er sich gemüht und gequält, den „Erlkönig“ auswendig zu lernen, um sie damit zu erfreuen, und nun konnte er ihn und brannte wie ein Schulknabe darauf, ihr das Gedicht vorzutragen.
„Erreicht den Hof mit Müh und Not –
In seinen Armen das Kind war tot.“
flüsterte er vor sich hin. Da stand er auch schon vor der Türschwelle.
[151] Mit lachenden Augen öffnete ihm Fräulein Wally.
Er reichte ihr die Hand und hielt sie fest.
„Der Erlkönig von Goethe“, sagte er pathetisch.
„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Er hält den Knaben wohl in dem Arm,
Er hält ihn sicher – er hält ihn warm.“
„Bravo, bravo!“ rief sie entzückt. „Das haben Sie aber prächtig gemacht, Onkel, Tante, Mietze,“ jubelte sie – „kommt alle heran, Stepan Nikolaitsch kann schon den Erlkönig. Nun, gebe ich nicht gute Stunden, wie?“
„Ausgezeichnet!“ rief der Lehrer emphatisch.
„Also bitte noch einmal!“ befahl Fräulein Wally und nahm eine streng pädagogische Miene an. „Sie stehen vor versammeltem Publikum, Stepan Nikolaitsch, – deklamieren Sie!“
Onkel und Tante Schulz nebst Fräulein Mietze waren ins Zimmer gekommen.
Onkel Schulz, der Veterinärarzt, war ein kleiner untersetzter Mann mit aufgedunsenem Gesicht und kurzen Beinen. Beim Atmen schnaufte er heftig wie eine phlegmatische Dampfmaschine. Tante Schulz sah hübsch und wohlkonserviert aus und litt infolge beängstigenden Schnürens an beständiger Übelkeit. Sie liebte es ungemein, ihr Magenleiden zu betonen. Fräulein Mietze, ein auffallend niedliches rosiges Mädchen, glich ihrer Schwester, war jedoch viel hübscher und natürlicher.
Sie setzten sich erwartungsvoll und Stepan Nikolaitsch begann [152] seinen Vortrag. Stumm vor Bewunderung saßen sie da, dann brach ein stürmischer Applaus los.
„Wally, ich bin einfach starr!“ brach Frau Schulz das Schweigen.
„Pfuh – pfuh – – ausgezeichnet!“ schnaufte der Onkel.
Fräulein Mietze klatschte in die Hände.
„Ich ernenne Dich zu meinem Hof- und Leiblehrmeister, Wally, wenn ich einmal Kaiserin von Russland werde!“ rief sie fröhlich. „Aber ob Du bei Hofe jemals wieder so vortreffliche Schüler hast, dafür kann ich nicht einstehen!“
Alle fanden Mietzes’ Bemerkung sehr witzig und in bester Laune begab sich die Gesellschaft ins Nebenzimmer an den Kaffeetisch.
Mit wichtiger Miene schenkte Frau Schulz den Kaffee ein und bemerkte zu Stepan Nikolaitsch: „Das Rosinenbrot hat Wally selbst gebacken. Nun schmeckt es Ihnen sicher noch einmal so gut – ich selbst, ich kann es leider nicht genießen, meines Magenübels wegen“ fügte sie mit einem entsagungsvollen Seufzer hinzu.
In diesem Augenblick wurde geschellt. Fräulein Mietze sprang an die Tür: „Frau Doktor Treller!“ rief sie.
Erfreut gingen die Damen dem Besuch entgegen.
„Nein, wie reizend, daß Sie uns zum Kaffee besuchen, liebste Frau Doktor“, rief Frau Schulz und vergaß für einen Moment ihr Magenübel und Wallys Rosinenbrot.
[153] Frau Doktor Treller zählte sich zu den wenigen Honoratiorenfamilien des Fleckens. Ihr Mann war ja auch „wirklich studiert“. Ihre Würde trug sie mit soviel Selbstbewußtsein wie ihren einzigen seidenen Unterrock, den sie zu Besuchen immer anzog. Vor Frau Veterinärarzt Schulz hatte sie den großen Vorzug, mit der Frau des Pastors auf besonders gutem Fuß zu stehen, und sie zählte Baron Falkenfels, freilich ohne Gemahlin, zu ihren näheren Bekannten. Er pflegte zweimal im Jahr zum Besuch anzutreten. Das war natürlich ein märchenhaftes Ereignis für sie und ein Ärgernis für die weniger bevorzugte Veterinärsfamilie.
Heute war sie in ihrer Märchenlaune. Der Baron war dagewesen, um den Doktor zur Jagd aufzufordern. An solchen Tagen war Frau Doktor Treller besonders leutselig und herablassend.
„Guten Tag, meine Gute“, sagte sie mit kühler Freundlichkeit, „ich habe mir das Vergnügen gemacht, Ihnen persönlich eine freudige Nachricht zu überbringen. Der Baron war nämlich heute bei uns“, dehnte sie, – „mein Gott, wen haben Sie denn da im Eßzimmer?“
„Den russischen Volksschullehrer, beste Frau Doktor“, flüsterte Frau Schulz ihrem Gast ziemlich vernehmlich zu. „Ich will Sie gleich miteinander bekannt machen.“
„O keine Eile, Frau Schulz“, sagte Frau Doktor Treller und lorgnettierte nachlässig zu Stepan Nikolaitsch hinüber, der mit dem Veterinärarzt am Kaffeetisch geblieben war, – „umsomehr, da ich Ihnen zunächst die gute Nachricht mitteilen [154] will. Also der Baron war heute vormittag bei mir“, wiederholte sie mit Behagen, „und klagte mir seine Not. Denken Sie bloß, die Mutter der Falkenfels’schen Gouvernante ist schwer erkrankt und Fräulein Schneider reist Hals über Kopf ab. Nun ist ein Ersatz notwendig und da habe ich mir erlaubt, dem Baron Fräulein Wally vorzuschlagen.“
Sie klopfte Frau Schulz mit dem zusammengeklappten Lorgnon leicht auf die Hand, lehnte sich ins Sofa zurück, blinzelte triumphierend und fragte: „Nun, was sagen Sie denn dazu?“
„Aber – das ist ja einfach großartig! – Wally, hörst Du, Du kannst die Stelle beim Baron bekommen!“
Wally machte große Augen. „So?“ sagte sie neugierig.
„Jawohl, den Unterricht am Vormittag besorgt der Hauslehrer, Herr von Röhren, – Sie wären also nur für die Nachhilfestunden nötig für die kleinen Baronessen, – täglich von eins bis sieben. Diner im Schloß – denken Sie bloß, und vierzig Rubel monatlich.“
„Ja, ganz schön“, sagte Fräulein Wally nachdenklich – „was wird denn nun aber aus meinem deutschen Unterricht mit Stepan Nikolaitsch?“
Frau Doktor Treller zog die Augenbrauen hoch. „Ja, das schlagen Sie sich nur ganz aus dem Sinn, zweien Herren kann man nicht dienen, Liebe“, sagte sie in beleidigtem Ton. „Uberhaupt“ – sie neigte sich zu Frau Schulz hinüber und flüsterte: „Ich finde die Sache, unter uns gesagt, nicht ganz passend – ein [155] junger Mann, dazu noch ein Russe – und Ihre Wally im täglichen Verkehr mit einander, man redet schon darüber, ich versichere Sie.“
„Pah!“ machte Wally geringschätzig. – „Mögen die Menschen reden, wenn es ihnen Vergnügen macht, übrigens gebe ich die Stunden nicht täglich, sondern zweimal wöchentlich.“
„Und Herr Goruschkin ist wirklich ein sehr netter bescheidener junger Mann“, fiel Frau Schulz ein. „In Libau sieht niemand etwas darin, Wally hat schon oft ...“
„So? Also in Libau mag man ja großstädterische Ansichten haben“, sagte Frau Doktor Treller spitz. „So reflektieren Sie nicht auf die Stelle, Fräulein Wally? Soll ich dem Baron eine abschlägige Antwort erteilen?“
„Im Gegenteil“, rief Wally eifrig, „ich nehme an und bin Ihnen sehr dankbar, Frau Doktor.“
„Die Equipage des Barons soll Sie in der Dämmerung nach Hause bringen“, fuhr Frau Doktor fort. Diesen letzten Trumpf hatte sie sich noch aufgespart.
„Aber das ist ja prächtig!“ rief Frau Schulz andachtsvoll. „Wally, freust Du Dich denn nicht? In dem eleganten Wagen mit zwei milchweißen Schimmeln durch den Flecken zu fahren, wie so eine Prinzeß!“
Wallys Augen funkelten. „Das ist ja sehr nett“, sagte sie mit einiger Zurückhaltung. „Auch in Libau habe ich einem jungen Adligen russische Konversationsstunden gegeben!“ renommierte sie.
[156] „Aber meine liebste Frau Doktor“, rief nun Frau Schulz jammernd, „wir reden und reden, und der Kaffee wird inzwischen kalt. Kommen Sie doch zu Tisch!“
Die Damen standen auf und traten in das Eßzimmer. „Guten Tag, Herr Schulz“ – eine etwas zeremonielle Begrüßung erfolgte.
„Herr Schullehrer Goruschkin“, stellte Frau Schulz vor – „Frau Doktor Treller.“
Bescheiden hatte sich Stepan Nikolaitsch erhoben. Frau Doktor Treller musterte ihn mit überlegenem Lächeln und reichte ihm nicht die Hand. Verlegen setzte er sich wieder und als er den Brotkorb hinüberreichte, stieß er die Sahne um.
„O, bitte entschuldigen Sie!“ rief er erschrocken.
Es wurde eine peinliche Viertelstunde. Man sprach über seinen Kopf hinweg von dem Baron und seiner weitverzweigten Verwandtschaft. Frau Doktor war aufs Beste orientiert und gab genau Bescheid.
Fräulein Wally wurde die Situation unbequem.
„Kommen Sie, Stepan Nikolaitsch“, sagte sie laut, – „Frau Doktor, Sie entschuldigen gütigst, aber es ist Zeit, unsere Stunden zu beginnen.“
Mit ein paar linkischen Verbeugungen komplimentierte sich Stepan Nikolaitsch aus dem Speisezimmer hinaus. Fräulein Wally führte ihn in die Arbeitsstube des Onkels und schloß die Tür.
[157] „Diese Frau Doktor ist eine hochmütige Gans,“ sagte sie resolut, – „und wenn sie mir auch die Stellung beim Baron verschafft hat, – gut bin ich ihr darum noch lange nicht.“
Stepan Nikolaitsch hatte nicht deutlich verstanden. „Wie?“ fragte er mit weit geöffneten Augen. „Die Dame hat Ihnen eine Stelle beim deutschen Baron verschafft? Als was?“
„Ich soll die kleinen Töchter unterrichten und mich mit ihnen beschäftigen, täglich von eins bis sieben. Ja, da tut es mir um unsere Stunden herzlich leid, Stepan Nikolaitsch!“ fügte sie hinzu und besah ihre zierlichen Fingernägel.[WS 10]
Als keine Antwort kam, blickte sie auf und erschrak.
Leichenblaß saß Stepan Nikolaitsch ihr gegenüber. Mühsam bezwang er sich. „Da muß ... muß ich wohl gratulieren!“ sagte er heiser.
Sie sprang auf und legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Stepan Nikolaitsch,“ bat sie, „Stepan Nikolaitsch, – so nehmen Sie sichs doch nicht so zu Herzen! Ich will Ihnen ja gerne am Sonntag Stunden geben, da sind wir ja beide frei!“
Traurig schüttelte er den Kopf und blickte zu Boden.
„Es ist ja nicht um die Stunden allein,“ sagte er in leisem einförmigen Ton – als spräche er zu sich selbst, „obgleich ich, – ich kann wohl sagen vom Mittwoch bis Sonnabend eigentlich gelebt habe, und dann wieder vom Sonnabend bis zum Mittwoch ..., nein, nein, es ist nicht um die Stunden allein, Wally Iwanowna, – aber Ihr Leben wird von nun an ein anderes, [158] glänzenderes, – und darin wird kein Raum mehr sein für den Volksschullehrer.... Sie werden sich schnell dahinein finden – es ist ja so natürlich ... ihm aber, dem armen Narren bricht etwas dadrin entzwei.“
Mit einer hilflosen Geberde legte er die Hand aufs Herz.
„Aber Stepan Nikolaitsch, guter Stepan Nikolaitsch, reden Sie doch nicht so!“ rief sie in ehrlichem Mitgefühl. „So ist es nicht.“
„Ist es nicht so?“ fragte er und sah sie mit langem tiefen Blick an.
„Nein, wirklich nicht!“ beteuerte sie.
Da sprang er auf und warf sich vor ihr nieder.
Er drückte den Saum ihres Kleides an seine Lippen, an Stirn und Augen.
„O Wally Iwanowna, Wally,“ – keuchte er ganz außer sich, „wissen Sie denn nicht, fühlen Sie denn nicht, wie ich Sie liebe?“
Erschüttert beugte sie sich zu ihm nieder, ihre Finger streichelten sein Haar. „Ich habe Sie ja auch lieb, Stepan Nikolaitsch.“
Er war aufgestanden und sah sie mir glühenden Augen verzehrend an. „Sie – mich? Sie .... mich?“ wiederholte er wie ein Irrsinniger, „Nein, Wally Iwanowna, – das ist ja nicht möglich! Das wäre ein so grenzenloses Glück für mich .... ich kann, ich darf es nicht glauben!“
„So glauben Sie es doch nur!“ rief sie zwischen Lachen und [159] Weinen, „glauben Sie es – Sie großes, bescheidenes Kind, Sie großer, lieber, einfältiger Junge! Glaub’ es doch, Du guter, einziger Freund!“
„Ihr Freund! Ja – Dein Freund, Wally!“ Seme Stimme schwankte vor tiefer bebender Zärtlichkeit. „So wahr ich Sie über alles in der Welt liebe, – so wäre ich ein Schurke, wenn ich nur diese Stunde und Ihre Güte zu Nutze machte! Nein, Wally Iwanowna, wenn Sie mir das nach einem Jahr wiedersagen können, dann, ja dann werde ich daran glauben dürfen. Jetzt ... bin ich Ihr Freund, und das ist Glücks genug!“
Er beugte sich über sie und küßte sie andächtig auf Stirn und Augen.
Mein Gott, dachte Fräulein Wally und ihr Herz pochte heftig – nun bin ich also verlobt! Wie er mich liebt! sieht aus wie ein Verklärter ...
Wie ein Verklärter sah Stepan Nikolaitsch tatsächlich aus. Es wurde eine kurze inhaltreiche Konversationsstunde, nur war die Konversation diesmal in russischer, nicht in deutscher Sprache geführt worden. Fräulein Wally wurde hinausgebeten, da Frau Doktor Treller ihr noch einige Details über das Haus des Barons mitzuteilen hatte.
„Auf nächsten Sonntag also!“ rief sie Stepan Nikolaitsch mit strahlendem Lächeln zu.
„Auf nächsten Sonntag!“ wiederholte der kleine Mann wie im Traum und wie im Traum schritt er direkt aus der Arbeitsstube [160] hinaus auf die Straße. Er hatte vergessen von der Familie Abschied zu nehmen.
Der Sonntag kam und Stepan Nikolaitsch war natürlich zur Stelle. Aber Fräulein Wally konnte er keinen Augenblick allein sprechen und aus der Stunde wurde nichts. In der Mitauschen Gegend waren Unruhen ausgebrochen, in Libau und Windau gärte es, ein Baron war meuchelmörderisch erschossen worden, rohe Kirchenschändungen wurden vom flachen Lande aus gemeldet. Das ganze Haus des Veterinärarztes befand sich in Erregung. Dazu kam, daß Wally aus dem Falkenfelsschen Schloß mit Privatnachrichten über die empörenden Vorfälle versehen war und sie wichtig vortrug. Frau Doktor Treller war auch erschienen und hing begierig an Wallys Lippen.
„Das wäre Alles nicht soweit gekommen, wenn die Russifizierung uns das Volk nicht verdorben hätte!“ sagte sie giftig.
Eine schwüle Stille trat ein. Hastig begann Fräulein Wally von etwas Anderem zu reden. Der kleine Volksschullehrer war aufgestanden. Er fühlte es – in diesem Hause war kein Platz mehr für ihn. Er war ja Russe! War er nicht mit schuld an den Leiden der baltischen Provinzen?
Einen flehenden Blick warf er auf Wally, den Blick eines treuen geprügelten Hundes. Dann verabschiedete er sich stumm.
„Nächsten Sonntag, lieber Stepan Nikolaitsch!“ sagte Fräulein Wally ermutigend und drückte ihm fest die Hand.
[161] Aber er wußte: weder nächsten Sonntag, noch überhaupt jemals würde es sein, wie es gewesen.
Am Sonntag um acht Tage erhielt er ein Briefchen von Wally. Nur wenige Worte mit Blei hingekritzelt:
- „Wir machen heute einen gemeinsamen Ausflug. Ich hoffe, Sie sind darum nicht böse Ihrer Freundin Wally.“
Er und böse! Er lächelte traurig und steckte den Zettel in seine Brusttasche.
Nach vierzehn Tagen kam er zaghaft abermals. Fräulein Wally errötete als sie ihn begrüßte, war lebhaft und unruhig und hatte viel vom Hause des Barons zu erzählen. Von deutschen Stunden war nicht mehr die Rede. Die Stimmung im Hause des Veterinärarztes war merklich kühler geworden.
Wie ein Verbannter schlich Stepan Nikolaitsch stumpf und müde in seine Behausung.
Stundenlang pflegte er jetzt untätig vor sich hinzustarren. Er war wortkarg und unzugänglich geworden und wich allen Miteinwohnern, besonders Vater Nikiphor scheu aus.
Ein trüber naßkalter Herbst war auf die Sommertage gefolgt. Oktoberwinde heulten rauh und kläglich um den kleinen Flecken, laublos streckten die kahlen Bäume ihre dürren Äste in den grauen Himmel.
Die Zeitungen brachten schlimme Nachrichten. Die Unruhe im Lande wuchs. Pöbelhafte Ausschreitungen des aufgehetzten Volkes waren an der Tagesordnung. Jedes Blatt brachte spaltenlange Berichte von Raubüberfällen und Mord, von [162] Bränden und Kirchenschändungen. Scharenweise flüchteten die Gutsbesitzer mit ihren Familien in die Städte.
Im Flecken wurde eine feindselige Haltung gegen die wenigen Russen fühlbar. Man wich ihnen aus. Der Veterinärarzt war eilig in eine Seitengasse gebogen als er Stepan Nikolaitsch von weitem erblickte.
Vater Nikophor trug den Kopf hoch. Er hatte nicht viel Zeit. Man munkelte, er halte sozialistische Reden in geheimen Versammlungen. Triumphierend, mit gewaltigen Schritten sah man ihn durch die Straßen streifen oder auf der Post die frisch erhaltenen Zeitungen durchblättern.
Im Hausflur stieß er eines Tages auf Stepan Nikolaitsch, der sich hastig an ihm vorbeidrücken wollte, und hielt ihn am Ärmel fest.
„Nun, Sie Deutschenfreund!“ sagte er spottend – „Was verkriechen Sie sich denn wie ein Maulwurf? Hat die schöne Wally Sie endgültig im Stich gelassen? Die deutschen Barone gefallen ihr freilich besser. Sie fährt ja jetzt täglich in ihrer Baronskarosse mit Begleitung nach Hause!“
„Lassen Sie mich!“ stieß der Volksschullehrer rauh hervor. Er zitterte am ganzen Leibe.
„Fällt mir auch nicht im Traume ein, – Sie Duckmäuser“, sagte der Pope gemächlich, – „im Gegenteil, ich gehe jetzt mit Ihnen auf Ihr Zimmer und trinke eine Tasse Tee, habe schon längst die Absicht, Sie zu besuchen und mich mit Ihnen auszusprechen.“
[163] Willenlos ging Stepan Nikolaitsch voraus. „Sie fährt jetzt täglich in ihrer Baronskarosse mit Begleitung nach Hause,“ dröhnte es ihm noch in den Ohren.
Die Teemaschine stand dampfend auf dem Tisch. Behaglich schlürfte der Pope eine Tasse um die andere und durchbohrte dabei Stepan Nikolaitsch mit seinen faszinierenden Blicken.
In sich zusammengesunken brütete der Volkschullehrer vor sich hin.
„Es wird jetzt eine lustige Hetzjagd – je toller, desto besser, Bauernschaft und Adel, Bürger und Militär. – Alles durch- und gegeneinander! Mögen sie sich nur untereinander auffressen! Wir Russen bleiben ja doch Sieger und Herren im Lande! Da“ – er zog eine Zeitung aus der Tasche – „sehen Sie hier, – wieder sind zwei Barone erschossen worden, der eine in der Kirche, der andere auf einem Inspektionsritt durch das Land. Hätte nur dieser verhaßte deutsche Adel eine einzige Kehle, daß man ihn mit einem Schnitt vernichten könnte!“ sagte er ingrimmig.
Stepan Nikolaitsch schlug die Hände vors Gesicht. „Blut. ... überall Blut und Mord!“ stöhnte er – „ich kann davon nichts mehr lesen noch hören!“
„Du kannst nicht?“ höhnte der Geistliche. „Sieh mir das zarte Muttersöhnchen an – es kann von Blut nichts hören! Aber ich sage dir, Freundchen, – das wird noch alles ganz anders. In Blut wirst du selber noch waten müssen – knietief! [164] Das hier ist ja bloß der Anfang – es kommt noch anders, ganz anders!“
„Lassen Sie mich allein!“ schrie plötzlich Stepan Nikolaitsch so wild, so schneidend, daß der Pope zusammenfuhr. „Sehen Sie nicht, daß ich ein unglücklicher kranker Mensch bin? Lassen Sie mich allein!“
Der Pope stand auf. „Gut, Brüderchen!“ sprach er drohend und seine Augen funkelten unheimlich; „aber eins sage ich dir – an diese Stunde, wo du den Vater Nikiphor aus deiner Stube gejagt hast, wirst du zeitlebens denken – zeitlebens sage ich dir.“
Dröhnend schlug er die Tür zu und stolperte die Treppe hinab.
Regungslos war Stepan Nikolaitsch sitzen geblieben. Er stützte den Kopf in die Hände. Leise surrte die Teemaschine und ein kaltes Grauen kroch ihm lähmend durch alle Glieder. Ihn fror trotz der überheizten Stube. Da war es ja wieder, das Entsetzliche, das er sich seit Monaten vom Halse geschüttelt hatte, das zwingende, das dämonische Etwas, das vom Vater Nikiphor auf ihn einwirkte, und er wußte – bald war er diesem Einfluß verfallen! –
Im Dunkel des Herbstabends strich eine verhüllte Männergestalt wie ein unruhiger Schatten über die Brücke und wanderte rastlos hinter der Schmiede, in welcher der verwaiste Krisch lebte, auf und nieder, auf und nieder. Die Straße führte an der Schmiede vorbei weiter nach dem Schloß. Zur Rechten auf [165] halbem Wege, von dem halberstarrten Flüßchen begleitet, ragten die entblätterten Linden des deutschen Pastorats wie finstere Gespenster in den bewölkten Himmel hinein, und weiter von dem Kamm eines Hügels hoben sich fest und massiv die zackigen Konturen des Schlosses.
Der Wanderer blieb bei jeder neuen Wendung stehen und starrte nach dem Schloßturm, der wie ein Herold breit und wichtig das ganze Gebäude überragte.
„Es war einmal ein reicher Mann,“ murmelte er vor sich hin, „der hatte viele Weinberge und lebte herrlich und in Freuden, und es war ein armer Mann, der hatte nur einen einzigen Weinberg, den er liebte wie seinen Augapfel. Und der reiche Mann sprach zum Armen: Gehe hinaus von Deinem Weinberge, ich bedarf seiner zu meinen Gärten. Der arme Mann aber wollte nicht, da trieb ihn der Reiche hinaus von seinem Weinberge und nahm ihn zu seinen Gärten.“
Wieder blieb er stehen und schüttelte den Kopf. „Nein, nein,“ sagte er hastig, laut, – „das ist ungerecht! Weiß denn der reiche Mann von dem Weinberge des Armen? Weiß er überhaupt von dem Armen? Das ist ungerecht – Vater Nikiphor hat dich mit seiner Ungerechtigkeit angesteckt, Stepan Nikolaitsch.“
Der kleine Mann raffte sich zusammen und ging wieder mit hastigen Schritten auf und nieder, auf und nieder. Bei der Wegewendung blieb er nicht mehr stehen und enthielt sich des Blicks auf den Schloßturm. „Sieh nicht hin,“ flüsterte er, „vielleicht kommt sie dann eher.“
[166] Er sah nicht hin und eine neue fiebernde Unruhe jagte qualvoll durch seine Glieder.
„Wie ein Bettler am Wegrande!“ stieß er dumpf und laut hervor. „Ja, wie ein armseliger Bettler!“
Ein brennendes Mitleid mit sich selbst jagte ihm heiße Tränen in die Augen. Hastig wischte er sie fort und lauschte. Klang das nicht wie fernes Räderrollen? „Ja, ja – sie ist’s! Endlich!“ Horchend blieb er stehen und neigte den Kopf. Das Räderrollen kam näher – in ungestümen wilden Schlägen hämmerte sein Herz. Er preßte die Hände zusammen, als rängen sie miteinander in stillem wütendem Kampf. Kalter Schweiß feuchtete seine Stirn. Mit knarrendem Gepolter kams näher und näher – – es war ein Bauernwagen! Eine trunkene Gestalt taumelte darin hin und her und mit unbarmherzigen Schlägen hieb sie ein auf das armselige struppige Pferdchen.
Stepan Nikolaitsch hüllte sich fest in seinen Mantel. Eine entsetzliche Übelkeit stieg in ihm auf. Blaß und verzerrt stand plötzlich das Gesicht seines Freundes vor ihm. „Ich hab mein Schulgeld verspielt, alles bis auf die letzte Kopeke, morgen werd ich aus dem Seminar gejagt und dann schieß ich mir eine Kugel durch den Kopf!“ – – Eine Kugel durch den Kopf, eine Kugel durch den Kopf – raunte es unablässig in ihm weiter. Selig sind die Toten – und das Leben ist Qual, Tod aber ist Erlösung – zuckte es ihm wie ein Blitz durch den Sinn, und [167] dann stand wieder das große eherne Gebot wie mit Flammenschrift ruhig und ernst vor seiner Seele: Du sollst nicht töten!
Er schauderte. Er wollte ja nicht töten, – er dachte ja gar nicht daran, und während er versunken so vor sich hinstarrte, kam ein Pferdegetrappel, sauste ein leichtes elegantes Rollen immer näher und näher. Er schrak auf. Sein Herz tat einen gewaltigen Schlag und versteinert blieb er stehen.
Ein fröhliches klingendes lachen – wie oft hatte er es gehört, - - eine weiche zurückgelehnte Gestalt in Federhut und Pelzrotunde, – ein schlanker bärtiger Mann neben ihr in einer Lodenjoppe, einen spitzen Hut auf dem Kopf – vorbei, weg – vorüber!
Betäubt starrte der Volksschullehrer auf die Rückseite des Wagens, der sich wiegend und pfeilschnell fortbewegte. Jetzt gings über die Brücke, – jetzt, jetzt sah er nur noch die Gestalt des Kutschers und jetzt bogen die milchweißen Schimmel in den Flecken und lauter ertönte das Rollen über das schlechte unregelmäßige Pflaster.
Ein Traum, ein Augenblick nur eines Traumes, aber auch dieser Augenblick war der Mühe, war all des Harrens und Hoffens wert gewesen. Das klingende Lachen, – noch hörte der kleine Mann es deutlich, – und die furchtbare Spannung seiner Nerven löste sich, ein stilles müdes Weh kam leise wie mit sanften Fittigen über ihn. Tief seufzte er auf und trat den Heimweg an.
[168] Von nun an war es Stepan Nikolaitsch Bedürfnis, ja Notwendigkeit geworden, täglich auf die barönliche Equipage da draußen hinter der Brücke zu warten.
Wochen und Monate strichen vorüber. Wochen und Monate aus einzelnen kleinen Augenblicken, öden Stunden und schmerzvollen Tagen geflochten und gewoben im rätselhaften Gewebe der Zeit. Dennoch enthielt jeder einzelne Tag für den Lehrer einen Licht- und Höhepunkt, einen Auf- und Niedergang, den Moment, wo er die anmutige Gestalt des jungen Mädchens im Federhut an sich vorüberrollen sah. Aber auch in diesem flüchtigen Moment gab es Höhen und Tiefen, – Höhen, wenn sie ernst und schweigsam an ihm vorüberflog, – Tiefen, wenn sie sich lachend wie in übermütigem Spiel zu ihrem Begleiter beugte.
An die Stelle des barönlichen Wagens war jetzt ein barönlicher Schlitten getreten, denn der Winter war gekommen. Statt des Federhutes saß eine kecke Pelzmütze flott und ein wenig schief über dem geliebten Gesicht. Das waren Veränderungen, die Stepan Nikolaitsch bemerkte, sonst gab es für ihn keine. Sein Leben ging seinen gleichmäßigen, einförmigen Lauf. Ruhig und geduldig gab er seinen Schulunterricht, ruhig und geduldig mit der gleichen still-leidenden Miene teilte er Lob und Tadel unter seinen Schülern aus, – mehr konnte man von ihm nicht fordern.
Nein, mehr konnte man wirklich nicht von ihm fordern, und dennoch gab es einen, der ein gewaltiges Mehr von ihm forderte, und das war der Vater Nikiphor. Er haßte den kleinen [169] Volksschullehrer und sein Haß machte ihn scharfsichtig und blind zugleich. Mit dem Instinkt des beutelüsternen Raubtieres empfand er, daß die Stunde, wo er Gewalt über sein Opfer erlangen würde, nicht mehr fern war. Noch aber war die Stunde nicht gekommen. Es war sonderbar, daß Stepan Nikolaitsch an die letzten drohenden Worte des Popen nicht mehr dachte. Um so mehr aber dachte Vater Nikophor daran und jedesmal, wenn er dem Lehrer begegnete, schluckte er ingrimmig und wütend die Worte in sich hinein: „Du wirst, Du sollst an mich denken!“
Der eine beherrschende Inhalt seines Lebens war für Stepan Nikolaitsch Wally und das Verlangen sie zu sehen. Neben ihr konnte kein Vater Nikiphor aufkommen, und wenn es doch geschah, ganz unvermittelt in schlaflosen Nächten oder mitten in einer geographischen oder grammatikalischen Erklärung, die er seinen Schülern gab, dann war das Bild widrig und der Eindruck schnell verwischt. Dennoch lebte im Unterbewußtsein des kleinen Mannes die Gewißheit, daß er sich auf die Dauer dem Einfluß des Popen nicht werde entziehen können. Aber auch dies war ihm gleichgültig geworden. Er empfand kein schreckhaftes Grauen mehr vor ihm, nur einen dumpfen Widerwillen.
Der Widerwille war berechtigt, denn in den Augen Vater Nikiphors glimmten und glühten lüsterne Blut- und Mordgedanken. Rachsucht und Fanatismus waren in ihm durch die fortgesetzten Mordberichte zu einem alles beherrschenden Wahn geworden: auch hier, in diesem kurländischen Flecken müsse ein [170] freiherrliches Opfer fallen. Teuflische Bosheit malte es sich mit Behagen aus, daß gerade der harmloseste und unschuldigste Mensch Stepan Nikolaitsch die Bluttat vollbringen solle. Das Wie war ihm allerdings noch nicht klar.
Mittlerweile hielt der Pope ungehindert glühende Brandreden in geheimen Versammlungen. Er entfachte die Instinkte des Volkes zu wilder Wut. Er hatte den verwegenen Plan gefaßt, den ganzen Flecken an der Spitze einer anarchistischen Bande zu überrumpeln und so endlich zu dem ersehnten Ziel zu gelangen, das seine Herrschsucht ihm wies.
Matriona Fadejewna mochte etwas von den Umtrieben des Popen vernommen haben, denn sie fuhr immer ängstlich zusammen, wenn sie seinen dröhnenden Schritt vernahm, und saß ihm scheu und stumm gegenüber, wenn er zu ihr herein kam. Eine gewisse Wahlverwandtschaft zog sie zu dem Volksschullehrer hin und mehr als einmal raunte sie ihm flüsternd auf Flur und Treppe zu: „Nehmen Sie sich vor dem Vater Nikiphor in Acht – er ist ein schrecklicher Mensch!“ Dann bekreuzigte sie sich und murmelte ein Gebet.
Ein klarer frostiger Winterabend lag über dem Flecken und wieder machte sich der Lehrer zu seinem einsamen Gange auf. Schon längst war das Rauschen des Flüßchens verstummt; auf seiner beeisten Fläche tummelte sich die Schuljugend. Jetzt war alles still und hastig stapfte der kleine Mann über den knirschenden Schnee. Vom klaren Himmel nieder funkelten milde traurige [171] Sterne und eine stille friedliche Wehmut füllte des Einsamen Seele. Heute hatte er nicht lange zu warten. Noch ehe er die Brücke überschritten hatte, sah er das ersehnte Gefährt. In langsamem Trabe glitt es hinter der Brücke an ihm vorüber wie ein Schemen.
Aber was er jetzt sah, durchzuckte ihn mit siedender Glut. In den Armen des Mannes mit dem spitzen Hut lag das Mädchen – in seliger Hingebung – und an sein geschärftes Ohr schlug ein leises, kaum vernehmliches jubelndes Schluchzen.
So war er also verraten! Und Wally, seine Wally gab sich einem verheirateten Manne hin!
Stumpf, mit dem Ausdruck eines Irrsinnigen starrte er dem Schlitten nach. Vom klaren Himmel nieder funkelten matte traurige Sterne und blinzelten, – er aber sah sie nicht, er fühlte nur das eine: Er mußte sie, die er liebte, vor Schande und Schmach bewahren. Mochte sie ihn immer verraten, – was lag daran? Aber um ihrer selbstwillen mußte sie rein und unbescholten bleiben!
Ein dumpfes heiseres Stöhnen entrang sich seiner trockenen Kehle – wild griff er um sich in die leere Luft und schwer fiel er nieder, besinnungslos in den kalten steifgefrorenen Schnee.
Er hatte eine Weile gelegen, da rüttelte ihn ein schwacher Arm und eine Kinderstimme rief flehend: „Stepan Nikolaitsch, lieber Stepan Nikolaitsch, bitte, so stehen Sie doch auf!“
Es war Krisch! Sein Vater hatte ihn in den Flecken nach [172] Branntwein geschickt und in dem armseligen zusammengebrochenen Haufen hatte der Knabe seinen Lehrer erkannt.
War der Lehrer betrunken oder tot? Eine dritte Möglichkeit gab es für das beschränkte Fassungsvermögen des armen Jungen nicht. Schnell kauerte er sich nieder zu ihm auf den Schnee und hob das blasse Haupt auf die Knie. Er beugte sich zu ihm hin und schnupperte wie ein Jagdhund an dem Munde des Bewußtlosen. Nein, nach Branntwein roch sein Atem nicht. Stepan Nikolaitsch war also tot. Ein namenloses Entsetzen rüttelte den Knaben, hastig sprang er auf und lief spornstreichs in den Flecken hinein, so schnell ihn die Beine trugen.
Über den Marktplatz schritt mit weit ausholenden wuchtigen Schritten ein Mann.
Krisch stürzte ihm entgegen. „O helfen Sie, helfen Sie, Vater Nikiphor, Stepan Nikolaitsch ist tot – er liegt da hinter der Brücke!“
„Stepan Nikolaitsch tot? Was sagst Du, Junge? Noch heute war er frisch und gesund.“
„Kommen Sie, kommen Sie schnell!“ jammerte Krisch. „Es ist Stepan Nikolaitsch und da liegt er im Schnee hinter der Brücke, ganz starr und kalt!“
Betroffen folgte der Geistliche dem Knaben. In fünf Minuten waren sie zur Stelle. Der Pope kniete nieder und betastete den Besinnungslosen. Er riß ihm den Rock auf und legte ihm die Hand auf das Herz. [173] Dann nahm er eine Handvoll Schnee und begann ihm die Schläfen zu reiben.
Die Augenlider des Lehrers zuckten. Mit einer gewissen ingrimmigen Schadenfreude rieb der Pope stärker und stärker.
„Geh, hol’ Branntwein!“ herrschte er den Jungen an. „Stepan Nikolaitsch lebt!“
In großen freudigen Sprüngen sauste Krisch in den Flecken zurück.
Verwirrt schlug der Lehrer die Augen auf. „O Wally“, murmelte er schmerzlich ... „Der Baron ...“
Gierig sog der Pope die geflüsterten Worte ein. – Der Baron! hatte er gesagt. Der Baron harte ihm etwas zu Leide getan!
Er rüttelte den noch nicht völlig Erwachten hart.
„Du wirst den Baron totschießen“ – sprach er gedämpft und eindringlich. Es klang wie ein hartes Kommando.
Stepan Nikolaitsch taumelte empor. „Ich werde – den Baron – totschießen –“ murmelte er dumpf. Der Kopf fiel ihm schwer zur Seite.
Der Geistliche riß ihn empor und stellte ihn auf die Füße.
„So!“ sagte er, „Stütze Dich nur fest auf mich. Du kannst stehen.“
„Ich kann stehen“ – wiederholte Stepan Nikolaitsch willenlos.
Sie gingen einige Schritte. Der Geistliche überlegte. Da sah er eine kleine Gestalt in eiligem Laufe auf sich zukommen. [174] Jetzt war keine Zeit mehr zum Besinnen, es mußte gehandelt werden. Er zog einen blinkenden Gegenstand aus der Tasche und sagte ruhig im selbstverständlichsten Tone: „Da nimm, Bruder und ziele gut.“
Und Stepan Nikolaitsch nahm den Revolver ...
Mit freudeglänzenden Augen sah Krisch seinen Lehrer an. „Hier der Branntwein!“ keuchte er und hielt die Flasche hoch.
Der Geistliche entkorkte die Flasche. „Trinken Sie, Stepan Nikolaitsch.“
Auch diesmal gehorchte der Volksschullehrer und nahm ein paar Schluck. Seine Augen blickten stumpf und trübe.
„Stepan Nilolaitsch ist krank“, sagte Vater Nikiphor zu Krisch – „Geh nach Hause, Junge!“
Krisch warf einen fragenden Blick auf den Lehrer und trollte sich betrübt, die Flasche unterm Arm. Wortlos schritten die beiden Landsleute durch den Flecken heimwärts.
Stepan Nikolaitsch warf sich in Kleidern auf sein Bett und schlief schwer und dumpf bis zum hellen Morgen.
Von nun an war er ein Anderer. Er begann seine Kleidung zu vernachlässigen. Der sonst so peinlich saubere Mensch ging mit struppigem Haar, unordentlichem Halskragen und ungewichsten Stiefeln in seine Klasse. Beim Unterricht war er heftig und ungeduldig. Der geringste Umstand konnte ihn reizen und dennoch war er eigentlich nicht recht bei der Sache. Befremdet stand die Schuljugend ihrem gütigen Lehrer gegenüber.
[175] „Er ist krank!“ erklärte Krisch gönnerhaft seinen Kameraden. – „Er war schon beinahe tot, darum ist es nicht richtig mit ihm.“
Es war nicht richtig mit ihm, denn er hatte keinen eigenen Willen mehr. Er stand unter fremdem Willen und ging einher wie ein Schlafwandelnder.
Die furchtbare seelische Erschütterung, der festgewurzelte Wahn, daß er Wally vor Sünde und Schuld bewahren müsse, dazu der dämonische Einfluß des Popen hatten den stillen, harmlosen, kleinen Mann völlig umgewandelt. Wie ein leidenschaflicher Jäger, der nicht ruht, bis er sein Wild beschlichen und gestellt, so verfolgte Stepan Nikolaitsch mit stiller Zähigkeit die Fährte des Barons. Früher hatte er nie auf sein Aussehen geachtet, der spitze Hut und die Lodenjoppe, das waren seine einzigen Kennzeichen, – jetzt merkte er sich die Züge seines Opfers und schlich ihm nach, wo er konnte.
Vor einer Stunde hatte er ihn heute zum Notar hineingehen sehen. Im Flur hatte Stepan Nikolaitsch zwei volle Stunden gewartet mit glühenden Augen und zusammengepreßten Zähnen. Auf der Post holte der Baron seine Briefschaften ab und Stepan Nikolaitsch hörte, wie er seinem Kutscher befahl: „Fahre nur voraus ins Pastorat, ich habe noch einen Gang vor.“
Der Volksschullehrer sah die schlanke vornehme Gestalt des Mannes in der Apotheke verschwinden und schlug sofort die Richtung zum Pastorat ein.
[176] Der Weg war einsam und öde. Eine weite Fläche von beschneiten Feldern, hier und da ein verkrüppelter Weidenstumpf mit tausend verästelten Zweigen, – darüber ein grauer schwermütiger Himmel, von einem fernen blauen Tannenwald begrenzt. Leicht und schnell glitt der Schlitten über den taufeuchten Schnee. In der Ferne hob sich wetterfest und wuchtig der runde Schloßturm.
Beharrlich und ruhig schritt Stepan Nikolaitsch vorwärts. Auf dem halben Wege zum Pastorat kehrte er plötzlich um, wie auf höheren Befehl, und ging denselben Weg langsam zurück.
Da sab er auch schon die hohe vornehme Gestalt des Mannes, den er töten wollte. Schlank und sicher, einen Spazierstock in der Hand, den spitzen Hut schräg aufgesetzt, kam der Baron in ruhiger Gemächlichkeit ihm entgegen, jeder Zoll ein Aristokrat.
Mit sonderbarem und gierigem Interesse betrachtete ihn Stepan Nikolaitsch, wie er so leicht und elegant daherkam. Keine Spur von Haß regte sich in seiner Seele, nur der dumpfe unabänderliche Wille: Ich muß und ich werde ihn töten.
Jetzt waren die beiden Männer nur noch sechs Schritt von einander entfernt. Mit einem leisen Erstaunen hob der Baron die breiten schweren Augenlieder – er hatte den sonderbaren Gesellen erkannt, der ihn im Flur des Notars so seltsam angestarrt hatte.
Einen Augenblick sahen sich die Männer in die Augen. Blitzschnell fuhr Stepan Nikolaitsch in die Rocktasche, zielte, feuerte und traf.
[177] Die Kugel war durchs Herz gegangen. Mit hintenüber geworfenen Armen lag der Baron auf dem Rücken. Ein leises Zucken rann durch seine Glieder. Er war tot.
Die Joppe färbte sich langsam rot, und in breiten schweren Tropfen sickerte das Blut auf den weißen Schnee.
Stepan Nikolaitsch stand mit hängenden Armen vor seinem Opfer und betrachtete es lange. Der Revolver entglitt seiner Hand.
„Ein schöner Mann!“ sagte er endlich halblaut in traurigem Ton. „Arme Wally, vergib ...“
Dann riß er sich los von dem Toten und schritt langsam wie im schweren Traum in den Flecken zurück. Er war unsäglich müde.
In seiner Stube lag ein Brief. Er kannte die Schriftzüge. Mechanisch öffnete er das Kuvert und las:
- „Lieber Freund Stepan Nikolaitsch!
- Ich hatte es Ihnen schon vor einigen Tagen sagen sollen, – ich fand nicht den Mut dazu, denn es fällt mir nicht leicht, Ihnen einen Schmerz zu bereiten. Bitte vergeben Sie mir, Stepan Nikolaitsch. Als ich Ihnen sagte, daß ich Sie lieb hatte, da kannte ich mich selbst nicht. Jetzt erst weiß ich, was Liebe ist. O, vergeben Sie mir, wenn Sie können. Seit vier Tagen bin ich mit Herrn von Röhren, dem Hauslehrer des Barons, verlobt. Ihre Wally.“
Das Blatt entsank seiner Hand. Schwer fiel sein Kopf auf die Tischplatte. Ein Seufzer der Erleichterung kam tief aus der
[178] gepreßten Brust. „Also wars nicht Ehebruch!“ murmelte er. Dann fiel ihm mit einem schreckhaften Ruck der Tote ein, der da still und einsam auf der weißen verschneiten Straße lag – großer Gott, so hatte er den unrechten Mann getötet! ... Der da lag, war ja der Baron von Falkenfels und nicht der Hauslehrer, – – – und nun erinnerte er sich plötzlich klar, daß der, in dessen Armen Wally gelegen, ein anderer gewesen. Sie trugen beide dieselben spitzen Hüte. Hilflos streckte er beide Arme weit von sich auf den Tisch und lag regungslos.
Mit einem Mal lief ein Zittern durch die schmächtige Gestalt des kleinen Mannes – das Zittern wurde stärker und heftiger, der Stuhl, auf dem er saß, die Tischplatte zitterte und bebte... Und mit einer fremden heiseren Stimme sprach er laut: „Ich bin ein Mörder.“
„Ich bin ein Mörder!“ wiederholte er flüsternd. Ein Grauen vor sich selbst, ein Grauen vor dem rätselhaften Leben kroch eisig durch seine Glieder und schüttelte ihn. Der Bann in dem er seit vier Tagen gestanden, war von ihm abgefallen. Er war wieder er selbst.
Und nun stand er auf, hob sein totenblasses Gesicht und die Arme empor und stürzte in die Knie. „Mein Gott, mein Gott, vergieb!“ stöhnte er. Er wußte plötzlich, daß es einen Gott gibt.
Er beugte sich nieder, tief, tief, berührte mit der Stirn den Fußboden und küßte ihn.
„Ich bin nicht wert, daß die Erde mich trägt ...“ murmelte [179] er – „o Mutter, Schwester, Woldja, könnt Ihr mir vergeben?!“
Dann brach er in ein leises wehes Weinen aus.
Lange weinte er so still und schmerzhaft vor sich hin, seine Tränen flossen in Strömen und wuschen und badeten ihm die wunde kranke Seele rein.
Endlich stand er auf. Nein, noch war er nicht rein, er hatte noch etwas zu tun. „Kann man denn Tote erwecken?“ flüsterte er: „Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blut um Blut!“
Er wusch und trocknete sich das Gesicht. Dann ging er hinunter und klopfte bei Matriona Fadejewna an.
Freundlich öffnete die Frau und erschrak.
„Rufen Sie mir sofort Vater Nikiphor,“ sprach er mit einer wilden Bestimmtheit. „Ich muß ihn notwendig sprechen.“
Eilig lief Matriona Fadejewna die Treppe hinunter.
Nach wenigen Minuten kam der Pope. Er war bleich und seine Augen funkelten erwartungsvoll.
Hastig schloß er die Tür hinter sich.
Ruhig und groß sahen ihn die Augen des kleinen Mannes an.
„Vater Nikiphor,“ sagte er mit tonloser trauriger Stimme, – „weshalb hast Du mir das getan?“
Ein Ruck ging durch die mächtige Gestalt des Geistlichen.
„So hast Du ihn getroffen?“ brach er los.
„Der Baron liegt tot auf der Straße. Ich aber frage Dich noch einmal, – weshalb hast Du mir das getan?“
Der Geistliche hielt den vorwurfsvollen schmerzhaften Blick [180] nicht aus. Seine Augen glühten und flackerten und er senkte sie zu Boden.
„Die politischen Verhältnisse ...“ begann er rauh und stockte – „hm, erfordern den Tod der Tyrannen.“
Dann schluckte er und sah verwirrt zur Seite.
„Keine politischen Verhältnisse erfordern feigen Meuchelmord, noch können sie ihn jemals rechtfertigen,“ sprach der kleine Mann tonlos weiter. „Du aber bist ein Mörder, gleich mir, und bist nicht wert, das geistliche Gewand zu tragen.“
„So? Pfeift die unschuldsvolle Tugend aus diesem Loch?“ brauste Vater Nikiphor auf. „Du willst mich wohl angeben, Freundchen? Nein, so haben wir nicht gewettet!“
„Ich werde mich selbst angeben, selbstverständlich!“ sagte der kleine Volksschullehrer einfach. „Zuerst aber will ich Dir sagen: Du mit Deiner Kraft und Macht bist ein erbärmlicher, armer, sündiger Mensch und Du hast den Baron gehaßt und hast mich zum Mörder gemacht. Nein, widersprich mir nicht,“ fuhr er fort, – „es ist so und ich weiß es.“
Der Pope widersprach nicht. An allen Gliedern zitternd stand er da. Dann stürzte er sich mit einem Wutschrei auf den kleinen Mann, warf ihn zu Boden, schnürte ihm mit Handtüchern Hände und Füße zusammen, steckte ihm sein Taschentuch in den Mund, hob die leichte Last empor, als wäre sie ein Kind, und schleuderte sie krachend aufs Bett.
„Mit dem Angeben hat’s noch gute Weile, Brüderchen, [181] höhnte er. „Die Knochen im Leibe schlag ich Dir entzwei!“
Mit einem lauernden Blick sah er sich in der Stube um, riß den Schlüssel aus der Tür, verschloß sie sorgfältig von außen und polterte die Treppe hinunter.
Eine Stunde oder zwei lag der Gefesselte still und regungslos, die Augen mit gequältem Blick zur Decke gerichtet. Allmählich löste sich die Spannung in seinen Zügen, ein friedlicher Ausdruck trat darauf, müde senkten sich die geröteten Augenlider und wie ein Kind schlief Stepan Nikolaitsch, der Mörder unter fremdem Willen, leise und sanft ein. – –
Im Flecken war eine ungeheure Erregung ausgebrochen. Man hatte die Leiche des Barons gefunden. Für die Anarchisten war dieser Mord gleichsam das Signal zu offenem Ausbruch. Sie stürmten das Polizeigebäude, die Post und das Telegraphenamt unter der Leitung Vater Nikiphors und sie fesselten die Beamten. Sie durchschnitten die Telegraphendrähte, damit keine militärische Hilfe requiriert werden könne. Sie zogen in einzelnen Scharen mit wehender roter Fahne und revolutionäre Lieder singend durch den Flecken und versetzten die zitternde Bevölkerung in eine lähmende Panik.
Einen Nachmittag waren sie die Herren im Ort und Vater Nikiphor sah tatsächlich seinen wilden Traum erfüllt: er hatte die Macht, die seine zügellose Herrschsucht sich ersehnt und er war trunken in seinem Machtgefühl. Seine endlich erlangte Herrschaft machte ihn kurzsichtig und blind. Er schwelgte in Anordnungen [182] und Befehlen und übersah eine sehr naheliegende Gefahr: er hatte es versäumt die Telephonleitung vom Schloß nach der nahen Stadt Goldingen zu zerstören.
Herr von Röhren hatte um dringende militärische Hilfe telephonieren können, und am anderen Morgen rückten Dragoner in mehreren Abteilungen von verschiedenen Seiten in den Flecken. Um das Polizeigebäude tobte ein blutiger Straßenkampf, Flintenschüsse knatterten, Kommandorufe schallten durch die Dämmerung – die anarchistische Bande wurde gefangen genommen bis auf einen Mann und dieser Mann war Vater Nikiphor.
In der Verkleidung eines lettischen Bauern hielt sich der Pope regungslos unter der Flußbrücke verborgen. Als die Nacht hereinbrach, schlich er hinter der Schmiede über den Bergrücken. So entkam er. – Stepan Nikolaitsch war endlich aus einem langen traumlosen Schlaf der Erschöpfung erwacht. Verwirrt schlug er die Augen auf und versuchte vergebens die gefesselten Glieder zu rühren. Mit dumpfer angstvoller Deutlichkeit trat das Geschehene wieder vor sein Bewußtsein, und er verfiel in einen seltsamen halbwachen Traumzustand.
Er sah ein breites graues wogendes Meer, von lichten weißen Sandbänken eingefaßt, dem Ufer entlang einen Friedhof, eine endlose Reihe von Gräbern; und er vernahm einen schaurig klagenden Totengesang. Mönche mit bleichen hageren Gesichtern und wallenden schwarzen Kutten wandeln in düsteren Reihen hintereinander her und tragen flammende Kerzen, und über dem [183] Allem ein nordischer grauer Himmel. Kapelle reiht sich an Kapelle und der Friedhof streckt sich in unabsehbarer Weite längs der Meeresküste hin.
Nordisches karges Gesträuch, Wachholdergebüsch und ragende Kiefern mit leuchtend roten Stämmen beschatten kümmerlich die endlose Reihe von Gräbern. Gräber, Gräber überall. Kleine schmucklose Holzkreuze, schief und zerfallen, und darüber heult der Sturm mit lautem winselnden Klageton.
Und das näselnde Singen der Brüder vermählt sich mit dem Klagegesang des Sturmwindes und dröhnt darüber hinaus in schauerlichem Wechselgesang.
Armut, kümmerliche Armut ringsumher, – Kinder mit eingefallenen bleichen Wangen und fast alle von der furchtbaren Pockenkrankheit entstellt, krüppelhafte Bettler, schleichende Greise. Und alles eng, eng, wie zugeschnürt von der verständnislosen Frömmigkeit und Gleichgültigkeit gegen menschliches Elend.
Ein Mann wandelt den Friedhof entlang, ein Fremder. Er trägt seine eigenen Züge. Erstaunte fanatische Gesichter aus schwarzen Kutten begegnen ihm – fragende Blicke ... die dürre gelbe Hand, die sich zum Zeichen des Kreuzes erhoben hat, zuckt zurück. „Ein Fremdling ... ein Ungläubiger? Was suchst Du, Friedloser, in unserem Reich?“
Ein harter Blick aus glühenden Augen trifft den Mann und schuldbewußt und friedlos eilt er weiter. Arme Bettelkinder strecken ihre kleinen mageren Händchen nach einer Gabe aus. [184] „Zurück!“ donnert eine Stimme hinter dem Manne – „Er ist ein Friedloser – ein Mörder!“ – und verschüchtert ziehen sich die armen kleinen Hände zurück.
Ein Flüstern geht durch die Reihen ... „Ein Ungläubiger – ein Friedloser – ein Mörder“ ... wogt es lauter und lauter um ihn – „Ein Mörder!“ .... – – – – In kalten Schweiß gebadet, mit gurgelndem Stöhnen richtet sich Stepan Nikolaitsch auf und starrt wild um sich her. Das Schreckbild ist zerflossen wie ein grauer Nebel. – –
Knatternde Schüsse, jammerndes Wehgeschrei, herbe Kommandorufe gellen von der Straße her an sein Ohr. Hat denn die Hölle alle grausen Schreckgespenster losgelassen, um ihn zu foltern? Ach, bekennen können, seine Schuld, seine große Schuld bekennen dürfen – welch eine Himmelsgabe wäre das!
Aber er ist ja gefesselt – er kann sich ja nicht rühren – mit einem schmerzlichen Seufzer sinkt er zurück – und schließt die Augen. Wo ist sein Friede hin? Verzweifelt reißt er an den Fesseln, die seine Handgelenke umschnüren. Umsonst.
Da dröhnts im Flur – durcheinandergellende Stimmen, wirre Rufe. Hastige Schritte poltern die Treppe empor. An der Tür wird gerüttelt. Fußtritte, Kolbenschläge donnern dagegen – die Tür stürzt krachend ein. Blitzende Uniformen, gerötete Gesichter, rauchgeschwärzte Hände, zornige Rufe ....
„Noch einer“, schallts ihm entgegen – – „Nehmt ihn fest!“
Das Zimmer ist voller Soldaten.
[185] „Er ist ja schon gebunden und geknebelt, Euer Hochwohlgeboren!“
Ein Offizier tritt ans Bett und nimmt ihm den Knebel aus dem Munde. „Wer sind Sie?“ fragt er streng.
Dankbar blickt Stepan Nikolaitsch zu ihm auf. „Ich ... ich .. ich habe den Baron getötet!“
Es klingt wie ein Jubelruf.
Der Offizier weicht zurück. Noch nie hat er ein so strahlendes Antlitz gesehen.
„Um so schlimmer für Sie!“ sagt er betreten. „Wer sind Sie?“
„Volksschullehrer – Stepan Nikolaitsch Goruschkin.“
„Wissen Sie, wo der Pope Nikiphor ist? Leugnen Sie nicht!“
Der kleine Mann schüttelt den Kopf. „Er war gestern bei mir.“
„Wer hat Sie gefesselt?“
„Eben Vater Nikiphor.“
„Und warum?“
Stepan Nikolaitsch zögert einen Augenblick.
„Weil er mich zum Morde überredet hat,“ spricht er fest.
„Löst ihm die Bande von den Füßen und fort mit ihm,“ kommandiert der Offizier.
Schwankend steht Stepan Nikolaitsch auf den Füßen. Unter Eskorte wird er hinausgeführt.
[186] Der Friede ist wieder über ihn gekommen.
Eine tiefe Dankbarkeit, eine wehmütige Freude strahlt und leuchtet aus seinem Antlitz.
Der Zug geht an dem Hause des Veterinärarztes vorüber.
„Wally, Wally – so sehen Sie doch – auch er ein Anarchist!“ kreischt die entsetzte Stimme Frau Doktor Trellers, „Hab ich Sie nicht alle vor ihm gewarnt?“ klingt es darauf triumphierend.
Bleiche bekannte Gesichter beugen sich aus dem Fenster. Mit einem Wehlaut fährt Wally zurück.
Ein ruhiger friedlich-schmerzlicher Blick hat sie gestreift. Sie begreift noch immer nicht ...
„Weshalb ist er gefangen?“ ruft der Veterinärarzt keuchend.
„Er hat den Baron erschossen!“ schreit einer der Soldaten zum Fenster empor – – –.
Stepan Nikolaitsch ist im Gefängnis. Und morgen soll er sterben. Er schreibt einen Brief an seine Mutter. Seine Augen leuchten.
- „Trauere nicht, gute Mutter, – ich bin sündig, aber dein verlorener Sohn bin ich nicht. Ich stand unter fremdem Willen und der Friede Gottes ist über mir. Es küßt euch alle
- Euer Stepan.“
Am nächsten Morgen in aller Frühe bewegt sich eine Kompagnie Soldaten, mitten unter ihnen eine Reihe Gefangener, auf dem Marktplatz. Stepan Nikolaitsch erkennt den Vater
[187] Krischs, den Trunkenbold. Seine Augen suchen Vater Nikiphor. Er findet ihn nicht.
Der Marktplatz ist gedrängt voll Neugieriger.
„Zurück! Platz!“ schallen kurze Kommandorufe.
Die Gefangenen werden der Reihe nach aufgestellt. Totenstille.
Da kreischt eine jammernde Knabenstimme in die feierliche Stille hinein: „Tötet ihn nicht! Er war unser guter Lehrer ... Stepan Nikolaitsch ist unschuldig!“
Rohe Fäuste schlagen auf den Knaben ein. Krisch wehrt sich wie ein Verzweifelter. Stöhnend bricht er zusammen.
Das Kommando des Offiziers ertönt:
„Feuer!“
[190]
[191] Vor der niederen Hütte saß die kleine Darthe und schaukelte ihr jüngeres Brüderchen. Sie tat es widerwillig. „Halt’s Maul, Jahnit!“ sagte sie zornig und runzelte düster die Brauen. „Kannst du nicht schlafen, was?“ Sie gab dem Säugling einen heftigen Klaps, und als der nicht zu helfen schien, fuhr die kleine braune Hand unter die Wickeltücher und kniff ihn wütend ins Bein.
Klein Jahnit aber riß sein Mündchen in Schreck und Entsetzen weit auf, als sammle er Kraft zu einem berserkerähnlichen Schmerzgebrüll, – aber es kam kein Ton. Neugierig beugte sich Darthe über ihn und sah ihn aus weit aufgerissenen braunen Kinderaugen fragend an. „Nu, was wird nu sein?“ sagte sie halblaut. Und nun kam’s kreischend, empört, in gellenden verzweifelten Stößen, – das kleine Gesicht wurde blaurot, die Fäustchen fuhren geballt an den Kopf, und die Beine zuckten krampfhaft auf und nieder.
[192] „Jahnit, Jahnit, schrei nicht so!“ rief die kleine Darthe weinerlich und begann darauf mit schrillem Stimmchen ein lettisches Kinderlied zu singen.
„Drüben auf der Wiese
Geht ein weißer Storch –“
„Wai Gottchen, Gottchen!“ stöhnte die alte Großmutter, die gelähmt in der rauchgeschwärzten Stube auf dem Strohsack lag – „wai Gottchen, Gottchen! Ist das ein Kreuz mit den Kindern! Darthing, Darthing, so komm doch her, Kind, wenn die Großmutter ruft!“
„Ich komme ja schon, Großmutter!“ schrie das Kind mit trotzig aufgeworfener Oberlippe, dann packte sie das brüllende Bündel und schleppte es keuchend in die warme Stube. Unsanft legte sie es auf das Fußende des Bettes. Die Alte richtete sich stöhnend auf und betrachtete das Kleine. Unter den weißen Brauen sah sie drohend die kleine Missetäterin an. „Hast du ihm was getan, Darthe?“ fragte sie streng. „Antworte!“
Stumm stand das Kind da mit gesenkten Wimpern und steckte statt aller Antwort den Finger in den Mund.
„Du hast ihm was getan!“ ächzte die Großmutter. „Das ist eine große Sünde. Dich wird der Pfarrer holen, – der steckt dich in einen schwarzen Sack und trägt dich geradewegs in die Hölle. Da wirst du zeitlebens braten!“
Erschrocken sahen die Kinderaugen zu der Alten auf und blinzelten unsicher.
[193] „Ja, ja,“ murmelte die Alte, „du wirst schon sehen, was dir geschieht!“
Leise streichelnd fuhr die runzlige Hand über das schreiende Kind, und immer schwächer und sanfter wurde das Weinen, endlich verstummte es ganz. Die kleine Faust fuhr in das Mündchen und eifrig begann das Kind daran zu lutschen. Zwei schwere dicke Tränen lagen anklagend auf den runden Bäckchen. Darthe stand noch immer steif und stumm neben der Großmutter.
Die Alte zog jetzt andere Saiten auf.
„Liebst du denn den Jahnit gar nicht, Darthing?“ fragte sie. „Es ist doch dein gutes Brüderchen, so’n liebes schönes Kind. Sein Brüderchen muß man doch lieben.“
„Ne!“ sagte Darthe und schüttelte unwirsch den Kopf. Die dunklen ungekämmten Haare fielen über die bräunliche Stirn, und eine böse Falte legte sich drohend darüber.
„Der Jahnit schläft nicht und immer krieg’ ich Prügel. Ich will an den Fluß – spielen!“
„Ui – ja!“ sagte die Alte. „Spielen willst du am Fluß? Dazu bist du nun viel zu groß – was hast du denn am Fluß zu suchen? Lauf nicht immer an den Fluß, sonst läuft er einmal nach dir und holt dich, und dann bist du kalt und tot.“
Wieder schüttelte das kleine Ding den Kopf. „Der Fluß ist gut,“ sagte sie, „besser als – als alle. Und holen kann er mich gar nicht.“
[194] „Wart, wart ... sei nicht hochmütig, du dummes Kind, sonst geht’s dir wie dem Buttchen und du kriegst ein schiefes Maul.“
„Welchem Buttchen?“ fragte die Kleine – ihre schwarzen Augen funkelten gespannt.
„Das ist eine alte Geschichte,“ stöhnte die Großmutter, „eine alte schöne Geschichte. Als der liebe Herrgott die Welt erschaffen hatte und sich sein Werk besah, da ging er an dem großen Wasser spazieren und war recht von Herzen froh. Im Sande aber lag eine Butte und sonnte sich. ,Was tust du denn hier in der Sonne, liebes Buttchen?’ fragte der Herrgott so recht freundlich. Und die Butte, dies unverschämte Vieh – zieht ihr Maul schief, blinzelt zum Herrgott empor und wiederholt höhnisch: ,Was tust du denn hier, liebes Buttchen?’ Da wurde der Herrgott zornig und sprach: ,Du hast mich gehöhnt – darum sollst du von nun an dein schiefes Maul behalten und auf der einen Seite sollst du rauh und grantig bleiben’ – Und seitdem hat die Butte ein schiefes Maul – und rauh ist sie auch, aber nur auf der einen Seite, auf der sie im Sande lag. Ja, ja – so geht’s, wenn man hochmütig ist!
Und das ist die Wahrheit – hast du nicht gesehen, wie rauh die Butten auf der einen Seite sind?“
Die kleine Darthe seufzte tief auf. „Ja!“ sprach sie überzeugt. „Erzähl noch was, Großmutter!“
„Hast du den Jahnit geschlagen? Antworte zuerst, Mädchen,- hernach erzähl’ ich dir eine viel schönere Geschichte – vom [195] Regenvogel. Sieh doch, nun schläft das Brüderchen, – wie’n Engel im Himmel sieht er aus. Hast du ihn geschlagen? Wenn du deine Sünde nicht gestehst, erzähl’ ich dir mein Lebtag nichts mehr.“
Die runden Kinderaugen hingen sehnsüchtig an den Lippen der Großmutter. Ein heftiger Kampf malte sich in dem trotzigen kleinen Gesicht. „Wirst’s nich Mutter sagen?“ fragte die Kleine vorsichtig.
„Ne, ne, – diesmal nich, ... gesteh’ nur.“
„Gekniffen!“ stieß Darthe kurz hervor.
„Ach, du Höllenbraten, du siebenjähriger!“ ereiferte sich die Alte. „Ist das ein Kreuz mit den unvernünftigen Kindern, ist das ein Kreuz! Wai Gottchen, Gottchen erbarm dich doch über uns! Und ich muß hier hilflos auf dem Strohsack liegen, kann kein Glied rühren und dir nicht mal eine ordentliche Birkenrute schneiden! Peitsche hast du verdient, nicht bloß Ruten! – Wirst’s wieder tun, sag’, du kleines Ungetüm, wirst’s wieder tun – wie?“
Darthe knitterte nachdenklich ihre Schürze zusammen. „Ne!“ murmelte sie, „aber nu erzähl’ auch, Großmutter – vom Regenvogel!“
Die Alte seufzte, blickte zur verräucherten Decke und begann: „Es war einmal eine Zeit, da gab’s kein Wasser auf der Erde, keinen Fluß, keinen Bach und keinen See. Nur ein dunkles weites Wasser, rings um die Erde herum, und das war bitter und salzig – und man nannte es das Meer. Aber süßes [196] Flußwasser gab es nirgends. Da rief der liebe Herrgott alle Tiere der Erde zusammen, die Wölfe und Bären und Hunde, die Katzen und Ratten und Mäuse, die Pferde und Kühe und Kälber und alle Schafe und Ziegen und Lämmer, – und alle Vögel rief er zusammen, die Hühner und Gänse und die Vögel, die im Walde fliegen, und befahl ihnen tiefe Straßen zu graben, ein jedes nach seinen Kräften, damit sich das Regenwasser darin sammle. Und alle Tiere kamen herbei und gruben emsig, die großen vierfüßigen Tiere mit ihren Tatzen und Klauen, die Vögel mit ihren Krallen und Schnäbeln, und nur einer von ihnen, der Regenvogel, der drückte sich beiseite und half nicht mit bei der Arbeit. Und so waren die Flüsse und Bäche entstanden, und der liebe Herrgott lobte alle Tiere und war mit ihnen zufrieden. Da er aber alles weiß und alles sieht, so wußte er auch, daß der Regenvogel nicht mit bei der Arbeit gewesen war, und er rief ihn und sagte: ,Regenvogel, warum hast du nicht mitgeholfen?’
,Ich wollte nicht’ sagte der Regenvogel trotzig.
,So?’ sagte der Herrgott und schüttelte den Kopf, ,du wolltest nicht? Nun sollst du aber zur Strafe nimmer Wasser aus dem Fluß trinken, wie die anderen Tiere, sondern nur Regenwasser. Von den nassen Gräsern und Blättern sollst du die Regentropfen auffangen mit deinem Schnabel, und darum sollst du immer Sehnsucht nach Regen haben und ihn voraus verkünden, ehe er kommt!’ Seitdem – sieh mal – schreit der [197] Regenvogel immer ängstlich und klagend vor dem Regen und läuft hin und her im Grase und hat keine Rast noch Ruhe.
Ja, siehst du, so geht’s, wenn man trotzig ist, und nun spring schnell an den Fluß, Darthing, und spiel ein wenig, aber ja nicht zu lange, hörst du wohl, und reich mir die Milchflasche für den Jahnit her, damit ich sie ihm geben kann, wenn er aufwacht.“
Die Kleine ließ sich das nicht zweimal sagen und war wie der Blitz zur Tür hinaus. Mit einem schrillen Schrei des Entzückens lief sie durch den kärglichen Gemüsegarten, breitete die Arme aus und hob und senkte sie wie ein Vogel seine Flügel. Geschmeidig wie ein Kätzchen wand sie sich durch die Zaunlücke und stand jetzt vor dem grünen Abhange, der schräg zum Flusse führte. Nun warf sie sich jauchzend ins Gras und rollte wie eine reife Frucht geradeswegs zum Fluß hinunter. Die braunen Füße stemmten sich fest gegen den Boden, die kleinen Hände griffen hastig ringsum nach einem Halt und krampften sich an Grasbüscheln und Wacholdersträuchen fest; mit weit offenen verwunderten Augen fand sie sich auf dem feuchten Ufer sitzen und lachte laut und fröhlich.
Sie sah in den blinkenden Fluß hinein. Mit leisem murmelndem Rauschen strömte er unablässig und ruhig zwischen den grünen Wiesen dahin. Sehnsüchtig bog sich grüngraues Weidengefieder zu ihm hinab, und seine kleinen Wellen umhüpften [198] schmeichelnd die schwanken Zweige. Weit in der Ferne blaute ein dunkler Tannenwald, und ein lichtblauer nordischer Frühlingshimmel, von leichten schwimmenden Wölkchen bedeckt, spannte sich über das grünende Gelände.
Klein-Darthe streckte die Füße ins Wasser und sah vergnügt zu, wie es über sie hinströmte. Immer tiefer rutschte sie hinab – jetzt steckten schon die Beine weit über die Knie in der kalten strömenden Flut. Ein wonniges Behagen durchrieselte sie. Ja, der Fluß war doch gut, und holen konnte er sie gar nicht – dachte sie. Also hatte die Großmutter die Unwahrheit gesprochen. Gut, daß die sie hier nicht sitzen sah, die Beine im Wasser, dann gäbe es wieder Schelte und vielleicht gar Schläge! Noch einige Minuten genoß sie das verbotene Vergnügen, dann kroch ein Kältegefühl durch ihren Körper, und schnell zog sie die Fuße zurück.
Sie knetete den Uferschlamm zu Kugeln zusammen und warf sie jauchzend in den Strom hinein. Wie das klatschte und aufschlug und dann wirbelnd versank! Nun sprang sie auf und begann eifrig nach Holzspänen zu suchen. So, nun hatte sie die ganze Schürze voll. Hui, wie die dahingetragen wurden vom flutenden Strom, schnell, so schnell, ... wohin eigentlich? Fest halten hätte sie sie mögen oder mit ihnen schwimmen in die Weite – ja, wohin schwammen sie denn nur? fragte sie sich nachdenklich. Richtig, der Fluß ging ja nach Bauske, und Bauske war eine Stadt, und Klein-Darthe hatte noch nie eine Stadt gesehen. Aber da war es gewiß herrlich, – da gab es einen [199] Marktplatz und einen großen Kirchhof und viele Buden. Neulich hatte die Mutter den neuen Sonntagsstaat aus Bauske geholt – dunkelblauen Kattun und ein süßes Pfefferkuchenherz für Darthe. Sehnsüchtig blickte die Kleine den treibenden Holzspänen nach. Ob sie so schnell laufen konnte? O und wie! Eilig begann sie am Uferrande mit den nackten braunen Füßchen zu laufen, – ach der dumme Weidenbusch stand ihr im Wege, hastig umkreiste sie ihn und blieb atemlos am Ufer stehen. Sie sah ihren Holzspahn nicht mehr. War er untergegangen? War er weiter fortgeschwommen? Sie hatte ihn verloren. Rasch entschlossen warf sie einen größeren trockenen Ast ins Wasser, nein, den würde sie nicht aus den Augen lassen, und geschäftig lief sie vorwärts, dem Flußufer entlang, – da blieb sie wie angewurzelt stehen.
Sie hörte Stimmen, und hinter dem Ufergestrüpp tauchten zwei herrschaftlich gekleidete Knaben in Matrosenanzügen auf, neben ihnen ein Häuslerssohn, der Grendsche-Jehkab. Alle mochten sie zwölf Jahre zählen. Sie kannte die drei. Der eine breitschultrige blonde Junge mit dem gutmütigen Gesicht, das war Pastors Willi, der andere mit den glänzenden Schnürstiefeln und der schlanken hochaufgeschossenen Gestalt war das Jungherrchen, der kleine Baron. Der dritte aber, der Grendsche-Jehkab war eigentlich der hübscheste von allen. Er war barfuß und trug eine junge Dohle im Arm.
„Schenk mir die Dohle, Willy!“ hörte sie das Jungherrchen sagen.
[200] „Nein, ich will sie selbst behalten Wolf.“
„Du!“ sagte Wolf und maß seinen Kameraden von oben bis unten, „das ist ruppig von dir. Ich bin doch dein Gast, und gegen Gäste muß man liebenswürdig sein.“
Der kleine Pastorssohn besann sich eine Weile. „Höre,“ sagte er zögernd, „wir machen alle drei zuvor einen Wettlauf. Wer am schnellsten laufen kann, der bekommt die Dohle. Du, Jehkab, stell die Dohle hin, wir wollen alle laufen.“
„Aber da fliegt sie doch fort, Jungherrchen!“ sagte der hübsche Jehkab und lachte, daß seine Zähne blitzten. Suchend blickte er um sich. „Wir können ihr ja die Flügel binden. Nein warten Sie!“ Er sprang auf die kleine Darthe los. „Du bist Semmits Meiting[1] – nicht? Wart, halt mal die Dohle – und paß auf, daß sie nicht davonfliegt. Wir wollen alle laufen!“
Zögernd nahm Darthe den großen schwarzen Vogel in Empfang und preßte ihn fest an sich. Ihre Augen leuchteten vor Vergnügen, und sie nickte eifrig zwei-, dreimal.
„Halt ihn ja fest, Kleine!“ rief der kleine Baron. „Und jetzt – stellen wir uns auf – dort bis zum großen Weidenbusch laufen wir. Eins, zwei, drei!“
Die Knaben standen vorgebeugt in erwartungsvoller Haltung, den rechten Fuß vorgestreckt, die Augen aufs Ziel gerichtet.
„Los!“ schrie der kleine Baron.
Pfeilschnell ging es über die grüne Wiese dahin. Der kleine [201] Baron war den anderen um einen Fuß voraus, doch jetzt, jetzt überholte ihn der barfüßige Grendsche-Jehkab. Keuchend war Willy hinter den beiden zurückgeblieben. Noch einen neuen Schwung gab sich das Herrensöhnchen – gleichzeitig, zitternd vor Eifer und Leidenschaft prallten der kleine Jungherr und der Häuslersohn gegen das Ziel.
„Ich war zuerst da?“ schrie Wolf, und seine Augen blitzten.
„Nein, ich!“ rief Grendsche-Jehkab. „Willy Jungherr, – wer hat nu recht?“
Keuchend war Willy langsam herangekommen.
„Ich weiß nicht, – ich glaube, beide.“
Die Sieger maßen einander mit flammenden Blicken.
Atemlos war Darthe dem Vorgange gefolgt.
„Der Grendsche-Jehkab hat recht,“ sagte sie laut, „und er muß die Dohle bekommen.“
Aber niemand hörte ihre Worte.
„Ich geb dir zehn Kopeken, Jehkab,“ sagte Wolf, „die Dohle muß ich haben.“
„Aber ich war doch der erste!“ sagte Jehkab trotzig.
„Gib ihm dreißig Kopeken, Wolf!“ schlug der Pastorssohn vermittelnd vor.
Die kleine Darthe hatte die Beratung nicht gehört, sie stand zu weit ab. „Und Grendsche-Jehkab hat doch recht,“ murmelte sie. Ein trotziger Entschluß malte sich in ihrem Gesicht: sie hob die Hände hoch und warf den Vogel in die Luft. Verwundert [202] breitete er die Flügel aus und flatterte auf eine kleine Tanne. Dann, als sei das Selbstgefühl in ihm erwacht, reckte er seinen Kopf, stieß ein heiseres Krächzen aus und flog mit starken ruhigen Flügelschlägen über den Fluß. Er war seinen Peinigern entkommen.
„Die Dohle, die Dohle!“ tönte es zornig und klagend aus drei Kehlen.
„Weshalb hast du sie fliegen lassen?“ fragte der kleine Baron wütend. „Das kommt davon, wenn man sich mit Mädchen einläßt!“
Stumm, mit niedergeschlagenen Augen und fest zusammen gepreßten Lippen stand Darthe und knitterte an ihrer Schürze.
„Haue sollst du kriegen!“ rief Grendsche-Jehkab und rüttelte sie derb.
„Komm, Jehkab, laß! Mädchen haut man nicht!“ entschied der Pastorssohn großmütig.
„Du hast sie mit Absicht fliegen lassen – pfui, wie gemein!“ sprach der kleine Baron im Tone tiefster Verachtung.
Grendsche-Jehkab stand blaß vor Wut beiseite und rührte sich nicht.
Willy fuhr in die Hosentasche und brachte ein Zehnkopekenstück hervor. „Da nimm, Jehkab,“ sagte er großartig, „für die Enttäuschung. Du läufst sehr brav.“
Nun wollte auch das Jungherrchen in der Großmut nicht zurückstehen. Aus einem zierlichen ledernen Portemonnaie zog er einen Zwanziger und reichte ihn Jehkab.
[203] „Da?“ sprach er.
Darthe machte große Augen. So war bei der allgemeinen Enttäuschung doch Grendsche-Jehkab der einzige gewesen, der Vorteil davon gehabt hatte. Verwirrt drehte sie sich um und schlich mit gesenktem Haupt nach Hause.
Die Dohle aber hüpfte auf dem jenseitigen Ufer vergnüglich von Strauch zu Strauch und ließ ein verwundertes lautes Krächzen hören.
Jahr um Jahr strömte der Fluß unablässig und ruhig dahin. Im Frühjahr wurden seine Fluten stürmischer und dunkler, so als beseele ihn ein junger starker Wille. Im Winter aber erstarrten sie ganz, und eine schwere harte Eisdecke hielt den vorwärtsstrebenden Gesellen monatelang gefangen, bis er im Märzmonat unter donnerdem Krachen und Tosen den Eispanzer sprengte, großmächtige Blöcke übereinander schleuderte wie ein zorniger Riese und, als wolle er sich für die lange Gefangenschaft schadlos halten, die Eisschollen durcheinander wirbelte und jagte, bis sie verängstigt und immer kleiner werdend dahin schwammen auf Nimmerwiederkehr.
In dieser Zeit liebte Darthe den Fluß am meisten. Sie hatte ordentlich Respekt vor ihm und sah den Eisschollen mit triumphierender Freude nach. Ja, ihr Fluß, der konnte schon was Rechtes, der war stark und mächtig, viel mächtiger als der [204] Baron, der Pastor und der Zehsewirt zusammengenommen. Bei dem arbeiteten ihre Eltern um Tagelohn.
Darthe war nun ein schönes kräftiges Mädchen und stand im dreizehnten Jahre. Nicht mehr wie einst lief sie ungekämmt einher. In zwei dicken schweren Flechten trug sie das dunkle Haar wie eine Krone über dem Haupt. Trotzig und horchend blickten die braunen Augen unter der bräunlichen Stirn hervor, – sie schienen immer etwas zu suchen, nach innen hinein. Und sie suchten auch etwas, ohne daß sie es wußten. Die alte Großmutter, eine lebensmüde Welle, war vom Zeitenstrom dahingeflutet, und Darthe hatte nun niemanden mehr, der ihr Geschichten erzählen konnte, der sie schalt und dennoch lieb hatte. Ihr Tod hatte im Hause der Knechtsleute eine trübe Leere hinterlassen, und Darthe schien es oft in dunklen Herbstnächten, als höre sie die Stimme der Großmutter rufen. Jetzt brauchte sie nicht mehr widerstrebend ein Kleines zu warten, denn Jahnit war nun schon fünf Jahre alt und folgte ihr auf den eigenen stämmigen Beinchen wie ein Schoßhund, und jüngere Geschwister waren nicht gekommen. Jahnit war aber auch der ganze Stolz der Knechtsleute; um Darthe kümmerte sich die eigene Mutter nicht sonderlich. Sie war ja nur ein Mädchen. So war der Fluß erst recht ihr liebster Gefährte geworden. Immer und immer flüchtete sie zu ihm hin. Bald saß sie mit sinnenden Augen, starrte in die strömende Flut und ließ das kühle Wasser durch ihre Finger rinnen, bald kauerte sie mit gebeugtem [205] Rücken am Wasser und wusch Jahnits Kleider und ihre eigenen oder spülte Geschirre. Sie hatte ein ganz persönliches Verhältnis zu ihm. In ihren kindlichen Gedanken sagte sie ihm du, und zugleich mit einer achtungsvollen Wertschätzung regte sich ein übermütiges Selbstbewußtsein in ihr. Dann drohte sie dem blinkenden Wasser mit der Faust und sagte triumphierend:[WS 11] „Sieh mal, du bist stark und groß, aber holen kannst du mich doch nicht!“
Es war ein leuchtender Sommertag. Festliche Sonnenstrahlen ruhten über Feldern und Wiesen und glitzerten übermutig in dem rauschenden Fluß. Weiße glänzende Wasserrosen mit ihren dunkelgrünen Blättern schwankten leise in der goldig funkelnden Flut. Die kleine Darthe trat aus der schiefgedrückten elterlichen Hütte und spazierte sittig den Abhang hinunter. Die neuen ledernen Schuhe drückten sie und zwangen sie zum ruhigen Vorwärtsschreiten, und dennoch zog sie sie nicht aus. Es war ja Sonntag, – da konnte man ein übriges leiden. Sie strich sich ihre neue rote Schürze glatt und sah voll Stolz auf ihre beschuhten Füße, wie sie vernünftig und altklug einhertrabten, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln geschluckt. Ja, neue Schuhe tragen, das konnte nicht jede – was tat es da, wenn sie unbequem waren und kniffen wie ein böses Gewissen? Vorsichtig hob sie ihren blauen Sonntagsrock auf, breitete den Unterrock gemächlich aus und setzte sich auf den feuchten Ufersand. Nun saß sie da, steif und tugendhaft, und seufzte.
[206] Sie streckte die Füße aus und versuchte die gefangenen Zehen zu bewegen. Aber neue derbe Bauernschuhe sind stärker als menschlicher Wille, die Zehen konnten sich nicht rühren, Darthe seufzte wieder, und auf ihrem hübschen braunen Gesichtchen malte sich ein bitterliches Entsagen. Die braunen Hände hielt sie nachdenklich über dem Leib gefaltet. Wehmütig und würdevoll ließ sie sich von der lieben Sonntagssonne bescheinen. „Ach, wenn es doch schon Montag wäre!“ seufzte sie laut. Und plötzlich, einem tapferen Entschluß folgend, beugte sie sich nieder und löste die Schuhbänder. Rechts und links flogen die ledernen Quälgeister ins grüne Gras, rechts und links die groben Strümpfe – die alte fröhliche Darthe stand mit nackten Füßen im Uferschlamm und ließ sich das laue Wasser um die gequälten Zehen plätschern. Nun rauschte der Fluß lauter, die Sonne schien goldiger, die Vögel sangen heller, und Darthes Augen blitzten in Kinderwonne und Übermut.
Sie beugte den Kopf und lauschte – hörte sie nicht Stimmen?
Ja – dort hinter der Flußkrümmung tauchte ein weißes Boot hervor. Leise glitt es mit der Strömung dahin, erfüllt von fröhlichem Gelächter.
Ein schönes Fräulein im weißen Sommerkleide stand lachend im schwanken Gefährt und breitete die Arme aus. Am Steuer stand Willy, der Pastorssohn, er war breit und stämmig geworden. Der junge Baron Wolf und Grendsche-Jehkab, beide hochaufgeschossene [207] schlanke Gesellen, hielten die Ruder lässig in den Händen und sahen gespannt zu dem schönen Mädchen hin.
„Wo kommt denn die her?“ murmelte Darthe, und ihre Augen wurden groß und rund vor Staunen. Da fiel ihr ein, daß der Pastor Konfirmationslehre hielt. Das schöne Fräulein sollte also auch konfirmiert werden.
„Fräulein Marga, vorsichtig!“ rief warnend der Jungherr Wolf.
Übermütig sah ihn das junge Fräulein über die Schulter an.
„Die schönen Wasserrosen!“ rief sie. „Rudern Sie dorthin! Die Wasserrosen muß ich durchaus haben!“
Sie machte eine herrische Gebärde. Wie schön sie war mit ihrem rotgoldenen Lockenhaar, wie süß klang ihre weiche Mädchenstimme!
Gehorsam lenkte Willy den Kahn, eifrig schwangen die andern die Ruder. Sie waren in das schwankende Netz der Wasserrosen geglitten.
„Vorsicht, Fräulein Marga!“ rief nun auch Willy. „Das Wasser ist sehr tief.“
Aber Fräulein Marga lachte nur. Umflossen von goldenem Sonnenlicht stand die weiße leuchtende Gestalt und beugte sich weit vor.
„Achtung, geben Sie mir die Hand!“ rief Wolf gebieterisch. Er war aufgesprungen. Grendsche-Jehkab suchte mir seinem Ruder die schönsten Blüten heranzulangen. Marga kniete im [208] Boot und griff begierig nach den Blumen – das Boot geriet in ein bedenkliches Schwanken – die weiße Gestalt verlor das Gleichgewicht, stürzte lautlos über den Bootrand und versank.
Ein Schreckensruf aus vier Kehlen – am lautesten schrie Darthe – schon sprang Wolf ins Wasser. Willy zog hastig seine Jacke aus und stand zum Sprunge bereit. Grendsche-Jehkab saß bleich und vorgebeugt – seine Augen bohrten sich suchend in die spiegelnde Wasserfläche.
„Ruhig, Willy Jungherr, – nicht springen!“ rief er. „Da, da ist sie!“
Er tat ein paar Ruderschläge und steckte das Ruder steif ins Wasser.
„Festhalten!“ rief er überlaut.
Ein paar weiße Arme griffen nach dem rettenden Ruder, ein todblasses, weißes Gesicht, von triefendem rötlichem Haar umflossen, tauchte auf.
„Die Ranken halten mich fest!“ keuchte sie tonlos.
Wolf tauchte auf wie eine Ente, schwamm an Marga heran und riß mit seinen jungen, sehnigen Armen die gierigen Ranken von der zarten Gestalt. Seine Augen funkelten.
„Fertig!“ rief er. „Nun zieht!“
Jehkab und Willy griffen zu und hoben und zerrten das junge Mädchen ins Boot.
„Schnell ans Ufer!“ kommandierte Wolf. „Kümmert euch nicht um mich, ich kann schwimmen.“
[209] Wie ein Pudel schwamm der junge Baron hinter dem Boot her.
Marga saß still und blaß. „Ich hatte schon Wasser in Mund und Nase,“ sagte sie, „es fehlte nicht viel, und ich wäre ...“ Sie schauderte. „Jehkab,“ sie reichte ihm die feine schmale Hand. „Du hast mich gerettet – ich danke dir.“
Über Jehkabs hübsche Züge glitt ein dunkles Rot, und auch Willy überlief es heiß.
„Und Wolf?“ fragte er vorwurfsvoll – „er sprang sofort hinein, und ich wollte ebenfalls ...“
Da flog ein neckisches Leuchten über das blasse Gesicht.
„Jeder meiner drei Kavaliere tat, was er konnte,“ sagte sie, „ich bin allen dreien vielen Dank schuldig.“
Sie schauerte zusammen.
„Ihnen ist kalt, Fräulein Marga,“ sagte Willy eifrig, „wir wollen gleich in die Semmitsche Hütte, vielleicht können Sie dort heiße Milch bekommen. Jehkab soll ins Pastorat laufen nach Kleidern, hörst du, Jehkab, oder nein, ich gehe selbst, Mutter wird mir das rechte schon geben. Und du Semmits Darthe – was stehst du da und schaust in die blaue Luft? Habt ihr Milch im Hause?“
„Ja–a!“ rief Darthe bestürzt.
„So lauf schnell und stell sie auf zum Kochen, und die Mutter soll frische Wäsche hergeben für das gnädige Fräulein. Mach schnell – wir kommen gleich nach.“
„Ja–a!“ rief Darthe wieder. Und dann lief sie die Böschung [210] hinauf, so schnell sie die nackten Füße trugen. Ihre rote Schürze flatterte im Winde. Vergessen und voneinander getrennt lagen die Sonntagsschuhe und Strümpfe im Grase.
Die Milch stand auf dem Herd und Darthe daneben, da wurde es in der rauchigen dunklen Stube hell: Fräulein Marga war hereingetreten, und Wolf warf vor ihr die Tür auf, als sei sie eine Königin. Das nasse Gewand klebte an ihr, vorsichtig raffte sie das Kleid zusammen. Auch der hübsche Bursche war pudelnaß, und wo er ging und stand, da bildeten sich kleine Lachen.
Er schleppte einen Dreifuß herbei. „Setzen Sie sich, Fräulein Marga, – wo ist denn Mutter Greetsche?“
Mutter Greetsche, eine stämmige Frau, kam aus der Kammer und schlug die Hände überm Kopf zusammen.
„Wai Gottchen, – was für’n Unglück, was für’n Unglück!“ jammerte sie.
Sie küßte Marga die Hand und Wolf den nassen Ärmel.
Er lachte „Nu Mutter Greetsche, noch ist ja nichts entzwei.“
„Gott sei Dank! Gott sei Dank!“ sagte die Frau. „Wär’ ja auch jammerschade um so’n schönes Fräuleinchen! Das muß noch lange leben und ’nen jungen Baron glücklich machen.“
Wolf und Marga wurden trotz ihrer Nässe dunkelrot.
„Nu Jehkab, – was stehst du da unnütz herum, du Taugenichts?“ fuhr die Frau fort. „Kannst du nicht dem gnädigen Fräuleinchen die Stiefelchen ausziehen – wie? Die Füßchen sind ja klitschnaß.“
[211] Schon lag Jehkab auf dem Boden und griff nach Margas Fußen. „Wart, laß mich!“ rief der junge Baron und drängte ihn fort. Zornig trat Jehkab zurück.
Ein sprühender Blick aus Darthes dunklen Augen schoß zu den beiden jungen Leuten hinüber. Unwillkürlich ballte sie die Fäuste. Sie fühlte es: sie haßte sie alle beide – weshalb machten sie auch so viel Aufhebens von dem Fräulein?
Wolf hatte inzwischen die Stiefeletten aufgeknöpft und stellte sie vorsichtig nebeneinander auf die Ofenbank.
„Mutter Greetsche,“ sagte er darauf leise, „könnt ihr dem gnädigen Fräulein etwas von Eurer Wäsche borgen?“
„Ui ja!“ rief die Frau verwundert. „So’n grobes Bauernhemd paßt ja nicht für die gnädige Baroneß. Würde ihr ja das weiße Körperchen wund scheuern!“
Wieder wurden Marga und Wolf von dunkler Röte übergossen. Trotzig stand Jehkab in der Ecke, die Hände in den Hosentaschen.
Verlegen lachte Marga. „Wenn Ihr mir wenigstens ein trockenes Laken geben könntet, Mutter Greetsche,“ sagte sie bittend, „und eine warme Decke für den jungen Baron. Er ist ja ebenso naß wie ich!“
„Um mich sorgen Sie sich nur ja nicht, Fräulein Marga!“ rief Wolf. „Ich fühle mich pudelwohl.“
Geschäftig ging die Frau in die Nebenkammer.
[212] „Wolf,“ begann Fräulein Marga leise und schlug ihre schönen Augen auf, „geben Sie mir die Hand, ich habe Ihnen ja noch gar nicht gedankt!“
„Aber, Fräulein Marga, das war doch selbstverständlich, ich bitte Sie,“ sagte er unwirsch, aber die kleine Hand hielt er noch einen Augenblick fest in der seinen und drückte sie krampfhaft.
„Geh hinaus, Jehkab, und sieh zu, ob der Jungherr Willy mit den trockenen Kleidern kommt,“ befahl er kurz.
Jehkab trollte sich zur Tür hinaus.
Eine verlegene Pause.
Mit strahlendem Gesicht kam Mutter Greetsche zurück, eine Decke und ein weißes Linnen über dem Arm.
„Ein Betttuch fand ich nicht, das wäre auch gar zu grob, aber hier,“ triumphierend wies sie auf das Leinen, „ein schönes Tischtüchlein bringe ich, das hat mir noch die gnädige Frau Pastorin zur Hochzeit geschenkt. Das ist fein und weich. Da hinein können wir das gnädige Fräulein packen.“
Eifrig begann sie Fräulein Margas Kleid aufzuhaken. „Hier nicht, hier nicht, Mutter Greetsche!“ rief Marga entsetzt und wehrte ihr.
Wie ein Pfeil schoß Wolf zur Tür hinaus.
„Was für’n braver, schöner Jungherr!“ lobte Mutter Greetsche und löste gelassen Bänder und Schnüre, „das wär so’n richtiger Baron fürs gnädige Fräuleinchen, – und wie lieb er’s gnädige Fräuleinchen hat! Nicht mal zulassen wollt’ er, daß [213] Jehkab dem gnädigen Fräuleinchen die Stiefelchen auszieht. Ja, ja ... gnädiges Fräuleinchen werden in ein paar Jährchen schon gnädige Frau Baronin sein! Denken Sie an Mutter Greetsches Worte!“
Wie eine erglühte Rose stand Marga da. Darthe betrachtete sie mit neugierigen Blicken. Hastig streifte das Fräulein die Unterkleider ab.
Mutter Greetsche war im Fahrwasser. „Und das schöne Gut, das der junge Baron bekommt – so ein Gut, ja, das lohnt sich! ’n prachtvolles Schloß – vierzig Zimmer soll es haben – so sagte mir die Madde, die dort gedient hat.“
„Hört auf, Mutter Greetsche!“ rief Fräulein Marga heftig, „und kehrt Euch zur Wand, – ich will nichts davon hören.“
Zitternd und bebend stand sie da in das Tischtuch gehüllt und trocknete sich die rotgoldenen Haare. Schon kräuselten sich die einzelnen Härchen und standen leuchtend um das schmale weiße Gesicht.
Sie ist sehr hübsch, dachte Darthe bewundernd. Noch nie hatte sie etwas so Schönes gesehen. Warum aber war das schöne Fräulein so zornig?
„Die Milch kocht, Mutter,“ sagte sie verdrossen. Mit zischendem Laut sprudelte die heiße Milch auf den Herd über.
„Ach du Nichtsnutz!“ eiferte Mutter Greetsche, „kannst du nicht besser aufpassen? Such doch wo ein Taßchen oder ein [214] Glaschen zu finden, aber spül es zuvor ordentlich rein, und daß du mir den Jahnit nicht weckst, er schläft, hörst du?!“
Pferdegetrappel vor der Tür. Ein diskretes Klopfen.
„Fräulein Marga!“ ertönte Willys Stimme, „die Kleider sind da!“
Marga flüchtete hinter die Tür. „Danke!“ rief sie und öffnete einen Spalt. „Werfen Sie sie nur herein. War Frau Pastor sehr böse?“
„Nur erschreckt,“ rief Willy wieder, „und hier,“ er schob das Kleiderbündel in den Türspalt und reichte eine Flasche Madeira hinein, „davon sollen Sie gleich sechs Schluck nehmen, sagt Mutter. Bitte tun Sie’s, Fräulein Marga!“
Sie nahm die Flasche. „Warten Sie,“ rief sie, „gleich!“ Gehorsam trank sie sechs Schluck. „Nun aber – lassen Sie Wolf auch trinken. Ich bin in fünf Minuten angekleidet.“
Eilig öffnete sie das Kleiderbündel und schlüpfte in die trockene Wäsche. Obenauf lag ein dunkelblaues Wollenkleid.
Bewundernd stand Mutter Greetsche dabei.
„Nein, nein die schönen Spitzchen!“ rief sie. „Und das feine Gewebe, und nu erst das prächtige Kleidchen!“
Jetzt kam Darthe mit einer Riesentasse herein. Mutter Greetsche goß die Milch in die Tasse und reichte sie dem Fräulein.
„Sie ist noch zu heiß,“ sagte Marga, „vielen Dank, Mutter Greetsche. Und nun hab ich noch eine Bitte: die nassen Kleider [215] da sollt Ihr behalten für Euer Darthing. Wenn sie einmal konfirmiert wird, hat sie ein weißes Kleid.“
„Ach wai! Ach wai!“ sagte Mutter Greetsche strahlend. „Das ist ja alles viel zu prächtig für’n Bauernmädel. Darthe, Kind, hörst du, das gnädige Fräulein Baroneß, was nächstens Frau Baronin wird, schenkt dir die Kleider alle. Bedank dich doch, Mädchen!“
Verschämt trat Darthe näher und küßte dem Fräulein die Hand. Zugleich aber stieg ein sonderbarer Trotz in ihr auf. Das Fräulein war schön und gut, gewiß – – und sie gönnte ihr auch alles Gute, aber, daß der Wolf Jungherr und der Grendsche-Jehkab sie so gern hatten, – das, – ja, das gönnte sie ihr doch nicht.
Fräulein Marga riß die Tür weit auf, nahm die Decke auf den Arm und rief: „Wolf, Willy, Jehkab, ich bin fertig, kommen Sie rasch herein!“
Sie trank ein paar Schluck Milch und hielt die große Tasse fest in den Händen.
Eilig kamen die jungen Leute.
„Wolf, Sie wickeln sich sofort in die Decke und trinken diese Milch aus!“ befahl sie. „Ich will nicht, daß Sie meinetwegen krank werden.“
„Aber,“ wehrte er, „ich hab mich ja draußen ganz warm gelaufen. So sehen Sie mich doch an, Fräulein Marga, ich habe ja auch trockene Kleider bekommen.“
[216] „Um so besser,“ sagte sie. „Die Milch trinken Sie aber dennoch. Seien Sie vernünftig, Wolf, bitte!“
Er tat ihr den Willen. „Nun aber vorwärts!“ sagte er. „Lebt wohl, Mutter Greetsche, und vielen Dank!“
Er ließ einen Silberrubel in die schwielige Hand der Bauerin gleiten.
Vor der Tür hob Grendsche-Jehkab ein Bündel weißer Wasserrosen auf.
„Fürs gnädige Fräulein!“ sagte er kurz.
„Ach!“ rief Fräulein Marga erfreut. „Du hast sie mit dem Boot geholt – was bist du für ein guter Junge, Jehkab! Dank, tausend Dank!“
Die kleine Karawane setzte sich in Bewegung. Willy führte das Pferd am Zügel.
Mutter Greetsche stand auf der Türschwelle und strahlte. Darthe sah finster und verdrossen drein. Nein, auch die Blumen, die gönnte sie dem schönen Fräulein nicht, nein, erst recht nicht.
Leise spann die Zeit ihre grauen und bunten Fäden. Jahr um Jahr rauschte der Fluß sein eintöniges Lied. Jahr um Jahr aber blieb er der gleiche, nur die Menschen an seinen Ufern waren anders geworden, und die Zeiten hatten sich gewandelt. Die Zeit aber und der Fluß, sie blieben sich gleich.
[217] In der Ferne hatte der Orkan getobt: Krieg! Krieg! Der unselige Krieg mit Japan! Niemand war begeistert gewesen, Tausende hatten sich entrüstet und empört, und die Empörung war zur bleibenden Stimmung geworden. Hier aber im kleinen Ländchen mit der alten Bildung, mit der festen Treue, mit der soliden Arbeit, hier hatte man Wind gesät; was Wunder, daß nach Jahrzehnten der Sturm losbrach, der nicht mehr zu stillen war!
Wind war gesät. Die Letten hatten begonnen, die Russen hatten vollendet. „Lettland den Letten!“ so murmelte man zu erst leise zwischen den Zähnen. „Nieder mit den Deutschen!“ so brüllte man schließlich aus voller Brust.
Russische Bildung der russischen Provinz Kurland. Das war die windige Losung gewesen. Welche Bildung hatte Rußland zu geben? Die Russen selbst sprangen aus der Unbildung in die Überbildung, aus dem Bauernhemd in die Staatsuniform, die Bildung blieb aus – das gibt einen bösen Sturz. Überdruß und Weltschmerz sind die Folgen.
Dieser Wind wehte durch das Land. Immer stärker, immer heißer wehte er von Dorf zu Dorf, von Gesinde zu Gesinde. Die Bauernsöhne kehrten aus der Stadt zurück – Helden der Phrase, zu „fein“ für die Landarbeit, „zu gut“ für die alte Treue, faul und frech. Sie schimpften und hetzten, und sie waren die Klugen. Die jungen Volkslehrer mit der neuen russischen Vorbildung, sie hatten das Nichts auf ihrer Fahne, das Nichts in ihrem Gewissen. [218] Sie konnten nicht anders, sie mußten Wind säen. Du armes Land, du liebes Baltenland, wehe dir!
Herbstsonnenschein. Noch einmal milde verklärte sonnige Tage. Gleich seligen Träumen zogen weiße schwimmende Wolken über den blauen Himmel, und wieder trat Darthe vor die Schwelle ihrer elterlichen Hütte.
Müde und alt kauerte sich das schiefgedrückte Häuslein in sich zusammen, stolz und aufrecht stand das junge schöne Kind des Volkes vor der morschen Tür und beschattete die Augen mit der Hand.
Sie spähte über die Straße zur Wiese hinüber, die sich leise zum Fluß abschrägte. Was ging da vor? Fremde Gestalten mit Spaten und Hacken in den Händen schritten die Wiese auf und nieder. Sie sah einige bekannte Gesichter – den jungen Majoratsherrn Baron Wolf, den Studenten Willy, den Pfarrerssohn, die grüne Cerevismütze schief auf dem Kopf, – da war auch der alte Pastor mit dem weißen Haar, neben ihm die rundliche bewegliche Figur der Pastorin. Da stand endlich Mathildchen, die siebzehnjährige einzige Tochter des alten Ehepaares, mit den leisen huschenden Bewegungen. Sie hatte ein weißes feines aufgewecktes Gesichtchen und eine zarte Stimme, weshalb sie „Mäuschen“ genannt wurde. Auch in der Gemeinde nannte man sie so, wenn man von ihr sprach. Aufmerksam sah Mäuschen zu der hohen blühenden Gestalt der Baroneß Marga auf. Sie sprachen miteinander, und die Baroneß hielt ihr graues Tuchkleid mit der [219] linken Hand gerafft. Ihr schönes Haar, das in einem griechischen Knoten lose und wellig unter dem breiten Federhut hervorleuchtete, funkelte in der Sonne wie rotes Gold. Jetzt beugte sie sich vor und lachte und nickte; nun schritt sie auf Grendsche-Jehkab zu und redete ihn an. Der stand mit seinem Spaten hoch und schlank da; jetzt verbeugte er sich, zog seine Mütze und zeigte lachend seine blitzenden Zähne. Er war jetzt Diener beim jungen Baron.
Finster runzelte Darthe die Brauen. Die trotzige Falte grub sich tief in ihre braune Stirn. Was wollte diese ganze Herrschaftssippe dort auf der Wiese? Da ging etwas Besonderes vor, denn umsonst waren der Baron Wolf und die Baroneß Marga nicht von ihren auseinanderliegenden Gütern herbeigekommen, um sich auf dem Pastoratsgebiet zu treffen. Und wer waren die Fremden? Sie sah schärfer hin. Ein kräftiger Herr mit braunem Vollbart, eine goldene Brille auf der Nase, ging eifrig gestikulierend vom Baron zum Pastor, jetzt stach er mit seinem Spaten in den Wiesengrund und zirkelte ein längliches Geviert ab. Ein alter, hagestolzlicher Herr, der aussah wie ein gelehrter Storch, sah ihm dabei angelegentlich zu.
Von der Flußseite hinter der Hütte her kamen vier Bauern, alle mit Spaten bewaffnet. Ihnen folgte in einiger Entfernung ein Trupp Neugieriger, Männer, Weiber und Kinder, allen voran der Dumpje-Wirt. Sein gedunsenes Gesicht saß auf einem büffelstarken roten Hals. Er redete laut und zornig. Über der [220] schiefen abgetretenen Nase funkelten zwei tückische triumphierende Äuglein.
Darthe hielt es nicht länger, wie der Wind flog sie unter den Haufen.
„Was wollen die Deutschen da?“ fragte sie kurz.
Ein verworrenes Geschrei antwortete ihr.
„Leichen ausgraben! Tote schänden! Schätze suchen!“
Das Mädchen stand versteinert. „Unsinn!“ rief sie. „Die Wiese ist doch kein Friedhof.“
„Es soll einmal vor vielen hundert Jahren eine Schlacht hier gegeben haben, – und die gelehrten deutschen Professoren, die immer alles wissen, behaupten, hier wär’ der Ort,“ belehrte sie der Dumpje-Wirt mit hämischem Lachen. „Nu, wollen sehen, ob die deutschen Nasen recht haben.“
„Und was wollen sie von den Toten?“
„Schmucksachen sollen die Leichen haben, goldene Spangen und Ringe – – haben die Deutschen nicht je und je ihre Finger ausgestreckt, wo es was zu holen gab?“
„Aber der Pastor wird das nicht zulassen!“
„Hoho!“ brüllte der Dumpje-Wirt, „das alte Mannchen! Siehst du nicht, wie er vergnügt dabei steht? Ja, unsereins, freilich, – das kann wieder einmal zusehen! Bei uns wär’s gleich „Leichenschändung,“ – bei den Deutschen aber, den verfluchten Besserwissern, heißt’s: Wissenschaftliche Ausgrabungen. Ja, ein Deckmäntelchen läßt sich ja für alles finden!“
[221] Stumm schloß sich Darthe dem Haufen an. Sie gingen über den Weg auf die Wiese und blieben einige Schritte hinter den Herrschaften stehen.
„Na, Dumpje-Wirt,“ rief Baron Wolf fröhlich, „seid Ihr da? Könntet Ihr uns nicht noch einige Arbeiter und Spaten schaffen?“
„Jawohl, gnädiger Herr Baron,“ sagte der Dumpje-Wirt und nahm eine tückisch-demütige Haltung an. „Wenn ich fragen darf – was wollen die gnädigen Herrschaften hier suchen?“
„Das will ich Euch gleich erklären,“ rief Baron Wolf laut, „oder besser, Herr Pastor, haben Sie die Güte und erklären Sie’s den Leuten.“
Mit freundlichem Lächeln sah der alte Herr die Bauern an und reckte seine Gestalt empor.
„Liebe Gemeinde!“ redete er sie gewohnheitsgemäß an und räusperte sich. „Aus Petersburg hat eine gelehrte Gesellschaft, die sich auch mit unserer Landeskunde befaßt, diese beiden Herren Professoren zu uns gesandt, um hier auf unserem Gebiet wissenschaftliche Ausgrabungen vorzunehmen. Noch lange bevor das lettische Volk hier ansässig war, vor tausend und mehr Jahren haben hier andere Völker gehaust, man nannte sie die Goten, und um das in den gelehrten Schriften festzustellen, soll man die alten Grabstätten öffnen. Was bei diesen Ausgrabungen gefunden wird, ist Eigentum der russischen Regierung und soll in Museen öffentlich ausgestellt werden. Darum ist es von [222] großem Interesse für uns alle, daß etwas gefunden wird, und hier der junge Baron Wolf von Wolfshausen ersucht mich, Euch mitzuteilen, daß jeder, der beim Graben helfen will, zwei Rubel Tageslohn erhält. Außerdem soll der Besitzer der Wiese, also Ihr, Dumpje-Wirt, für die zerstörte Wiese und jeden gefundenen Wertgegenstand eine angemessene Entschädigung erhalten.“
Die finsteren Gesichter der Bauern hatten sich aufgeklärt. Das gedunsene Gesicht des Dumpje-Wirts strahlte vor Eifer und Geldgier. Leise redete er auf einige Bauernburschen ein, sie trabten eilig davon.
„Wir danken für die Auskunft, gnädiger Herr Pastor und gnädiger Herr Baron,“ sagte er mit einem tiefen Bückling. „Es werden gleich noch acht bis zehn Mann mit Schaufeln zu Stelle sein.“
„Wo soll mit dem Graben begonnen werden, Herr Professor?“ fragte Baron Wolf.
„Hier, Baron Wolfshausen, wenn ich bitten darf, – und vielleicht auch gleichzeitig hier.“ Er wies auf eine zweite umzirkelte Stelle.
Baron Wolf schwang den Spaten. „Auf Ihr Glück, Baroneß!“ rief er mit leuchtenden Augen. „Sagen Sie mir ein gutes Wort.“
„Gut Heil, Baron!“ rief Baroneß Marga und errötete.
Mit wütendem Eifer begann Baron Wolf an der zweiten bezeichneten Stelle zu graben. Auch der Student Willy nahm [223] eine Schaufel zur Hand, an seiner Seite stand Grendsche-Jehkab. Die weiche Wiesenerde flog nach allen Seiten auseinander. Nun setzten auch die vier Arbeiter ein; unter ihren regelmäßigen Stichen weitete sich zusehends die Öffnung.
Lachend traten die Damen zurück. „Ich will auch mit helfen!“ rief Baroneß Marga übermütig.
„Aber Ihr Kleid, Marga!“ rief Mäuschen besorgt. „Warten Sie, ich will Ihnen eine Schürze verschaffen. – Semmits Darthing, kannst du nicht dem gnädigen Fräulein deine Schürze borgen?“
Stumm band Darthe ihre Schürze los und reichte sie der Baroneß.
„Ah, Semmits Darthe, wir sind ja alte Bekannte!“ sagte Baroneß Marga freundlich. „Wie du groß und hübsch geworden bist, Mädchen! Kannst du jetzt besser Milch kochen, wie?“
Darthe murmelte etwas Unverständliches. Ihr Zorn gegen die Deutschen war verflogen.
Wie sie grub, die schöne Baroneß! Scheinbar mühelos, regelmäßig und ruhig, und doch förderte jeder kräftige Spatenstich einen gleichen Haufen Erde zutage. Wider Willen bewundernd sahen ihr die Bauern zu.
Ohne ein Wort zu sagen, wandte sich Darthe um und ging in ihre Hütte zurück. Sie kehrte mit einer kleinen leichten Schaufel wieder. „Da, nehmen Sie diese,“ sagte sie, „die ist für Ihre feinen Hände bequemer.“
[224] Lächelnd nahm die Baroneß den Spaten in Empfang und grub emsig weiter.
Sonderbar! dachte Darthe: weshalb verwöhnen sie nur alle Leute? Schweigend stellte sie sich neben Baroneß Marga und begann auch zu graben. Es zog sie etwas zu dem schönen Fräulein hin und stieß sie doch gleichzeitig wieder ab.
„So ist’s recht, Darthing!“ scherzte die Baroneß, „meinen Tagelohn bekommst du auch ausgezahlt. Nun wollen wir mal sehen, wer mehr Glück hat, der junge Baron mit dem Herrn Willy und Grendsche-Jehkab oder wir.“
„Wir!“ stieß Darthe zwischen den Zähnen hervor und grub darauf los, als sei jeder Stich ein Protest gegen die jungen Männer drüben.
Schmunzelnd sah der alte Pastor zu. Er hatte seine Freude an seinen ehemaligen Konfirmanden. Neugierig trippelte die Frau Pastorin von einer Gruppe zur anderen. Der jüngere Professor setzte Mäuschen etwas eindringlich auseinander – ihre Augen leuchteten, und ihr feines weißes Gesichtchen war in gläubigem Vertrauen zu ihm emporgerichtet.
Jetzt kam ein neuer Trupp Arbeiter heran, zehn handfeste starke Männer. Der Professor wies ihnen ihre Plätze an. Stumm ging die Arbeit vor sich.
Baron Wolf richtete sich auf und trocknete die heiße Stirn. „Ich setze eine Tonne Bier, Leute!“ rief er. „Aber erst nachmittag, wenn wir weiter sind.“
[225] Er trat zu Marga. „Baroneß,“ sagte er, „Sie verderben Ihre Hände.“
„Arbeit schändet nicht,“ sprach sie und arbeitete emsig weiter.
„Aber Erde beschmutzt,“ erwiderte er schlagfertig, „sehen Sie, wie Ihr helles Kleid aussieht.“
Sie richtete sich auf und sah ihm voll in die Augen.
„Sie haben recht,“ sprach sie, „wollen Sie nicht Semmits Darthe begrüßen, Baron?“
Wohlgefällig betrachtete er das schweigsame Mädchen.
„Mais c’est une beauté!“ murmelte er. „Un vrai type bohémien.“
„N’est ce pas?“ gab sie zurück.
„Ei, Darthe,“ sagte Baron Wolf, „mir scheint, wir kennen uns schon lange!“
Sie warf einen düsteren funkelnden Blick zu ihm empor und grub schweigend weiter. „Kann schon sein,“ murmelte sie gleichmütig.
„Une fiertè de reine,“ sagte er wieder, „elle m’intéresse. – Höre,“ sprach er weiter, „warst du’s nicht, die vor ein Dutzend Jahren die Dohle, um die wir einen Wettlauf machten, fliegen ließest?“
„Jawohl, gnädiger Herr.“ Um ihre Mundwinkel zuckte ein trotziges Lächeln.
„Warum tatest du es denn?“ fragte er freundlich. „Sieh mal, ich bin ein neugieriger Mensch und möchte es gerne wissen.“
„Was ist das für eine Geschichte mit der Dohle?“ fiel Baroneß Marga ein.
[226] „Ich erzähle sie Ihnen sofort, Baroneß – also, wie war’s, Darthing, warum ließest du die Dohle fliegen?“
Jetzt richtete sich das Mädchen auf. Eine flammende Röte überzog ihr braunes Gesicht.
„Weil ich Sie nicht leiden konnte!“ stieß sie trotzig hervor. „Sie waren ungerecht gegen den Grendsche-Jehkab. Der lief eben so schnell wie Sie!“
„Mais elle est parfaite!“ wandte sich Baron Wolf amüsiert zu Marga. „Höre,“ fuhr er dann fort, „also ungerecht bin ich gewesen? Nun, was meinst du wohl, was war dem Jehkab lieber, die Dohle oder die dreißig Kopeken, die er nachher als Entschädigung bekam?“
„Wie soll ich das wissen?“ fragte sie trotzig. „Fragen Sie ihn selber. Mir wär’ die Dohle lieber gewesen, und darum sollt’ sie keiner haben.“
„Das gefällt mir, Darthing!“ rief Baroneß Marga, die nun auch den Hergang verstanden hatte. „Sieh, du bist ja stolz wie eine Prinzessin. Wirst du denn auch jetzt nicht zu stolz sein, ein kleines Andenken von mir anzunehmen?“ Sie löste eine kleine goldene Nadel aus ihrer Krawatte und steckte sie Darthe an die Brust.
„Ich will keine Goldsachen,“ wehrte sich Darthe – „ich will nichts von Ihnen.“
Verwundert zog Marga die feinen dunklen Augenbrauen in die Höhe.
„Und warum nicht?“ fragte sie.
[227] „Weil Sie alle deutsche Herrschaften sind und wir nichts mit Ihnen gemein haben!“
Baronh Wolf ließ einen leisen Pfiff erschallen.
„Daher also pfeift der Wind,“ sagte er halblaut. „Du gehörst also zu den Roten, Kind,“ sprach er verstimmt. „Wer hat dir denn diese Ideen in den Kopf gesetzt?“
Darthe schwieg. Unwillig wandte sich der Baron ab.
„Noblesse oblige!" murmelte Marga leise. „Laissez nous. Darthe,“ sagte sie darauf freundlich, „willst du mir ein paar Fragen beantworten, nicht dem gnädigen Fräulein, sondern einfach – wie ein Mensch zum andern redet?“
Darthe hielt den sicheren gütigen Blick des Fräuleins ruhig aus. „Ja,“ sagte sie entschlossen.
„Ihr schimpft auf die Deutschen – sie sollen euch bitteres Unrecht getan haben und so weiter – sag, kannst du was dafür, daß du als Lettenkind geboren bist?“
„Nein,“ sagte sie ernsthaft.
„Gut. Wenn du nun aber als Deutsche im Herrenhofe geboren wärst - was würdest du tun? Würdest du dich ruhig weiter schimpfen lassen?“
Darthe schüttelte den Kopf. „Ich würde mein Land den Letten geben und fortziehen – die Letten waren zuerst im Land!“ sagte sie furchtlos.
Baroneß Marga lächelte leise. „So?“ sagte sie. „Das geht ja schnell bei dir. Wenn nun aber ein altes Volk, das vor euch [228] hier hauste, zu deinem Vater sagte: Höre, Semmit, wir waren vor euch hier, uns gehört deine Hütte, – würdet ihr sie ihnen geben?“
Darthe schwieg. „Nein!“ sagte sie nach langem Zögern.
Baroneß Marga sah sie mit leuchtendem Blick an.
„Du bist ein ehrlicher Mensch, Darthe,“ sprach sie gütig, „und ein gerechtes Mädchen. Nun sieh, – in diesen Gräbern hier sollen einige des Volkes ruhn, die vor euch Herren im Lande waren. Alle werden wir einst in Gräbern ruhen, Hoch und Gering. Soll man sich darum hassen und befehden?“
„Man soll miteinander kämpfen um sein Recht!“ stieß Darthe wieder ungestüm hervor.
„Das ist ein ehrliches Wort, wenn auch traurig genug,“ sprach Baroneß Marga wieder – „nun, sei versichert, wir wollen und werden kämpfen und für unser angestammtes Recht einstehen, solange wir können! – Kommen Sie, Baron Wolf.“ Sie nahm seinen Arm.
Widerstreitende Gefühle, Haß, Achtung, Bewunderung und etwas wie Liebe tobten in Darthens Brust. Mit zitternden Fingern löste sie die Nadel von ihrem Kleide.
„Bitte nehmen Sie!“ sagte sie flehend, und ihre Lippen zuckten. „Sie hasse ich nicht, aber sie sind ein Herrenkind, und ich eine Knechtstochter.“
Zögernd nahm Marga die Nadel zurück. „Sie hat keinen Wert mehr für mich!“ sagte sie traurig. Sie zerbrach sie und warf die flimmernden Stücke weit in die Wiese hinein.
[229] Mit lüsternen Augen waren die lettischen Bauern dem Vorgang gefolgt. Eine beutegierige Horde stürzten sich Burschen, Weiber und Kinder der zerbrochenen Nadel nach und wühlten und suchten im Grase.
Marga warf den stolzen Kopf zurück. „Das da sind unsere Feinde!“ sprach sie mit bitterm Lächeln. „Gegen Raubtiere, nicht Menschen sollen wir kämpfen! Der einzige Mensch in dieser Gesellschaft mit einer menschlichen Seele – ist die kleine wilde Schönheit. Schade um sie!“ Sie seufzte.
Grendsche-Jehkab hatte eine Pause gemacht. Seine Augen funkelten. Leise schlich er zu Darthe heran, die versunken dastand.
„Mädchen,“ sagte er und faßte sie rauh beim Arm – „bist du toll? Weißt du, daß die Nadel da mindestens fünfzig Rubel wert war?“
Sie schrak auf. „Laß mich!“ rief sie zornig, „was geht das dich an?“
„Bist du so reich,“ fragte er höhnisch, „daß du Gold und Edelsteine verschmähst? Darthe Semmit, ei, ei, –“ seine Augen glitten blinzelnd an ihrer schlanken Gestalt nieder, – „du tust ja so stolz, als wenn du ’ne Baroneß wärst.“
Sie wies auf den wühlenden Haufen.
„Besser ’ne Baroneß, als ein wühlendes Schwein!“ sagte sie kurz.
Der Dumpje-Wirt hatte den Edelstein gefunden und verbarg [230] ihn hastig in seiner roten Faust. Er bückte sich und tat, als ob er noch suchte.
Ein lauter Freudenruf des jüngeren Professors scheuchte die Leute auf. Er stand vorgebeugt mit glänzenden Augen an der Grube, an welcher die Baroneß Marga und Darthe gearbeitet hatte. „Vorsichtig, um Gottes willen, vorsichtig!“ rief er. „Ein menschlicher Fußknochen!“
Alles drängte an die Grube heran. Mit einem kühnen Satz sprang der Professor hinein.
„Es ist richtig!“ rief er. „Wahrhaftig ein Fußknochen – alle fünf Glieder unversehrt! – Bitte, hier weiter graben!“ rief er in fieberhaftem Eifer. „Hierher, nach links, und vorsichtig, ja vorsichtig!“
Darthe ergriff ihre Schaufel und schob sich durch die Reihen.
„Fort du!“ herrschte sie Grendsche-Jehkab an[WS 12]. „Wer goldene Schätze verschmäht, der soll auch nicht nach morschen Knochen graben!“
Er spie in die Hände, faßte den Spaten fester und arbeitete tapfer darauf los. Sein hübsches Gesicht troff von Schweiß. Noch nie hatte er Darthe so gut gefallen. Gleichzeitig hatten einige Arbeiter, darunter der Dumpje-Wirt, ein paar Fuß weiter, da, wo der Professor den Kopf vermutete, zu graben begonnen. Schweigend und fieberhaft arbeiteten sie weiter. Eine dumpfe, erwartungsvolle Stille lag über der Versammlung. Die beiden Professoren beobachteten gespannt die zunehmende Höhlung der Grube.
[231] Eine Schaufel klirrte gegen morsches Gebein.
„Zurück!“ donnerte der Professor, „Sie, junger Mann,“ zu Grendsche-Jehkab, „und ich, wir wollen den Rest selbst besorgen, Sie haben eine leichte Hand!“
Sie standen in der Grube. Die Erde flog in kleinen Häufchen heraus – entblößt lag das gelbe morsche Gerippe vor ihnen.
„Mittelgroße Rasse,“ murmelte der Professor, „feinknochig, muß von fürstlicher Abstammung gewesen sein!“
Mit zitternden Fingern strich er die Erde vom Armknochen zurück.
„Hm – eine bronzene Armspange – dacht ich’s mir doch – – eine Brustplatte. –“ Mit liebkosendem Griff streifte er die Spange ab und löste das Brustschild. „Fräulein Mathilde!“ rief er spähend, „wo sind Sie?“
Mäuschen war zur Stelle und breitete ein schneeweißes Taschentüchlein auf den Rasen. „Geben Sie her!“ rief sie.
Er reichte ihr die mit Grünspan überzogenen Gegenstände.
„Vorsichtig!“ flüsterte er heiser. „Ritzen Sie sich ja die Finger nicht!“
Dann bückte er sich wieder nach dem Schädel und hob ihn behutsam heraus.
Ein dumpfes Murmeln flog durch die Versammlung. Tastend gingen seine Finger an den Fingergliedern des Gerippes auf und nieder. Er zog einen breitgedrückten Ring von der Knochenhand und löste sie aus der Erde.
[232] „Genug!“ sagte er keuchend vor Erregung. „Die Leute kann ich nicht mehr brauchen!“
Der alte Professor hatte ihm den Schädel aus der Hand gegriffen und betastete spürend die Schädeldecke.
„Plattschädel … mindestens 1200 Jahre alt,“ murmelte er, „ein wertvoller Fund, Kollege Weiß.“
Professor Weiß stieg aus der Grube und klopfte sich die Beinkleider von der haftenden Erde rein.
„Ich habe noch mindestens eine Stunde mit Messungen zu tun,“ erklärte er, „die Leute können gehen. Morgen um diese Zeit sollen sie wieder am Platz sein, wenn es möglich ist. Ich will die Herrschaften auch nicht mehr aufhalten und hoffe Sie alle im Pastorat vorzufinden.“
Damit zog er einen Kompaß und ein Zentimetermaß aus der Tasche und stieg wieder in die Grube. Sein Kollege folgte ihm.
In kleinen Gruppen schlugen die Herrschaften den Weg zum Pastorat ein.
„Ah!“ brummte der Dumpje-Wirt unzufrieden, „die Entschädigung für die paar lumpigen Dinger wird ja wohl mager genug ausfallen! Ist ja nicht mal Gold!“
Und wohlgefällig betastete er den funkelnden Stein, den er heimlich in seine Westentasche gesteckt hatte.
Darthes dunkle Augen sahen sinnend ins Leere. In diesen Gräbern sollen einige des Volkes ruhen, die vor euch Herren [233] im Lande waren – hatte die Baroneß gesagt. Und das war Wahrheit. Ohne Gruß wandte sie sich um und schritt langsam zum Fluß hinab.
Sie setzte sich und starrte in die hüpfenden kleinen Wellen. Dann bedeckte sie ihr Gesicht mit den Händen und fing bitterlich an zu weinen.
Oben aber auf der Wiese lagerten die Letten und ließen sich das herrschaftliche Bier wohlschmecken. Als die Professoren gegangen waren, hielt der Dumpje-Wirt eine freche revolutionäre Rede.
Die reiche Ernte dieses Jahres lag wohlgeborgen in den Scheuern. Die abgeräumten Felder standen voll borstiger Stoppeln und warteten geduldig auf neue bessere Zeiten. Eintönig und schläfrig murmelte der Fluß.
Doch ehe die surrende Musik der Dreschmaschine von Gehöft zu Gehöft ertönte, sollte ein Grünfest veranstaltet werden. Das letzte im Jahre.
Und das erste, in den Hunderten von Jahren, das so gefeiert wurde. Es schlich ein böser Geist von Gesinde zu Gesinde, der Geist der Revolution ...
Früher war das Fest in dem geräumigen Schloßpark der Wolfshausens gefeiert worden – jetzt hatten die Letten es verschmäht, um den Park zu bitten – und höhnisch hatten sie die Waldwiese eines reichen Bauernwirts zu ihrem Fest bestimmt. Man konnte sie deutlich vom Schloß aus sehen. Seit vielen Jahren war immer jemand von den Herrschaften aus dem Herrenschloß [234] oder dem Pastorat mit auf das Fest gekommen, und die Leute hatten den Ehrengast mit Tusch und Willkommensgruß gefeiert. Es war eine hohe Ehre für die Burschen gewesen, mit den herrschaftlichen Fräulein zu tanzen. Jetzt zum erstenmal war das anders. Eine rote Fahne wehte von derselben Stange, die früher die kurländischen oder die Reichsfarben getragen. Dreist und frech wie eine ringelnde rote Schlange wehte sie im Winde. Und die blinkenden Fenster des Herrenschlosses blieben geschlossen und verhängt. Ja, es ging ein böser Geist um unter dem Volk, der Geist der Revolution.
Ein buntscheckiger Knäuel von Menschen war auf dem Platz versammelt.
Frech und lärmend war ihr Gebaren, herausfordernd ihr Aussehen.
Unter Absingung eines revolutionären Liedes waren die Burschen schon halb betrunken auf den Platz gelangt.
Darthe war mit Mutter Greetsche gekommen. Die gute Frau arbeitete noch immer im Tagelohn mit ihrem Mann beim Zehsewirt. Er hielt seine Leute knapp und war ein harter Herr, und gerade darum schimpfte er am lautesten über die deutschen Barone. Sie zahlten bessere Löhne und die Verpflegung war eine reichere. Aber die leichtgläubige Mutter Greetsche schwor auf jedes Wort des Zehsewirts und tat schon lange ihr möglichstes, auch Darthe zur Tagesarbeit bei ihm zu bestimmen. Das hartnäckige Mädchen aber schüttelte den Kopf und schwieg. Sie stand sich besser bei [235] ihrer Näharbeit und versorgte die Wirtsfrauen und Töchter mit Kleidern. Ohne jemals die Schneiderei berufsmäßig erlernt zu haben, betrieb sie sie eifrig und stand sich ganz gut dabei. In ihrem weißen Kleide, dem Geschenk der Baroneß Marga, sah sie aus wie ein schönes stolzes fremdländisches Fräulein und lenkte aller Blicke auf sich.
Mutter Greetsche sah die bewundernden Blicke recht gut, die ihrer Tochter galten, und spann in ihrem Innern verwegene Pläne. Dem reichen Dumpje- Wirt war vor drei Monaten seine Frau gestorben – wie, wenn Darthe Dumpje-Wirtin würde? Sie hielt ihre schöne Tochter krampfhaft am Arm fest und segelte mit ihr stracks auf den Dumpje-Wirt los.
Breitspurig stand er da, die Daumen in den Westenärmeln, und blickte hochfahrend um sich wie ein Sieger im Felde.
„Guten Tag, Dumpje-Wirt,“ sagte Mutter Greetsche ein leitend, „’s ist ein schönes Wetter heuer!“
„’s geht an!“ meinte der Dumpje-Wirt gnädig. „Heute wollen wir einmal lustig sein, Jungfer Darthe – wie?“ sagte er mit einem Seitenblick auf das Mädchen.
„Was machen Eure armen Waisen, Dumpje-Wirt?“ steuerte Mutter Greetsche nun direkt auf ihr Ziel los. „Die sehnen sich wohl nach der Mutter. Müßtet wieder auf die Freite gehen, Dumpje-Wirt.“
„Haben jetzt wichtigere Dinge zu tun, Mutter Greetsche, die Zeiten sind nicht danach.“
[236] Mutter Gretsche seufzte wehmütig und faltete die Hände über dem Leib. „Ach ja, böse Zeiten, böse Zeiten!“ stöhnte sie und wiegte trübseelig den Kopf hin und her.
„Böse Zeiten, sagt Ihr? Nein, Mutter Greetsche – das stimmt nicht. Gute Zeiten sind’s für uns Letten. Nun kommen wir mal ans Regiment. Für die da" – er wies über die Schulter nach dem Schloß – „könnten die Zeiten schon ein bischen heiß werden. Dafür wollen wir sorgen. Für uns aber sind’s gute Zeiten.“
„Ja ja, kann schon sein,“ sagte sie schwerfällig, „aber in guten Zeiten sollte man auch eine Frau haben, mit der man sich darüber ausreden kann, wenn einem die Seele voll Freude ist.“
Jetzt riß sich Darthe mit flammenden Wangen von ihrer Mutter los.
„Habt Ihr eine Frau an mich zu vergeben, Mutter Greetsche?“ witzelte er mit einem pfiffigen Seitenblick auf das davonstürmende Mädchen.
„Nu, es käm’ drauf an!“ meinte Mutter Greetsche philosophisch. „Man wird immer älter, Dumpje-Wirt, und möcht' seine Kinder schon gut versorgen.“
„Man kann sich die Sache ja mal überlegen?“ sagte der büffelstarke Mann behäbig und reichte Mutter Greetsche die Hand.
In gehobener Stimmung trat sie zurück und setzte sich breitspurig auf eine Bank. Sie hatte ihre Angelegenheit doch wahrhaftig fein eingefädelt. Ja, wenn die Kinder groß würden, dann fingen die Sorgen erst eigentlich an, dachte sie seufzend. Sind sie [237] klein, so drücken sie einem die Knie, sind sie groß, so drücken sie das Herz – ja, ja. Wohlgefällig strich sie die Falten ihres Rockes glatt. Da griff jemand von hinten nach ihrem Arm.
„Mutter!“ zischte Darthe und stand von brennender Röte übergossen vor ihr, „sagst Du solche Dinge noch einmal, so geh’ ich in den Fluß – verstehst Du?“
Da stand sie – die Augen gesenkt, die Lippen zusammengepreßt, eine tiefe, böse Falte in der Stirn. Sie war bildschön, „Wai Gottchen, wai Gottchen!“ seufzte Mutter Greetsche, „was hat man für ’ne Not mit den Kindern!“
Nun stimmten auch die Musikanten die Tanzmusik an. Ein wunderlicher, säbelbeiniger Kerl – er war von Beruf Schneider – strich mit zornigem Eifer eine alte riesige Baßgeige. Sein schmutziges, graues Haar war auf seinem Kopfe wie angeklebt. Zwei Musikanten kratzten seelenruhig und falsch ihre Fiedeln und entlockten ihnen jämmerliche quiekende Töne. Ein lang-magerer Flötist fingerte versunken auf seinem Instrument herum, als gehe ihn die ganze übrige Welt nichts an, und ein behäbiger Bläser verteilte seine Zeit mit bewunderungswürdiger Gerechtigkeit an sein Cornet à Piston, indem er teils mühsam hineinblies, teils hineinsah wie in ein Fernrohr. Der Zehse-Wirt, ein kleiner schrumpliger Mann, stand in guter Laune hinter den fünf Musikanten und schlug mit der dürren roten Hand den Takt dazu. Die Zehse-Wirtin wandte der Gesellschaft ihre imponierende Rückseite zu und unterhielt sich laut und angelegentlich mit Grendsche-Jehkab, [238] der selbstbewußt dastand und die Blicke der Mädchen auf sich ruhen fühlte.
„Wie bist Du denn von Deinem gnädigen Herrn Baron losgekommen?“ fragte sie.
„Er ist ausgefahren, Wirtin,“ antwortete Grendsche-Jehkab mit liebenswürdiger Nachlässigkeit und sah über sie hinweg zu Darthe hinüber.
Mit runden, begehrlichen Augen starrte die semmelblonde Zehsewirtstochter den hübschen Gesellen an.
„Das Tanzen habt Ihr wohl auf dem Schloß gelernt?“ fragte sie neugierig. „Tanzt man dort anders?“
„Wollt Ihr’s mit mir versuchen, Jungfrau?“
Sie errötete und ließ sich von ihm umfassen.
Es war ein wunderliches Tanzen. Er beherrschte es wie einer der jungen Barone, denen er es abgesehen hatte, und flog mit nachlässiger Anmut die Bahn entlang, eine angerauchte Zigarette in der Hand.
Sie trippelte vorsichtig und eckig dahin und bewegte leise die Lippen. Er hörte, wie sie den Takt zählte. Es war ihr saure Arbeit.
Mit spöttisch aufgeworfenen Lippen betrachtete Darthe das Paar. Da näherte sich ihr der Dumpje-Wirt.
„Jungfer Darthe – ist’s erlaubt?“ fragte er herablassend.
Sie sah ihn groß an. „Es ist erlaubt, wenn Ihr vergessen wollt, was die Mutter vorhin mit Euch geredet hat. Die Mutter weiß manchmal nicht, was sie tut.“
[239] Er stellte sich unwissend. „Was hat sie denn gesagt, Jungfer?“
„Ich mag’s nicht wiederholen, und wenn Ihr’s vergessen habt, um so besser für Euch und mich!“
In seinem wampigen Gesicht zuckte eine lüsterne Falte. „Ich vergesse alles, was ich vergessen soll, Jungfer Darthe,“ sagte er grinsend, „ich bin überhaupt ein gutgearteter Mensch. Ihr müßtet mich besser kennen lernen.“
Wohlgefällig blickte er auf das Mädchen. Dann umfaßte er sie und stampfte im Polkatakt rund um den grünen Platz. Heiß wehte sein Atem, und fest drückte er sie an sich. Es war ein behäbiges langatmiges Tanzen. Wieder paßten die Tänzer nicht zusammen. Viermal ging’s um den ganzen Platz. Mutter Greetsches Augen leuchteten vor Stolz.
Die Wiese füllte sich mit neuen Paaren. Ringsum auf den Bänken saßen die Wirtsfrauen und Mütter, die Mädchen drängten sich kichernd zusammen wie eine Herde Lämmer. Mit herausfordernden Blicken stampften die Burschen zu zweien oder dreien auf und nieder, sie schossen wie Schäferhunde in das dichteste Gewühl, trieben die Mädchen aus ihren Ecken und holten sie triumphierend hervor.
Gemessen und beinahe andachtsvoll bewegten sich die Paare. Sie tanzten mit sachlichem Ernst und gesenkten Augenlidern, selten flog ein Lächeln über ihre Züge.
Allmählich wurde die Stimmung ungebundener. Man hörte johlende Rufe, Lachen und Kreischen. Immer wieder leuchtete [240] Darthes weißes Kleid in dem Wirrwarr auf. Sie hatte schon mehrere Male mit Grendsche-Jehkab getanzt.
„He! Einen Walzer!“ schrie der Dumpje-Wirt laut. Er blähte sich wie ein Puter. Ohne zu fragen, umfaßte er Darthe urd zerrte sie in den Tanzkreis.
„Verzeiht, Dumpje-Wirt, – ich hab den ersten Walzer schon versprochen.“
„Wem denn?“ Seine Augen funkelten zornig.
„Dem Grendsche-Jehkab!“ sagte sie hastig.
Sie log, und der Wirt vermutete es.
Eine giftige Eifersucht schwoll in ihm auf.
„So will ich ihn fragen,“ murmelte er grimmig, „mir scheint’s, Ihr nehmt’s mit der Wahrheit nicht allzu genau, Jungfer.“
„Denkt, was Ihr wollt,“ sagte sie kurz.
Ihre Augen suchten Grendsche-Jehkab. Mit einem flehenden Ausdruck blieben sie auf ihm haften.
Der gewandte schlaue Bursche hatte die Situation sofort erfaßt. „Nu, Dumpje-Wirt,“ rief er dem Daherstampfenden harmlos entgegen, „was bringt Ihr Gutes? Ihr seht ja aus, als ob Ihr das Herrenspiel ,Es kommt ein Schiff geladen mit – Äpfeln’ spielen wolltet.“
„Mein Schiff ist mit anderen Dingen geladen,“ grollte der Dumpje-Wirt, „mit wem tanzest du den Walzer?“
[241] „Mit Jungfrau Darthe Semmit – zu dienen,“ antwortete Jehkab rasch.
„Nun, dann muß ich freilich zurückstehen, mit so einem schönen geschniegelten Lakaien kann ich’s ja nicht aufnehmen!“
„Ja freilich – eine Tonne Fett kann man nicht zum Lakaien gebrauchen,“ sprach Grendsche-Jehkab unschuldsvoll.
Ein brüllendes Gelächter belohnte seinen Witz. Mit schwingenden Schritten trat er zu Darthe heran.
„Hab’ ich dich endlich, hochmütige Prinzeß?“ lachte er zärtlich und preßte sie an sich. Sie sah dankbar zu ihm auf. Fort ging’s im wirbelnden Schnellwalzer. Die beiden waren aus einem Guß. Das war kein Anpassen mehr, – das waren zwei, die zu eins verschmolzen waren. Bewundernd hingen die Augen aller an diesem Paar. Sie tanzten nur noch allein.
Da brach es durch die gellende Musik – ein schmerzliches Stöhnen. Der alte Semmit, Darthens Vater, war gekommen. Leise war er zu den Zuschauern getreten. Sein graues Haar hing in wirren fleckigen Strähnen um das knochige altgediente Gesicht, um seine eckige Gestalt schlotterte der Rock ... den Arm hielt er ausgestreckt auf das Paar gerichtet und stöhnte wie im Krampfe.
„Ich sehe Blut ...“ sprach er mit hohler, entsetzter Stimme ... „sein Gesicht ist mit Blut beschmutzt ... die Hände ... die Kleider voll Blut ... laß ab von ihm, Mädchen, laß ab ...“ er kreischte schrill auf, warf die Arme hintenüber und brach zusammen.
[242] Zehn Fäuste griffen zu. Ein dichter Kreis bildete sich um den Alten. Kreischend taumelte Mutter Greetsche zu ihm hin.
„Was ist, Vater Semmit? Was ist? Ist er betrunken?“ schwirrte es ringsum.
Das tanzende Paar war einen Augenblick stehen geblieben wie erstarrt. Verwirrt klammerte sich Darthe an ihren Tänzer und stieß ihn gleich wieder angstvoll mit einem Schrei von sich.
Da packte er das Mädchen fester und zwang es mit einer herrischen Gebärde an seine Seite. Er warf den Kopf zurück und blickte trotzig um sich.
„Der alte Semmit redet irre!“ sagte er ruhig. „Was faselt er da von Blut an meinen Händen? Rein sind meine Hände von Blut ... die Zähne schlage ich dem ein, der mich einen Mörder heißt!“
Er sah prachtvoll aus in seinem stolzen Zorn.
Darthe zuerst brach das Schweigen. Sie fühlte, sie war Grendsche-Jehkab eine Genugtuung schuldig.
„Vater ... Vater ist krank!“ schrie sie gellend auf, „er sieht zuweilen Gesichte ... sieht ... in die Zukunft –“ dann schlug sie die Hand vor die Stirn – „... ja, sieht in die Zukunft,“ wimmerte sie heiser vor sich hin, als erwache sie jetzt erst zum Bewußtsein des Furchtbaren.
Sie war totenblaß.
In Gruppen umstanden die Leute das junge und das alte Paar. Ein dumpfes Gemurmel ging durch die Reihen.
[243] „Alter Jahnit, ... alter Jahnit ... ruhig, ruhig, mein Alterchen,“ hörte man Mutter Greetsches beschwichtigende schluchzende Stimme, „das arme alte Mannchen ist ja ganz auseinander ..., nein, nein, getrunken hat er nicht ...“ erklärte sie den Leuten. „Komm nur, komm, – nach Hause wollen wir gehen!“
Willenlos, hilflos wie ein Kind ließ sich Vater Semmit von Mutter Greetsche abführen. Er atmete schwer. Sein struppiger grauer Kopf wackelte haltlos hin und her. Es schien, als habe er nie das Wort „nein“ aussprechen gelernt.
Darthe zuckte zusammen – sollte sie den Eltern folgen? Nein! Sie blieb. Ein feuriger trotziger Blick Grendsche-Jehkabs bannte sie.
Er schob ihren Arm in den seinen.
„Hiermit erkläre ich allen Anwesenden,“ rief er laut und trotzig, „Darthe Semmit hier ist meine Braut!“
Totenstille. Dann ein lautes, johlendes Bravogeschrei. Trunkene heisere Rufe.
„Der ist schneidig! Der versteht’s! Ein Mordskerl!“
Darthe stand da wie blutübergossen. Sie wagte nicht zu widersprechen. Liebte sie ihn? Haßte sie ihn? Sie wußte es nicht.
Da stand der Dumpje-Wirt vor ihnen.
Die Arme übereinander gekreuzt betrachtete er mit höhnischem Lachen das junge Paar.
[244] „Meinen Glückwunsch!“ sagte er laut und hämisch.
Dann schritt er breitspurig an ihnen vorüber.
„Eine Polka!“ schrillte laut die trockene Stimme des Zehse-Wirts.
Das verstimmte Quintett setzte mit einer scharfen Dissonanz ein. Ein paar Polkatakte folgten.
„Ruhe!“ brüllte der Dumpje-Wirt. Er war auf eine Bank gestiegen.
„Still, still, der Dumpje-Wirt will reden!“
Alles drängte und schob sich näher an die Bank heran.
„Genossen und Brüder!
Es ist jetzt nicht die Zeit, sich mit Verlobungen und Heiraten zu befassen. Das mögen wir den Nichtstuern und ,Herrendienern’ überlassen. Brüder und Genossen – unsere Zeit ist eine große Zeit, eine gute Zeit! Lange genug hat unser Bruder, der lettische Bauer, dem von Rechts wegen das lettische Land gehört, seinen gekrümmten Rücken noch tiefer gebückt und dem großen Herrn Baron mit demütigem Grinsen die gnädige Hand geküßt, hat ihm Frondienste geleistet, für ihn gesät und geerntet und gedarbt – der Tag der Umkehr, der Tag der Rache ist nicht mehr fern. Keine Herren soll es mehr geben, weder hohe noch niedrige. Wir sind unsere eigene Herren! Oder wollt ihr euch noch ferner vor dem blutsaugerischen Leuteschinder, dem Baron, oder vor dem heuchlerischen Pfarrer bücken? Haben die Schwarzen nicht lange genug unsere Rubelchen gestohlen, unsere Hühnerchen gegessen? Wir aber haben gehungert und gedarbt!“ – –
[245] Ein spöttischer Zuruf Grendsche-Jehkabs: „Der mit seinem Fettwanst redet von Hungern und Darben!“ wurde nicht beachtet. Wie in einem Rausch sprach der Dumpje-Wirt weiter, von Haß und blinder Wut und Rednerehrgeiz getragen. Die Worte flogen ihm zu.
„Brüder und Genossen! Die Tage der Deutschen im Lande sind gezählt. Mögen sie fliehen, wenn ihnen ihr Leben lieb ist! Hier dulden wir keine deutschen Herren mehr. Ihre Schlösser, ihre Güter, ihre Ställe, ihre Pferde und Kutschen und Rinder sind unser! Greifen wir nur zu! Nicht mehr stehen wir allein und schutzlos wie eine verwirrte Herde Schafe dem gierigen Raubtier, dem Wolf gegenüber, – den Wölfen von Wolfshausen!“ Dröhnendes Gelächter.
„Das lettische Zentralkomitee steht hinter uns! Das lettische Zentralkomitee denkt und sorgt und handelt für uns. Das lettische Zentralkomitee wird uns unsern Tag der Rache bestimmen – er ist nicht fern. Bis dahin noch geduldet euch und haltet euch ruhig – wir Mitglieder des Komitees kennen den Tag. Dann wird kommen die Stunde, da wir jubeln, da wir siegen, da wir die Herren im Lande sein werden!
Hoch dem lettischen Zentralkomitee! Nieder mit den Deutschen!“
Mit einer großtuerischen Gebärde stieg er von der Bank. Aus der Brusttasche zog er ein Bündel Proklamationen. Gierige Hände griffen danach.
[246] „Hoch ... hoch! Nieder ... nieder! – Dem lettischen Zentralkomitee ... den Deutschen ... hoch! nieder!“ heulte es wie ein wühlender Sturm durch die Masse. Sie hoben die Hände hoch, sie brüllten, sie johlten, die Weiber kreischten laut – ihre Wangen brannten, ihre Augen glühten.
Der Dumpje-Wirt war der Held des Tages. Was wollte neben ihm Grendsche-Jehkab mit seiner improvisierten Verlobung bedeuten? Er war einfach nicht mehr da. Vergessen. Ausgewischt.
Und der Jubel erreichte seinen Höhepunkt, als der Dumpje-Wirt noch einmal auf die Bank stieg und schrie.
„Einige Brüder und Genossen! Ich setze euch aus meiner Tasche 4 Tonnen Bier und ein Faß Branntwein! Die Keller der Deutschen werden uns bald bessere Getränke liefern. Dann fließt Wein und Champagner – heute aber nehmt vorlieb, Brüder,- ein Lump, der mehr gibt, als er hat!“
„Hurra dem Dumpje-Wirt! Hurra! Hoch! Hoch! Es lebe der Dumpje-Wirt! Der Dumpje-Wirt hoch!“ brüllten hundert heisere Kehlen.
Ein ungeheurer Jubel hatte sich der lettischen Genossen bemächtigt.
Bleich mit verzerrtem Gesicht stand Grendsche-Jehkab da. Auf seinen blassen Wangen brannten zwei kreisrunde rote Flecke. Seine Lippen zuckten -- der Dumpje-Wirt hatte ihn öffentlich beschimpft! Angstvoll umklammerte Darthe seinen Arm. Rauh stieß er sie zurück.
[247] Ein lodernder Blick voll grenzenlosen Staunens, voll empörter Verachtung maß ihn von oben bis unten. Sie wandte ihm den Rücken und schritt hastig davon.
Er sprang ihr nach.
„Seht ... seht das Brautpaar! Das Brautpaar!“ schallten höhnende Rufe. „Die Bettelbraut und der Herrenknecht!“
In ohnmächtiger Wut preßte er die Zähne zusammen und ballte die Fäuste.
„Wollen sehen ...“ murmelte er halblaut, „wer mehr vermag – Ihr mit Eurem leeren Schwatzen und Reden oder ... ich!“
Sie hatte die Worte gehört, doch wandte sie den Kopf nicht um. Jetzt ging er neben ihr her.
„Darthe!“ keuchte er heiser, „willst du mich zum Gespött der Leute machen?“
Sie blieb stehen und sah ihn mit flammenden Augen an.
„Darthe Semmit läßt sich nicht zum zweiten Male fortstoßen. Sie hat sich dir nicht aufgedrängt, Grendsche-Jehkab. Um deinetwillen bin ich geblieben, als meine Eltern gingen. Ist das der Dank? Für eine Minutenbraut bin ich mir selbst zu schade!“
„Minutenbraut ...“ wiederholte er. „Aber Darthe, was redest du denn? wußte ich denn, was ich tat, als ich dich stieß? Ich dachte ja nur an den feisten Protzen, den Dumpje-Wirt ... Du bist meine Braut und sollst es bleiben und nun erst recht!“
„Dazu gehören zwei!“ sagte sie kurz.
[248] Er legte sich aufs Bitten und Schmeicheln.
„Aber Darthing, liebes Darthing ...“
Endlich wandte sie den Kopf. „Bin ich dein liebes Darthing?“ fragte sie ernst.
„Bei meiner Seele!“ schrie er. „Wen sollte ich denn sonst auf der Welt lieber haben?“
Sie war versöhnt. Stumm reichte sie ihm die Hand. „Ich halte zu dir", sagte sie einfach, „was auch kommen mag!“
„Was auch kommen mag .. ,“ wiederholte er.
Durch niedriges Buschwerk und Gestrüpp schritten sie quer über die Wiese, die Nachmittagssonne zeichnete ihre langen schrägen Schatten in das Gras. Ein gequältes Stöhnen hemmte ihre Schritte. Sie traten hinter einen breiten Wachholderbusch. Da lag die „hohe Polizei" gefesselt – der Landgendarm Kalning, einen Knebel im Munde.
„Lassen wir ihn liegen!“ sagte Grendsche-Jehkab schadenfroh und versetzte dem Manne einen Fußtritt. „Es geschieht ihm recht.“
Darthe stand unschlüssig daneben.
Ein plötzlicher Verdacht stieg in Grendsche-Jehkab auf. Er bückte sich und nahm dem Manne den Knebel aus dem Munde. „Wer hat dich gefesselt?“ sprach er finster. „Die Wahrheit, Mann, oder ... “
„Der Dumpje-Wirt war’s mit zwei Burschen!“ stöhnte der Polizist.
[249] „Der Dumpje-Wirt ...“ Ein Leuchten flog über Grendsche-Jehkabs Züge. Er zog sein Messer und durchschnitt die Bande.
„Wer dich befreit hat, darüber schweigst du“ herrschte er den Mann an, „aber den Dumpje-Wirt magst du immerhin anzeigen bei der hohen Polizeibehörde in Bauske. Eben noch hat er das Maul vollgenommen und das Volk aufgehetzt“.
Der Polizist rieb sich die steifen Glieder und nickte. „Vielen Dank, Grendsche-Jehkab“, sagte er. Dann schlich er sich in der Richtung nach Bauske davon.
Stumm schritten die beiden weiter. Darthe hielt den Kopf gesenkt.
„Bist du kein Roter, Jehkab?“ brach sie plötzlich das Schweigen.
Er lachte. „Weil ich den Spürhund da losließ? Und wie! Aber das Wichtigtun und protzige Reden führt zu nichts. Dem Dumpje-Wirt wird eine gute Lehre von Nutzen sein. Überhaupt, auf Wirte verlassen wir uns nicht. Die sind Besitzer. Ich weiß vielleicht mehr, als alle. Heute um drei Wochen soll’s losgehen!“
„Heute um drei Wochen?“ fragte Darthe mit funkelnden Augen.
„Jawohl. Und halt’ den Mund, Mädchen.“
Sie gab ihm die Hand. „Geh jetzt, Jehkab – es ist besser, wenn Vater dich nicht sieht. Wir halten zusammen.“
[250] Zögernd stand er da. „Wie du willst,“ sagte er endlich und schlug den Weg ein, den er gekommen war.
Darthe wandte sich um und blickte ihm lange nach.
Wind war gesät und Sturm fegte durch das Land, – der Sturm, der nicht mehr zu halten war.
Nach sonnigem Herbstwetter waren trübe Regentage gefolgt. Schwer und breit und grau rauschte der Fluß dahin, und dunkle Wolken hingen über nebelgrauen Wäldern und nassen Stoppelfeldern.
Dem Flußufer entlang, stromaufwärts, schritt an einem trüben Herbsttage eine weibliche schlanke Gestalt. Sie war in ein dichtes Tuch gehüllt und kurz geschürzt. Die derben ledernen Bauernschuhe traten tapfer vorwärts in das lehmige Erdreich, und hoch auf spritzte bei jedem Schritt das schmutzige Wasser. Unter dem groben Wolltuch hob sich in schweren Flechten das kronenförmig aufgesteckte Haar, über die braune Stirn hingen feuchte Strähnen.
Darthe Semmit ging einen schweren Gang, denn sie hatte eine Mission zu erfüllen. Die Mission aber hatte ihr niemand anders diktiert, als der, der allein rechte Missionen befiehlt – Gott – und ihr Herz.
Stundenlang war sie geduldig gegangen. Der Weg war weit und beschwerlich. Und immer lauter und vernehmlicher rauschte der Fluß. Es schien, als habe er ihr etwas zu sagen, [251] und er hatte ihr auch etwas zu sagen. Du tust recht, du tust recht, rauschten und murmelten die dunklen Wellen, die an ihr vorüberwirbelten.
Sie blieb stehen und schöpfte tief Atem. Ihre Kindertage fielen ihr ein und die Märchen der toten Großmutter. Es waren doch schöne stille Zeiten gewesen, als sie den kleinen Bruder Jahnit wiegen mußte, schöne stille Zeiten. Der Jahnit war nun schon ein großer Bursch und ging drüben bei Bauske in die Tischlerlehre. Der hatte sie nicht mehr nötig und die Großmutter auch nicht. Wer hatte sie denn eigentlich nötig? Der Vater ... die Mutter, – Grendsche Jehkab?
Sie schüttelte düster den Kopf. Vater und Mutter, die hatten einen Sohn und gingen ihre eigenen Wege, wie sie selbst ihre eigenen Wege ging, – sie hatten sie nicht nötig, und Grendsche-Jehkab? Ging er nicht auch eigene Wege? Lief er nicht jedem hübschen Mädchen und jedem Rockzipfel nach? War er treu? War er zuverlässig? Konnte sie ihm trauen?
Wieder schüttelte sie den Kopf. Sie kannte ihn zu wenig. Aber heute, ja heute würde jemand sie nötig haben – Baroneß Marga. Sie schritt hastig vorwärts, und wieder versank sie in Erinnerung. Wie war das damals gewesen, als die Baroneß Marga ins Wasser gefallen war? Wie hatte es in der dunklen Stube geleuchtet, als die helle nasse Gestalt mit dem rotgoldenen Haar hereintrat! Und wie vernarrt waren die beiden, der junge Baron und Grendsche-Jehkab, in das schöne Mädchen gewesen! [252] Sie hatte es schon damals gespürt. Richtig vernarrt waren sie beide, ja alle drei.
Wie hatte der Grendsche-Jehkab sich zu Boden geworfen, um ihr die Stiefelchen aufzuknöpfen! Wie eifersüchtig hatte der Jungherr Wolf ihn fortgejagt! Und dann die weißen Wasserrosen, die Grendsche-Jehkab mühselig für sie gepflückt hatte – heute würde er ja wohl keine Blumen mehr für sie pflücken.
Nein, er war ja ihr Feind, wie sie selbst ihre Feindin war. Sie war ja Lettin und allen Deutschen feindlich gesinnt, am meisten den Baronen und Landesbedrückern.
Aber Baroneß Marga bedrückte ihre Leute nicht. Das mußte wahr sein. Still und friedlich lebte sie bei ihrer alten harthörigen Tante, und manchmal war sie in die Bauernhütten gekommen, wenn es galt, eine Wunde zu verbinden oder ein krankes Kind zu pflegen. Nein, Baroneß Marga war keine Leuteschinderin. Aber sie war eine Deutsche und eine Baroneß, und darum mußte Darthe sie hassen.
Und sie haßte sie – redlich und aufrichtig. Nur sonderbar daß sie sie zugleich beinahe liebte. Wie gütig hatte die Baroneß mit ihr gesprochen, wie traurig hatte sie ausgesehen, als sie die goldene Nadel zerbrach und fortwarf! Und das hatte Darthe eigentlich furchtbar gefallen. Sie selbst hätte es genau so gemacht an Stelle der Baroneß. Denn auf Gut und Geld gingen sie ja beide nicht aus. War der Grendsche-Jehkab etwa reich? Und brauchte die Baroneß nicht bloß ihren kleinen Finger auszustrecken [253] – und Baron Wolf war froh, sie zu seiner Baronin zu machen. Nein, geldgierig war sie nicht – sie war gütig und gerecht und ehrlich, – aber sie war einmal eine Baroneß, und darum mußte sie sie hassen.
Wieder blieb Darthe stehen. Wenn sie doch den Grendsche-Jehkab ebenso hassen könnte wie die Baroneß Marga – dann, ja dann wäre sie glücklich, denn dann war alles klar. Er war ja so veränderlich – bald kümmerte er sich nicht um sie, bald sagte er ihr die schönsten Dinge. Jetzt war er voll düsterer Rachepläne gegen die Barone, dann wieder renommierte er mit dem silbernen Papyrosetui, das ihm der junge Baron geschenkt. Heute war er bereit, persönlich dem Baron Wolf das Schloß über dem Kopf anzuzünden, wie alle Herrenhäuser in einer kurzen Weile angezündet werden sollten, morgen wieder erzählte er voll Stolz, daß der Baron ihm vertraue wie keinem, nicht mal dem Verwalter. Aber eins war ihr gewiß – Grendsche-Jehkab würde seine Hände nie mit Herrenblut beflecken – und ihr Vater hatte sich geirrt. – Hatte sich ihr Vater geirrt? Konnte es nicht sein, daß Jehkab jemals einen Mord beging – aus Zorn – aus Rachsucht – aus Eifersucht?
Aus Eifersucht. Das schon – vielleicht. Aber auf wen sollte er denn eifersüchtig sein? Hieß man sie nicht „die hochmütige Darthe“? Ging sie mit irgend einem Burschen um? Sie lachte. Die konnten lange warten. Im Grunde gefiel ihr doch keiner so gut wie Jehkab.
[254] Wieder blieb sie stehen und schaute sich um. Dort führte der Weg nach Rothof, dem Wohnsitz der Baroneß Marga, und dort zwischen dem goldleuchtenden herbstlichen Laub der Kastanien schimmerte das steile Ziegeldach des alten zweistöckigen Hauses. Sie schlug einen Fußpfad ein, der ihr bekannt war. Es war vielleicht ratsamer, die Landstraße zu meiden.
Schwarz und schwer hingen die Wolken über dem roten Dach. Wie würde das aussehen, wenn die Flammen da herausschlügen? Noch stand das Haus still und friedlich da, und seine nassen Fensteraugen blinkten.
Wenn nur die Baroneß zu Hause war! Und wie würde sie Darthe empfangen? Noch waren ja die Deutschen Herren im Lande, und die Baroneß war ihr vielleicht noch böse wegen der Nadel.
Ein feiner Regen begann hastig zu sprühen. Darthe verlangsamte ihre Schritte. Sie ging zögernd um das große Rasenrund herum, das von Akaziengebüsch eingefaßt war. Rechts und links standen die Kleeten, die Gesindewohnungen, der Pferdestall, der Viehstall, alles altmodisch aus ungestrichenem Holz aufgebaut. Das fängt Feuer wie Zunder, dachte sie.
Endlich trat sie in die herrschaftliche Küche.
Am Herd hantierte die alte weißhaarige Wirtin, eine treue langbewährte Person. Sie klapperte mit Topfdeckeln und Schüsseln.
„Guten Tag,“ sagte Darthe.
Uber ihre Hornbrille hinweg sah die Alte sie an.
[255] „Wer bist du und was willst du?“
„Darthe Semmit heiß’ ich und muß das gnädige Fräulein Baroneß sprechen.“
„Du mußt, ei, ei!“ sagte die Alte tadelnd und wiegte ihren weißen Kopf mit dem winzigen aufgesteckten gelblich-weißen Haarknötchen. „Die alte Höflichkeit ist schon lange aus der Mode, wie mir scheint. Vor vierzig Jahren noch, als ich jung war und hübsch wie du, da sagte man: Darf ich das gnädige Fräulein Baroneß sprechen? So sagte man damals, mein liebes Kind.“
Ein spöttisches Lächeln flog über Darthes Züge. Sie blieb stumm.
„Ist’s denn gar so eilig?“ fragte die Alte wieder. Ein lauernder Blick, scharf wie Essig, flog über die Hornbrille zu Darthe.
„Es ist eilig!“ sagte Darthe mit Nachdruck.
Zornig ließ die Alte einen eisernen Topfdeckel auf den Herd klirren, wischte sich die Hände in einem groben Handtuch rein, strich sich das glatte Haar noch glatter und zupfte ihre Schürze zurecht.
„Nun, so komm!“ sagte sie verdrossen. „Leg zuvor dein nasses Tuch ab.“
Sie führte Darthe durch einen schmalen Gang, durch ein geräumiges einfaches Speisezimmer in eine kleine freundliche Stube. Weiße Mullgardinen hingen vor den Fenstern. Das Zimmer stand voller Rohrmöbel und hatte nur zwei gepolsterte Stühle. In der Ecke ein kleiner Schreibtisch, an den Wänden altmodische Familienbilder.
[256] Sie klopfte an die nächste Tür und trat, ohne die Antwort abzuwarten, ein.
Darthe sah sich neugierig um. Alles gutes Futter fürs Feuer, mußte sie wieder denken.
Jetzt ging die Tür auf, und lächelnd, strahlend wie eine junge Rose, stand die Baroneß da. Ihre Wangen aber und ihre Augen waren feucht von Tränen.
„Darthe Semmit,“ sagte sie, „ich freue mich herzlich, dich zu sehen!“ Sie legte ihr die schlanken Hände auf die Schultern.
In Darthes Augen leuchtete ein warmes Licht, – doch sie besann sich, – sie haßte ja die Baroneß. Schroff trat sie einen Schritt zurück.
„Ist niemand hier, der uns hören kann?“ fragte sie in gedämpftem Tone.
Befremdet blickte Baroneß Marga sie an.
„Nein,“ sagte sie ruhig, „die alte Ohsoling ist durch eine andere Tür wieder hinausgegangen, und hier unten bin ich allein. Hast du mir ein Geheimnis zu sagen?“
„Ja!“ sagte Darthe fest und schwer. Die Baroneß schloß beide Türen vorsichtig, setzte sich quer über einen Rohrstuhl, kreuzte die Arme nachlässig über der Lehne und sah Darthe erwartungsvoll an.
„Nun, so sprich, Mädchen!“ sagte sie.
Wie wurde doch Darthe das Sprechen so schwer, sie hatte [257] es sich leichter gedacht! Sie schluckte hastig ein paarmal und fühlte, wie sie zitterte.
„Frierst du, Kind?“ fragte die Baroneß besorgt, „du bist ja ganz naß.“
„Nein, nein, lassen Sie nur,“ Darthe würgte an den Worten, „ich bin gekommen, um Sie zu warnen, gnädiges Fräulein!“
Die leuchtenden Augen der Baroneß wurden immer größer. Das krause goldrote Haar umfloß sie wie ein Heiligenschein.
„Mich zu warnen – – wovor?“
„Fliehen Sie!“ stieß Darthe jetzt am ganzen Leibe bebend hervor. „Fliehen Sie so schnell als möglich. Man will Ihnen Ihr Haus niederbrennen!“
Eine jähe Röte schoß in das weiße schöne Gesicht.
„Woher weißt du das, Darthe Semmit?“ Die Stimme klang ruhig und gefaßt.
„Ich hab’s – von den Roten – das lettische Zentralkomitee hat den Tag dazu bestimmt. Heute um zwei Wochen, da werden alle Güter im Kreise angesteckt!“
„Alle Güter?“ schrie die Baroneß. Sie faßte Darthe am Arm.
Das Mädchen nickte. Ihr war die Kehle wie zugeschnürt. „Sie dürfen mich – nicht angeben, gnädiges Fräulein,“ sagte sie endlich stockend, „sonst schlagen mich die Unsrigen tot.“
Das Fräulein stand hoch und vornehm da. Sie war bleich wie ein weißes Tuch.
[258] „Dich angeben – nein! Die Sache aber muß ich angeben, damit Vorsichtsmaßregeln getroffen werden.“
Darthe sank in sich zusammen. Ihre Knie zitterten.
„Tun Sie es nicht ... tun Sie es nicht ...“ würgte sie flehend und hob die Hände – „ich hab’ mein Volk verraten!“
„Willst du, daß ich die Meinigen verrate? Wenn ich schwiege, wäre das Verrat. Ich muß reden, Mädchen.“
Jetzt erst wurde sich Darthe der Tragweite ihrer Warnung bewußt. Ein kalter Schauer um den anderen schüttelte sie. Sie biß die Zähne zusammen.
„Es tut mir leid, daß ich’s Ihnen gesagt habe,“ sprach sie hart.
Da fühlte sie sich von zwei weichen schlanken Armen umfaßt.
„Nein, Darthing, nein! Das soll, das darf dir nicht leid tun! Ich danke dir, danke dir von ganzem Herzen, aber sieh, ich wäre ja der letzte Lump, wenn ich mich allein rettete und die anderen Güter brennen ließe. Baron von Wolfshausen muß ich’s sagen, ich kann, ich darf ihm nichts verschweigen – er ist mein Verlobter, Darthing, Vor einer halben Stunde noch war er hier.“
Baroneß Margaß Gesicht war von heißen Tränen überströmt. Sie streichelte Darthe die Wangen.
„Er sagt’s keinem weiter, wenn ich ihn bitte,“ fuhr sie fort, „und den anderen kann ich ja sagen, daß ich einen Drohbrief erhalten habe.“
Darthe schüttelte den Kopf. „Und ich hab’ meine Leute doch verraten,“ murmelte sie.
[259] Die Baroneß trat zurück. „Hast du mich denn so lieb, Kind?“ fragte sie. „Wie kann ich dir das vergelten?“
„Lieb?“ Darthe öffnete weit die dunklen Augen. „Ich hab’ Sie nicht lieb, – ich hasse Sie, denn Sie sind ja unsere Feinde!“
Wieder umschlangen sie die weichen Arme.
„Darthing, Darthing,“ schluchzte die Baroneß, - „wenn mich doch viele so hassen würden wie du! Du hast mich ja lieb, – Darthing! Weißt du es denn nicht?“
Nein, Darthe hatte es nicht gewußt. Ihre Lippen zuckten. Sie seufzte schwer auf, als habe sie diese plötzliche Erkenntnis von einer drückenden Last befreit. Zwei große Tränen rollten langsam über die braunen Wangen.
„Ja ... ich habe Sie lieb ... darum konnte ich nicht anders.“
„Lieber Gott, lieber, großer, guter Gott!“ stammelte die Baroneß außer sich – „ich danke dir!“
Langsam schlug Darthe die Augen zu dem Fräulein auf.
„Werden Sie fliehen?“ fragte sie beinahe schüchtern.
„Ich weiß es nicht, aber ich danke dir für diese Stunde, Darthe Semmit. Ich habe nichts auf der Welt, womit ich dir zeigen könnte, wie sehr ich dir danke. Nichts ist groß genug dazu, aber ich gebe dir etwas ... mein Herz. Willst du es nehmen, Darthing?“
„Ja!“ sprach Darthe. „Ich werde Sie nie vergessen, Fräulein!“
[260] Sie wandte sich zur Tür.
„Gott schütze dich, Darthing!“ rief ihr die weiche Stimme des Fräuleins nach.
Wie betäubt ging Darthe hinaus.
Sie öffnete und schloß die Türen mechanisch und bemerkte nicht, daß die alte Ohsoling ihr mit offenem Munde nachstarrte, als sie ohne Gruß an ihr vorüberschritt ins Freie. Der Regen war stärker geworden, und nun erst sah Darthe, daß sie ohne Umschlagetuch war. Zögernd stieß sie die Küchentür wieder auf.
„Ich hab’ mein Tuch vergessen,“ sagte sie tonlos.
„Ei, sieh doch, das gnädige Fräulein haben ihr Tuch vergessen,“ höhnte die alte Ohsoling giftig, „und das Adieusagen haben das Fräulein auch vergessen!“
Darthe wandte nicht einmal den Kopf. Stumm ging sie hinaus.
Ein kräftiger Wind hatte sich erhoben. Triefende goldgelbe Kastanienblätter wehten von den alten Bäumen, und der Wind trieb sie flüsternd vor ihr her, quer über den Weg. Sie hüllte sich fester in ihr Tuch und schauerte zusammen. Mochten die Volksgenossen immerhin kommen, – ihr Fräulein Marga würde sich zu schützen wissen, ihr Fräulein Marga, das ihr, Darthe Semmit, ihr Herz geschenkt hatte, und die sie liebte. Ja, nun empörte sich nichts in ihr dagegen. Sie hatte sie lieb, ganz einfach, da konnte niemand dagegen an. Ein fröhlicher Trotz stieg in ihr auf, und rüstig schritt sie aus, den Fußpfad entlang.
[261] Bald war sie wieder am Fluß. Die dunkle Flut rauschte an ihr vorüber, schnell, wie schnell – es war, als ob sie zu einem Wettlauf einlade. Und Darthe ging schnell, viel schneller, als sie gekommen war. Eine weiche, nebelige Dämmerung senkte sich leise, leise herab. An den rinnenden Zweigen der Weidenbüsche, die sich über das fließende Wasser beugten, schien die Dunkelheit grau hinunter zu schleichen. Auf einem abseits liegenden Gehöft schlug ein Hund an, das gedämpfte Brüllen einer Kuh wurde hörbar, – sonst Stille. Dunkler ward es und dunkler, schwarz drängten sich die Wacholder- und Weidenbüsche zusammen, der Fluß rauschte lauter und vernehmlicher, der Regen strömte, und am dunklen Himmel jagten unruhige zerrissene Wolken.
Tapfer und stetig schritt das Mädchen durch die dunkle Herbstnacht.- -
Zu Hause lagen Vater und Mutter in tiefem Schlummer.
Darthe schlief bis in den Tag hinein den traumlosen Schlaf eines glücklichen erschöpften Kindes.
Um die Mittagszeit, früher als gewöhnlich, kam Mutter Greetsche heim und warf einen fragenden Blick auf ihre Tochter.
Darthe saß über ihrer gewohnten Näharbeit und rührte sich nicht.
Aufgeregt ging Mutter Greetsche hin und her, nahm die Suppe vom Herd und schöpfte saure Grütze aus dem Kübel in eine Tonschüssel.
[262] „Wo bist denn gewesen?“ fragte sie plötzlich.
Darthe sah von ihrer Arbeit nicht auf.
„Am Fluß!“ erwiderte sie lakonisch.
Breitspurig stellte sich die Frau vor ihr auf. „Bei nachtschlafender Zeit? Was treibst du dich denn nur immer am Fluß herum, Mädchen?“
Darthe schwieg. Das rote breite Gesicht der Frau wurde immer aufgeregter. „Ich hab’ den Grendsche-Jehkab beim Zehsewirt getroffen,“ begann sie unsicher.
Darthe blickte auf. „So?“ fragte sie. „Ja – er ist aus dem Dienst gejagt – hat Streit gehabt mit dem Baron.“
„Warum denn?“
„Was weiß ich? Geld soll abhanden gekommen sein – so sagte mir die Zehsewirtstochter – die hat’s von der Verwalterin. Und grob ist er gewesen.“
Darthe wurde dunkelrot. „Und dann soll nu gerade der Jehkab ...“ sprach sie zitternd.
„Nu, das ist ja noch nicht gesagt ... aber wütend war der Bursch, – ganz auseinander. Geflucht und geschrieen hat er wie ein Rasender. Einen großen Skandal hat’s gegeben.“
Beide schwiegen. Die Zeit schien stille zu stehen. Klirrend warf Darthe die Schere auf den Tisch. Im Hofe krähte ein Hahn.
„Ich war nur froh, daß der Vater nichts davon hörte,“ begann die Frau wieder. „Der Jehkab ist kein guter Mensch, Mädchen“
[263] Darthe lachte schwer und bitter auf.
„Mit mir hat er sich auch ausgeredet,“ fuhr Mutter Greetsche zögernd fort.
„Was hat er denn gesagt?“ fragte Darthe gleichmütig.
„Nu, dies und das – reden kann er ja wie ein Schwarzrock. Heiraten mag er nicht mehr – das war die Hauptsache.“
Darthe beugte sich weit vor. „Wie?“ dehnte sie ungläubig.
„Nu ja, Kind, ’s wär’ keine Zeit zum Heiraten, hat er gesagt. Und ein armes Mädchen könnt’ er nicht nehmen; und ’s wär’ ihm nicht Ernst gewesen damals beim Grünfest – nur aus Trotz hätt’ er’s getan ... das sollt’ ich dir sagen.“
Schwer und lähmend kroch es durch Darthes Glieder. Wie erstarrt saß sie da. Die böse Falte auf ihrer Stirn grub sich tief und drohend ein.
Sie raffte sich auf und packte ihr Nähzeug hastig zusammen. „’s ist gut, Mutter!“ sagte sie heiser.
„Nimm dir’s nicht zu Herzen, Mädchen,“ sagte Mutter Greetsche tröstend, „du findest noch sicher einen guten Mann.“
„Meinst du?“ stieß Darthe höhnisch hervor.
„Und wie! Hätt’st nur damals den Dumpje-Wirt nicht vor’n Kopf stoßen sollen. Wärst bald eine reiche Frau geworden!“
Jetzt sprang Darthe auf wie eine wilde Katze. Ihre Augen funkelten.
„Hör auf, Mutter!“ schrie sie wütend. „Sprich mir noch einmal vom Dumpje-Wirt – und du siehst mich nie wieder!“
[264] „Nu, nu,“ beschwichtigte Mutter Greetsche erschreckt, „ich sag’ ja nur so. Was ist denn nur dabei? So sei doch nicht gleich so auseinander, Mädchen!“
Damit stellte sie die Suppe auf den Tisch, legte ein Laib Schwarzbrot daneben und drei Holzlöffel. „Nu kommt der Vater.“
Gebückt und grau schlich die krumme Gestalt Jahn Semmits an den kleinen Fenstern der Hütte vorüber.
Stöhnend trat er ein und hing die Mütze an den Nagel. Er setzte sich an den Tisch, faltete die Hände und flüsterte ein Gebet. Stumm und schweigsam wurde die Mahlzeit eingenommen. –
Am Nachmittag des nächsten Tages trug Darthe ein Bündel auf den Zehsehof. Sie hatte einen Kleidrock an die Zehsewirtstochter abzuliefern.
Es war ein kalter, windiger Herbsttag. Graue fliegende Wolken eilten einander überhastend in Schichten über den trüben Himmel. Klagend rauschte der müde Birkenwald an der Landstraße. Die verwitternden Stoppeln der Felder standen graugelb und starr in die Höhe. Welke Blätter jagten vom Winde getragen über sie hin und verfingen sich in den Stoppeln. Die Wagenspuren der Landstraße standen noch voll Wasser.
Darthe schlug einen Feldweg ein. Vor ihr lag mit der Rückseite das Gehöft des reichen Zehsebauern. Sie ging um das Gesinde herum und trat in das Gehöft. Viehstall, Wagenscheune, Kornspeicher und Kleete rahmten den viereckigen Hof ein.
[265] Vor der Tür auf der Bank saßen zwei, die semmelblonde Zehsewirtstochter und – Grendsche-Jehkab.
Verwirrt sprang er auf. Sie maß ihn mit flammenden Blicken.
„Guten Abend, Zehsetochter,“ sprach sie ruhig. „Ich bring Euch Euren Kleidrock.“
Die Semmelblonde sah sie spöttisch an.
„Es ist gut,“ sagte sie, „legt nur ab in der Stube.“
„Wollt Ihr nicht anprobieren?“ fragte Darthe wieder. „Ich hab’ keine Zeit, später wieder daran herumzuändern.“
Gelangweilt erhob sich das Mädchen von der Bank. „Habt Ihr denn so ungeheuer viel zu tun, Darthe Semmit?“ fragte sie spitz.
Sie traten in[WS 13] die geräumige warme Stube. In buntem Durcheinander standen modische Möbel und Bauerngerät. In der Ecke ein altes schlechtes Tafelklavier. „Ich hab’ meine Arbeit und bin zufrieden,“ erwiderte Darthe. „Unnütze Arbeit mag wohl niemand gern.“
Sie löste das Bündel und nahm den Rock heraus. Die Zehsewirtstochter stand steif und gespreizt da und ließ sich von Darthe den Rock überwerfen und zuhaken. Sie rührte keinen Finger. Nicht umsonst war sie ein Jahr in Mitau in der Stadttöchterschule gewesen und hatte Klavierspielen gelernt.
Darthe kniete am Boden und zupfte die Rockfalten zurecht. „Seid Ihr zufrieden, Zehsetochter?“ fragte sie.
[266] Linda Zehse fuhr mit den roten Fingern tastend am Rock hin und her. „Er ist zu kurz!“ sagte sie endlich.
„Er ist genau eine Handbreit vom Boden entfernt,“ erwiderte Darthe. „So hattet Ihr’s bestellt.“
„Es ist gut!“ meinte die Wirtstochter verdrießlich. „Hakt ihn wieder auf. Ich bin Euch achtzig Kopeken schuldig.“
„Neunzig Kopeken!“ sagte Darthe scharf.
„Ach ja, ich vergaß!“
Sie zog eine grünseidene gehäkelte Börse aue der Tasche und zählte Darthe umständlich das Geld in die Hand.
Der neue Rock lag am Boden.
„Legt den Rock doch ordentlich zusammen,“ befahl Linda Zehse, „und kommt in spätestens drei Tagen wieder. Könnt’ sein, daß ich noch vieles brauchen tät.“
Ein triumphierend lauernder Blick fuhr aus den hellblauen Augen in die schwarzbraunen Darthes.
Gemächlich faltete Darthe das Tuch zusammen, in dem sie den Kleidrock getragen, und faßte die Türklinke.
„Lebt wohl, Zehsetochter,“ grüßte sie kurz.
Mit hochmütigem Nicken beantwortete die Wirtstochter den Gruß.
Die Bank vor der Haustür war leer. Grendsche-Jehkab hatte sich eilig davongeschlichen.
„So ein Lump!“ knirschte Darthe zwischen den Zähnen, „so ein elender Lump!“ Dann warf sie den Kopf zurück und [267] schritt hastig die Landstraße entlang. Sie ging nicht den Weg, den sie gekommen war. Wieder trat ihr die lichte Gestalt der Baroneß vor die Seele. War die etwa hochmütig! Gott schütze dich! waren ihre Abschiedsworte gewesen, – und ich schenke dir mein Herz, willst du es nehmen, Darthing! Umarmt hatte sie sie wie eine Schwester, gedankt hatte sie ihr und geweint wie ein Kind. Und ihr wollten die lettischen Genossen das Haus über dem Kopf anzünden? War das nicht bitteres Unrecht? Ihr, die niemandem Böses getan hatte, die allen Leuten wohltat und half, wo sie konnte! Warum? Weil sie eine Baroneß war. Besser eine Baroneß als eine Wirtstochter wie Linda Zehse. Ja, es war bitteres Unrecht, die Volksgenossen taten Böses, und aus Bösem konnte nichts Gutes kommen.
Der sonnige Herbsttag fiel ihr wieder ein, da drüben auf der Wiese des Dumpje-Wirts die Ausgrabungen vorgenommen wurden. ,In diesen Gräbern’, hatte das gnädige Fräulein gesagt, ,sollen einige des Volkes ruhen, die vor euch Herren im Lande waren. Alle werden wir einst in Grabern ruhen.’ Ja, so war’s. Die alten Völker, die hier geherrscht hatten, waren hinweggestorben wie Gras – andere Völker waren gekommen und auch sie würden vergehen. Die Zeit mähte sie alle hinweg wie mit einer Sense. Und alle, alle würden sie endlich in Gräbern ruhen. Lohnte es sich da einander zu befehden und zu hassen?
Unwillkürlich hatte sie ihre Schritte nach der Wiese hinübergelenkt. Da stand sie vor der halbverschütteten Grube des [268] Gotengrabes und blickte hinein: Alle Zorn- und Rachegedanken waren verflogen. Eine müde Traurigkeit war über sie gekommen.
Langsam schlich sie hinunter zum Fluß. Er glitt rauschend und ruhelos an ihr vorüber, und mechanisch, wie von einer geheimnisvollen Macht gezogen, wanderte sie ihm nach, stromabwärts.
Dichtes Weidengestrüpp hemmte ihren Weg. Das Ufer wurde steil und abschüssig. Verloren blickte sie um sich, sie fühlte sich müde und zerschlagen.
Da lag ein großer Feldstein. Sie hatte als Kind manchmal hier gespielt und hatte Kuchen aus Lehm darauf geformt. Jetzt setzte sie sich auf ihn, stützte die Ellbogen auf die Knie und starrte in die schwärzliche Flut. Grau in grau lag das jenseitige Ufer mit seinen dunstigen Waldfernen. Es dämmerte. Mit einem Male fuhr sie auf. Ein gräßlicher Schrei, laut und gellend, bohrte sich durch die Stille. Sie hörte etwas aufklatschen, als habe einer einen Block ins Wasser gewälzt. Ein ächzend gurgelnder Laut – hastig eilende Schritte – dann nichts mehr.
Zitternd stand sie still. Hier war etwas Furchtbares geschehen. Sie bog vorsichtig das Weidengestrüpp auseinander – nichts. Hastig klomm sie die steile Böschung hinauf und spähte in den Fluß – – da sah sie etwas Dunkles dahin treiben – regungslos – tot. Es war ein Mensch!
Ein Schauer überlief sie. Sie hastete den Flußrand entlang [269] wie gehetzt, und wieder blieb sie stehen wie angewurzelt. Sie sah Fußspuren, aufgewühlte Erde – und da – Blut ... ja Blut!
Kalt rieselte es ihr über den Rücken. Sie blickte mit großen leeren Augen um sich und sah einen Mann in hastigem Lauf quer über die Wiese stolpern. Sie sah ihn von rückwärts und erkannte – – Grendsche-Jehkab! – –
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich eine unheimliche seltsame Kunde durch das Land: der junge Majoratsherr Baron Wolf von Wolfshausen war ermordet worden. Niemand war der Tat auf der Spur, niemand hatte seine Leiche gefunden, und dennoch glaubte niemand an ein Verunglücken, an eine plötzliche Abreise oder sonst einen Grund, der sein Verschwinden erklärt hätte. Wie grinsende Fratzen aus dunklen Ecken tauchten mit der gleichen dringlichen Hartnäckigkeit die gleichen Gerüchte immer wieder auf: Baron Wolf war ermordet worden. Nur über dem „Wie“ schwebte ein phantastisches Dunkel. Und überall herrschte eine lauernde Spannung, die sich in manchen Gehöften zu offenkundiger Schadenfreude steigerte. Die Tat wurde jubelnd gepriesen. Sie war das Befreiungssignal für die aufrührerischen Elemente. Sie war der zündende Blitz in der drohenden Gewitterschwüle, – sie war die erste tödliche Kugel in das feindliche Lager. Die Spannung wuchs. Selbst friedliche Leute, die sich von dem allgemeinen Aufruhr abseits hielten, hatten sich in gierige Maulwürfe verwandelt. Uberall suchte man in fieberhaftem Eifer nach den Spuren des Verschollenen.
[270] Mittlerweile aber ruhte die Leiche Baron Wolfs, von einem vorspringenden abgebrochenen Ast gehalten, zwei Fuß unter dem Wasser in seinem strömenden Grabe.
Die eine aber, die den Leuten hätte sagen können, was mit Baron Wolf geschehen war, die eine schwieg, und der andere, der die schmachvolle Tat vollbracht hatte, der schwatzte laut und zudringlich und pries sich vor den Leuten glücklich, daß er schon ein paar Tage früher den Dienst des Barons verlassen habe und somit alle Verantwortung von sich abschütteln könne. Er war ja auch an dem Abend bei dem Zehsewirt gewesen, die Zehsewirtstochter konnte das bezeugen.
Geradezu der Verzweiflung nahe war der Pastor. In seiner Gemeinde, in seiner von ihm gehüteten Herde konnte eine ruchlose Mörderhand sich an dem Leben des jungen Majoratsherrn vergreifen, an dem jungen Leben seines Taufkindes und Konfirmanden, seines Schülers, den er wie einen Sohn liebte und den er bald zu trauen gehofft hatte. Wie schlecht mußte er da seine Herde gehütet haben! Nein, er war nicht mehr wert, das geistliche Amt zu verwalten, und in tiefer Zerknirschung reichte er beim kurländischen Konsistorium seine Bitte um Entlassung ein. Dazu kam aber noch ein anderes, Persönliches: Er selbst war die schuldlose Veranlassung der Mordtat gewesen. Er hatte den jungen Baron gebeten, die am Fluß gelegenen Pastoratsfelder zu besichtigen und zu entscheiden, ob ein Stück Weideland zum Kornbau umgeackert werden solle oder nicht. Er hatte Baron [271] Wolf begleiten wollen auf seinem Gange, aber ein plötzliches Unwohlsein hatte ihn daran verhindert. Die Blutspuren, die Darthe noch gesehen hatte, waren vertilgt und verschwunden. So blieb die Tat in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt, aber an dem Morde selbst zweifelte niemand.
Von der Seelennot des alten Herrn drang die trübe Kunde direkt zu Darthe Semmit. Mauschen, die Darthe ebenfalls mit Näharbeit versorgte, hatte sich schluchzend darüber ausgesprochen. Dennoch konnte Darthe schweigen.
Ja, Darthe konnte schweigen, und sie schwieg. Das Furchtbare, das sie allein gesehen hatte, lag wie ein drückender Alp auf ihr und hatte ihr Inneres von Grund auf zerwühlt und zerrissen. Fräulein Marga – das war ihr Hauptgedanke bei Tag und bei Nacht. Fräulein Marga war ein Leid geschehen. Und Grendsche-Jehkab, ihr früherer Verlobter, war der Mörder. Sie wurde stumpf und dumpf; mühselig rannen ihre Tage dahin.
Der folgende Sonntag brachte eine völlig gefüllte Kirche. Die Leute kamen aus Neugier – was würde der alte Pastor diesmal zu sagen haben?
Darthe saß auf einer der hintersten Bänke. Weit vorne sah sie Grendsche-Jehkab, und auf der Frauenseite die Zehsewirtstochter sitzen, neben ihr Mauschen und die Frau Pastor, und dort – rechts von der Pastorin – Darthe setzte der Herzschlag aus – sah sie das rotblonde schimmernde Haupt der Baroneß Marga!
[272] Sie trug tiefe Trauer. Ein Streifen ihres abgekehrten Gesichts war von schneeiger Blässe.
Über der Gemeinde lagerte eine dumpfe erwartungsvolle Stille.
Gebückt und langsam trat der Pastor zum Altar. Er sah krank und verfallen aus und sprach die Liturgie mit hohler, zitternder Stimme.[WS 14]
Ein Flüstern ging durch die Reihen.
Dann wurde das zweite Kirchenlied gesungen. Es war ein Bußlied.
Endlich betrat der alte Mann die Kanzel.
Das sonst so milde, freundliche Gesicht war streng und düster. So hatte Darthe ihren Pastor nie gesehen. Die alten blauen Augen durchliefen forschend und zögernd die gedrängten Reihen.
Er beugte sein Haupt zum Gebet, und als er es wieder erhob, – da sah sie es wieder: das war nicht mehr der milde, väterliche Freund, – er war ein anderer geworden, ein Ankläger und Richter. „Gemeinde des Herrn!“ sagte er, nicht wie sonst „liebe Gemeinde“.
„In unserer Mitte ist eine furchtbare, schreckensvolle Tat geschehen. Eine feige Mörderhand hat unsern jungen Majoratsherrn, Baron Wolf von Wolfshausen, hinterrücks und heimtückisch erstochen. Dann hat der elende Mörder ihn, den wehrlosen, den [273] gütigen Herrn in den Fluß gestoßen. Gestern nachmittag ist es der Polizei endlich gelungen, die Leiche zu finden.“
Er machte eine längere Pause. Die Köpfe beugten sich vor, ein dumpfes Gemurmel ging von Mund zu Mund.
„Gemeinde des Herrn!“ begann der alte Mann wieder und reckte seine gebeugte Gestalt hoch empor. „Ich klage wider dich beim Throne Gottes! Ich muß wider dich klagen. Dem Mörder stehe ich noch nicht gegenüber und kann ihn seiner furchtbaren Schuld nicht überweisen, doch die Zeit wird kommen, denn das gerechte Auge Gottes schläft nicht. Dich aber, meine langjährige Gemeinde, klage ich an, denn der Geist der Empörung, des Aufruhrs, der Unzucht und des Mordes geht wie ein zehrendes lüsternes Fieber in dir um. Aus deiner Mitte hat sich die Mörderhand erhoben, dein böser, unbotmäßiger Geist war es, der die Klinge führte. Darum klag’ ich dich an! Wie kann ein Geist der Ordnung, der Gesittung und Treue eine solche Tat vollbringen? Ihr steht unter einem bösen Geist – deshalb klage ich wider euch. Und ich klage mich an, Gemeinde des Herrn! Ich bin mit schuld an der Tat. Ich habe es nicht verstanden, euer Vertrauen zu gewinnen, eure Seelen vor der Ruchlosigkeit zu bewahren. Ich bin ein unnützer Knecht gewesen all die vielen Jahre hindurch, und darum will ich mein Amt verlassen!“
Ein leises Schluchzen ging durch die Reihen der Frauen.
„Nein! Nein!“ schallten vereinzelte Rufe.
„Der Haß zwischen Letten und Deutschen ist künstlich gesät,“ [274] fuhr der alte Pastor fort, „aber ihr habt ihm eure Herzen geöffnet! Der Pastor, der Baron – ist ein Deutscher – und damit habt ihr geglaubt alles abzutun. Den Menschen dabei habt ihr vergessen. Ihr wolltet nicht hören, ihr wolltet eure Seelen nicht auftun dem Worte Gottes, das ,der Deutsche’ predigte, und ihr seid schnell gesunken, nur allzu schnell von Stufe zu Stufe. Gerechtigkeit und Glaube hat euch verlassen. Wie ein Schiff ohne Steuer treibt ihr dem Verderben entgegen. Freiheit ist eure Losung, Befreiung von der Knechtschaft der Deutschen’, – aber unfreier denn jemals seid ihr geworden, Knechte eurer Begierden, eurer Habsucht, eurer Rachsucht! Ihr seid wie Kain, der die Bruderhand gegen Abel erhob. Und darum klag’ ich euch an!“
Mit flammenden Augen stand der Pastor da – er hielt seine Hand weit ausgestreckt – und Darthe sah es mit Entsetzen – seine Finger wiesen in die Richtung, wo Grendsche-Jehkab war.
Die Gemeinde saß stumm und verwirrt. Auch die lautesten Schreier hielten die Köpfe gesenkt. Sie wagten kaum zu atmen.
„Kehrt um, solange es noch Zeit ist!“ sprach der Pastor dumpf nach einer schweren Pause.
Und nun verlas er den Text. Er hatte den Brudermord Kains gewählt.
Die Predigt war schlicht und ergreifend, aber wie ein Nachklang zu der erschütternden Einleitungsrede hallte sie an Darthens Sinnen vorüber.
Endlich verlas der Pastor die Geborenen, Verstorbenen [275] und Brautpaare. Nachdem er die Namen der Täuflinge genannt hatte, fuhr er fort:
„Baron Wolf von Wolfshausen – gefallen durch Mord. Gott allein sieht ins Verborgene und wird richten und strafen zu seiner Zeit. Gott sei der Seele des Sünders gnädig!“
Dann folgte ein Gebet.
Ein leises Schluchzen zitterte durch den Raum, ein Scharren und Murmeln. Baroneß Marga mar ohnmächtig zusammen gebrochen. Sie wurde in die Sakristei getragen. Mauschen und die Pastorin folgten weinend.
Eintönig las der alte Mann weiter: „Aufgeboten zum ersten Male: Der Grendsche-Häuslerssohn Jehkab Abol und die Wirtstochter Linda Zehse.“
Darthe fuhr auf, als habe sie einen Peitschenhieb erhalten. Atemlos beugte sie den Kopf vor, ihre Augen traten aus den Höhlen, sie sprang auf und sank im nächsten Moment kraftlos auf die Bank zurück.
Dann aber raffte sie sich wieder zusammen und stürzte mit wankenden Knien hinaus.
Noch einige Minuten und die Kirche begann sich langsam zu leeren. Düster, mit gerunzelten Brauen und gesenktem Nacken strömten die Männer hinaus; die Frauen hatten verweinte Augen und rote Flecken auf den Wangen.
Frei und ehrlich blickten die hellen Augen Vater Semmits um sich. In seinem Hause ging der böse Geist nicht um. Er [276] hatte ein gutes Gewissen. Fassungslos schluchzte Mutter Greetsche. Der Dumpje-Wirt war nicht gekommen. Unsicher schritt Vater Zehse neben seiner Tochter her. An ihrer Seite hielt sich Grendsche-Jehkab.
Er war bleich. Seine Haare klebten an seiner Stirn. Unruhig suchend gingen seine Augen hin und her. Er redete auf Linda Zehse ein und lachte, – lachte verwirrt und gezwungen.
Da trat Darthe Semmit vor. Furchtlos blickte sie ihm in die Augen.
„Schuft!“ sagte sie laut und ruhig.
Ihre Stimme war hart wie klingender Stahl.
„Du Schuft!“ wiederholte sie zum zweiten Male langsam und deutlich.
Er stürzte sich mit geballten Fäusten auf sie.
„Rühre mich nicht an!“ gellte sie, „oder ... ! Ich bin zu gut für deine feigen ...“
Sie sprach das letzte Wort nicht aus, aber ihre Drohnung war so wild, der Ton ihrer Worte so grauenvoll, daß er zurückprallte.
Er erzwang ein schallendes Gelächter.
„Darthe Semmit ist verrückt geworden!“ schrie er. „Aus unglücklicher Liebe! Vorwärts – lassen wir sie laufen!“
Mit einer prahlerischen Gebärde schob er die leere Luft gleichsam von sich.
Aber Darthe hatte sich schon abgewendet. Mit düster gesenktem Kopf schritt sie unbehelligt nach Hause. –
[277] Die folgenden Tage brachten klares Frostwetter. Eine dünne harte Eisdecke hatte sich über den angeschwollenen Fluß gelegt, als sei er ihr zu rebellisch geworden, und als müsse sie ihn in strenge Haft nehmen.
Die aufgeweichten Wege waren hart und starr. In den ausgefahrenen Wagenspuren knisterte bröckliges Eis. Polternd dröhnte jedes Gefährt über die Landstraße. Und über den hartgefrorenen Weg dröhnten diesmal wuchtige, taktfeste Schritte – eine Abteilung Dragoner. Der kommandierende Offizier nahm Quartier in dem verwaisten Schloß derer von Wolfshausen.
Furcht und Zittern ergriff die Gemeinde. War die Stunde der Vergeltung schon da, ehe die Herrenhäuser in Flammen standen? Der Tag war gekommen, den viele als die Stunde der Befreiung kaum erwarten konnten. Die Herrenhäuser und das Schloß von Wolfshausen aber standen fest und sicher da, und nur der junge Besitzer ruhte allzufrüh in seinem stillen Grabe.
Es wurden Haussuchungen vorgenommen. Der Dumpje-Wirt war in Haft gesetzt worden. Allüberall herrschte eine dumpfe gedrückte Stimmung. Nächtliche Streifzüge der Dragoner vermehrten die Unruhe. Ein Versuch, den Viehstall eines Nachbargutes in Brand zu stecken, war rechtzeitig vereitelt worden. Hier und da flammten einige Scheunen auf, doch war der Schaden nicht so erheblich, und die Wachsamkeit der Dragoner wurde verschärft.
Die Erbitterung in der Gemeinde stieg. Überall finstere, [278] sorgenvolle Mienen. Mit unverhohlenem Mißtrauen betrachtete jeder Nachbar den andern: war er der Verräter? Wer hatte die Dragoner so rechtzeitig gerufen? Sie waren am Tage vor dem angesetzten Datum des Brandes eingetroffen. Ja, es gab einen Verräter unter ihnen.
Und allmählich wurden murrende Stimmen laut, die sich gegen den rätselhaften Mord des Barons aussprachen, die den Fall beklagten. Der Mörder hatte ihnen allen durch seine unbedachte verfrühte Freveltat die Rechnung verdorben. Er trug die Schuld, daß man der ganzen Gemeinde diese Dragonerspürhunde auf den Hals gehetzt hatte. Er allein. Aber wer war der Mörder? Ja, wer war er?
Darthe wußte es, und seit einer Stunde wußte es noch ein anderer, der kommandierende Offizier, und bald, bald würde es die ganze Gemeinde wissen.
Sie hatte sich bei dem Offizier Einlaß verschafft und hatte ihm den Tatbestand knapp und klar berichtet. Dann war sie gegangen. Und nun stand sie an der Stelle, wo der Mord geschehen war, fest in ihr Umschlagetuch gehüllt, und starrte auf das glitzernde Eis des gefangenen Flusses nieder. Hier war ihres Bleibens nicht länger. Was weiter geschah, wollte sie nicht sehen, nicht wissen.
Sie hatte nur noch ein Ziel. Baroneß Marga. Aber noch gestern hatte ihr Mauschen im Pastorat erzählt, daß die Baroneß mit ihrer harthörigen Tante fortgezogen sei, nach Mitau.
[279] Und nun wollte sie nach Mitau.
Der Fluß führte direkt bis vor die Mauern des alten kurländischen Städtchens, aber das Eis war noch unsicher, und diesseits des Flusses mochte sie nicht wandern. Sie wollte bekannten Gesichtern nicht mehr begegnen. Ihr Leben bisher sollte ausgelöscht und vergessen sein.
Also mußte sie hinüber.
Drüben winkte ein neues Leben. Jenseits des Flusses war das neue, das unbekannte Land, das neue Leben, nach dem sie sich sehnte. Der Fluß, ihr alter Freund, führte sie auf geradem Wege dorthin, wo jemand sie lieb hatte und vielleicht nötig hatte.
Sie mußte über den Fluß.
Zögernd klomm sie die steile Böschung hinunter und setzte den Fuß auf das junge Eis.
Noch einmal sah sie sich um. Am gottblauen Himmel stand die Sonne siegreich und heiter und warf jubelnde Strahlen auf das funkelnde Eis, auf das erstarrte Gelände drüben und die blauen fernen Tannenwälder.
Und noch einmal stand ihre Kindheit in heller Ferne vor ihrer Seele. Sie mußte an die Märchen der toten Großmutter denken, an den Regenvogel, der nicht mit hatte helfen wollen, als die andern Tiere auf das Geheiß Gottes fleißig gruben, um Flüsse und Ströme zu schaffen.
Und über ihr düsteres Gesicht flog das erste Lächeln seit vielen langen Tagen.
[280] Vorsichtig gleitend schritt sie weiter, – das Eis hielt – sie war über die Mitte des Flusses hinausgekommen.
Plötzlich aber gab es einen Krach. Eckige Strahlen zeichneten sich blitzartig auf der dünnen Eisschicht.
Sie tat noch zwei Schritte. Da barst das Eis auseinander. Sie stürzte in den Strom. Schwarz und lüstern kam das Wasser aus der Tiefe gekrochen. Gurgelnd schlug es über ihr zusammen.
Sie sank und sank, ohne ein Glied zu rühren. Das schwere Wollentuch, die Kleider sogen sich voll von dem eiskalten Wasser. In ihren Ohren brauste der Sturm. Aber über den Sturm hinaus tönte die freundliche Stimme der Großmutter. „Lauf nicht immer an den Fluß, Kind, sonst läuft er einmal nach dir und holt dich. Sie aber lag im tiefen Sande und sonnte sich ... Und der Herrgott kam des Wegs und fragte so recht freundlich: „Was tust du denn hier in der Sonne, liebes Buttchen?“ ... und der Herrgott hatte strahlendes goldrotes Haar und trug die Züge der Baroneß Marga, und um sein Haupt wehte ein lichter goldener Heiligenschein ...
„Ich will dir mein Herz schenken, liebes Darthing – – willst Du es nehmen? ...“
Dann hörte sie nichts mehr.
Anmerkungen (Original)
- ↑ Meiting=Töchterchen